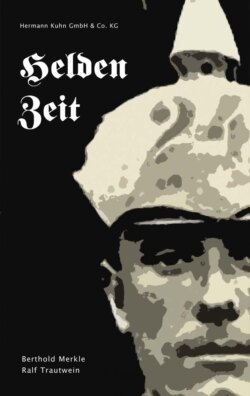Читать книгу Heldenzeit - Ralf Trautwein - Страница 19
KAPITEL 16 - DER „BAHNLE”
ОглавлениеSCHWENNINGEN, 3. August 1914, 9.05 Uhr. So ein Betrieb wie heute herrschte nur selten auf dem Schwenninger Bahnhof. Höchstens früh am Morgen, wenn die Arbeiter aus Deißlingen und Trossingen in die Uhrenfabriken strömten, waren so viele Leute dort unterwegs. Doch an diesem Tag war alles anders: Die Männer trugen keine blauen Arbeitskittel, sondern graue Uniformen. Und sie gingen auch nicht in raschen Schritten zu ihrer Arbeitsstelle, sondern warteten ungeduldig und aufgeregt auf den Zug. Statt der Vespertasche mit Butterbroten und Blechflasche hatte jeder der Reservisten seinen Tornister auf den Rücken geschnallt.
Georg und Paul standen auf dem Bahnhofsvorplatz. Um sie herum bildeten sich Trauben grau Uniformierter, die auf den Zug nach Ulm warteten, unter ihnen August Bettinger und Alfred Bürk, umgeben von mindestens zehn seiner Turnkameraden. Sie hatten damit gerechnet, dass sie zu den Ersten gehören würden, die das Vaterland zu den Waffen rufen würde. Und sie hatten sich nicht getäuscht. Man hatte kein Prophet sein müssen, um den Lauf des Schicksals vorauszusehen.
Und man musste auch kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass der Kriegserklärung gegen Russland nur zu bald eine weitere gegen Frankreich folgen würde, den Bündnispartner des Zaren. Das Deutsche Reich hatte die Russen in einem Zwölf-Stunden-Ultimatum aufgefordert, deren Mobilmachung rückgängig zu machen. Diese hatten nicht darauf reagiert.
Paul verwunderte das nicht weiter. „Sei nicht traurig, Karoline, ich bin ja bald wieder da”, hatte er seine Frau beim Abschied getröstet. „Du musst jetzt nicht weinen. Es geht für uns wohl nach Westen, und mit dem Franzmann, da sind wir schnell fertig. Die Rothosen sind noch immer vor uns davongelaufen. Ich bring dir auch was Schönes mit.”
Dann hatten sie ihre Bündel gepackt und dem Häuschen in der Sedanstraße den Rücken gekehrt. Karoline hatte mit Fritz und Franz an der Hand zum Abschied gewinkt. Der kleine Franz hatte geweint. Fritz, der Ältere, hatte versucht, Abschied zu nehmen, wie es in seinen Augen echte Männer tun: „Papa, komm bald wieder heim zu uns. Und ihr müsst es den Franzosen zeigen, der Georg und du!”
„Es wird eine harte Zeit für sie werden”, hatte Georg gesagt. Paul war ihm eine Antwort schuldig geblieben.
„Sämtliche Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes einschließlich der Ersatzreservisten haben sich zu der auf den Kriegsbeorderungen angegebenen Zeit auf dem bezeichneten Orte pünktlich einzufinden. Dagegen verbleiben die nur mit einer Passnotiz Versehenen zunächst in der Heimat. Sämtliche Einberufenen haben, um ihren Stellungsort zu erreichen, freie Eisenbahnfahrt ohne Lösung einer Fahrkarte.” Die Anweisung auf dem Mobilmachungsbefehl war eindeutig gewesen, und der Truppentransport, so schien es Georg, war bestens organisiert. Wie von langer Hand vorbereitet, klappte alles wie am Schnürchen. Die Reichsbahn konnte funktionieren wie ein Uhrwerk, dachte Georg bei sich, vorausgesetzt, es wird vom Kriegsministerium aufgezogen.
„Schau mal, dort drüben!” Georg lenkte Pauls Aufmerksamkeit über die Gleise hinweg zu einem hölzernen Lagerschuppen. Dort stand ein Fuhrwerk mit zwei stattlichen Kaltblütern. Vier Männer rollten schwere Bierfässer.
„Ja, die verladen Bärenbier”, sagte Paul zu seinem Kameraden und fragte sich, was denn daran Besonderes sein sollte. „Wir müssen schließlich was trinken im Krieg. Oder willst du jeden Tag Wasser saufen?” Er grinste.
„Siehst du nicht?”, meinte Georg und hob die Stimme, „die laden die Bierfässer nicht etwa ab, die laden sie wieder auf die Fuhrwerke.”
Jetzt realisierte das auch Paul. „Verdammt, das gibt es doch gar nicht! – Diese Esel verladen das Bier gar nicht für uns in den Zug!”
„Also doch Wasser und Brot für uns!”, konstatierte Georg lakonisch.
In diesem Augenblick trat der Bahnhofsvorsteher auf den Bahnsteig, ein kleiner drahtiger Mann mit einem imposanten Schnauzer. Alois Wehler stammte aus Aulendorf, hatte aber seine Dienststelle am oberschwäbischen Eisenbahnknotenpunkt vor gut zehn Jahren verlassen, um hier in Schwenningen Stationsvorsteher zu werden. Eine schöne Position, die dem Dreiundvierzigjährigen einen akzeptablen Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie der Arbeiterstadt verschafft hatte.
Als verantwortlicher „Bahnle”, wie die Schwenninger sämtliche Bahnbediensteten titulierten, sah sich Wehler auf einer Ebene mit so angesehenen Leuten wie dem Ratsschreiber, dem Stadtpfarrer und dem Förster. Sogar die Fabrikanten behandelten ihn mit Hochachtung. Immer wieder genoss er es, wenn ein hochgestellter Industrieller bei ihm anrief und sich nach dem Verbleib dringend erwarteter Ersatzteile oder Metalllieferungen erkundigte.
„Ja, es dauert eben noch, mein Herr”, pflegte Alois Wehler in solchen Fällen freundlich, aber keineswegs unterwürfig in die Sprechmuschel zu sagen.
„Das darf doch nicht wahr sein. Ich brauche die Messingplatten unbedingt heute noch, oder ich muss meine Arbeiter nach Hause schicken”, hörte der Bahnhofsvorsteher dann sein Gegenüber am anderen Ende der Leitung sagen. Oft fragte er sich, ob er solche Sätze nun als Klage oder als Drohung auffassen sollte. Insgeheim freute sich der kleine Mann aber über solche Telefonate, zeigten sie ihm doch, wie wichtig die Bahn – und damit natürlich auch der Bahnhofsvorsteher – für die Schwenninger Fabrikanten waren.
Die Produktion der örtlichen Fabriken stieg Jahr für Jahr. Immer mehr Güter mussten seine Leute am Bahnhof abfertigen. Besonders an den Kohlelieferungen konnte man die Steigerungsraten erkennen. Die Dampfmaschinen wurden immer größer und brauchten immer mehr Brennstoff. Der Bahnhofsvorsteher wollte sich noch gar nicht vorstellen, wie das alles während des Krieges weitergehen sollte. Denn er kannte natürlich die geheimen Pläne, die für den Fall der Mobilmachung die Versorgung der Armee sicherstellen sollten.
Dazu gehörte, dass sämtliche nicht kriegswichtigen Lieferungen eingestellt werden mussten. Und das Bärenbier, mochte es den tapferen Kämpfern auch noch so gut schmecken, war nun eben mal nicht kriegswichtig.
In den letzten Wochen vor Kriegbeginn hatte er sich oft mit Retouren herumschlagen müssen. Die russischen Behörden hatten mehrere Lieferungen von Uhren wieder zurückgeschickt. Angeblich, weil diese nicht richtig verpackt gewesen waren und an den Kisten die nötigen Angaben gefehlt haben sollten. Wehler hatte dies damals schon für reine Schikane gehalten. Er hatte vermutet, dass sich das Zarenreich auf diese Weise unerwünschte Konkurrenz aus dem Ausland vom Hals halten wollte.
Die Fabrikanten hatten dies ebenso gesehen und waren abends beim Dämmerschoppen im „Kronprinzen” lauthals über die unverschämten Russen hergezogen. Dennoch hatte auch der Bahnhofsvorsteher einen Teil des Ärgers abbekommen, den die Willkür der Russen auslöste. Denn er war es, der sich jedes Mal die ungehobelten Schimpftiraden der Fabrikfuhrleute anhören musste, wenn diese wieder eine Retoure am Bahnhof abzuholen hatten.
Erst vor drei Tagen waren vier schwere Holzkisten mit Salonuhren der Firma Mauthe von der Zollstation der Russen zurückgesandt worden. Gerade noch rechtzeitig, denn jetzt würde die Bahn solche Lieferungen nicht mehr transportieren und sie stattdessen am nächstbesten Bahnhof aus dem Zug holen. Das Militär und seine Anforderungen hatten jetzt absoluten Vorrang. Männer und Material mussten bewegt werden. Und nicht Uhren. Längst lagen die Detailpläne für diese Situation in den Schubladen der Eisenbahnverwaltung bereit.
Bei den Verhandlungen zu Beginn des Jahres hatten sich die Vertreter der Industrie noch tüchtig gesträubt, der Armee derartige Zugeständnisse zu machen. Schließlich ging es ihnen ums Geschäft. Doch mit mehr oder weniger sanftem Druck hatte die Regierungsseite den Fabrikanten und Händlern deutlich gemacht, dass eine zügige und ungestörte Mobilmachung im Kriegsfall unbedingt im Sinne aller Deutschen sei.
Erst vor drei Tagen hatte Bahnhofsvorsteher Wehler von der Eisenbahndienststelle in Rottweil die genauen Anweisungen für den Mobilmachungsfall erhalten. Der so genannte „Terminkalender” war in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt worden. Dieser hatte nur auf ein bestimmtes Alarmwort hin von den zuständigen Bahnbeamten geöffnet werden dürfen.
Wehler wurde es ganz schummrig vor Augen, wenn er nur daran dachte, welch umfangreiche Aufgaben man auf seinem kleinen Bahnhof von ihm erwartete.
Die Lokomotiven durften sich nicht länger als unbedingt notwendig aufhalten, und Güterwagen mussten sofort entladen werden. Das Schlimmste war aber, dass er jene sechs Waggons, die er bisher als stille Reserve auf seinem hinteren Abstellgleis bereitgehalten hatte, nun ohne jeden Ersatz an die übergeordnete Dienststelle abgeben musste. Alois Wehler war auf sein Organisationstalent beinahe so stolz wie auf den prächtigen Bart, der unter seiner Nase prangte. Immer wieder war es ihm bisher gelungen, mit ein paar kleinen Tricks für seine Schwenninger Kundschaft doch noch eine Transportmöglichkeit zu schaffen. Bei den Kontoristen der Fabriken hatte er deshalb einen dicken Stein im Brett. So kam es schon vor, dass er auf ein Viertele Wein eingeladen wurde, wenn er nach Schichtende ins Gasthaus „Hecht” einkehrte.
Seine Miene verdüsterte sich: Mit solchen Wohltaten konnte er in nächster Zeit wohl nicht mehr rechnen. Es war vorbei mit spontanen Transporten für die Uhrenindustrie, die in einem zusätzlich angehängten Wehlerschen Reserve-Waggon hinter einem der regulären Güterzüge mitrollten. Damit würde er auf absehbare Zeit auf die „Dankesviertele” für seine aktive Wirtschaftsförderung verzichten müssen.
„Das ist jetzt eine Maßnahme des Prioritätenplans”, brummte er, da er bemerkt hatte, dass Georg und Paul ziemlich ratlos zum Lagerschuppen starrten – und auf das Bier, das nun ganz sicher andere trinken würden. Die beiden grau Uniformierten drehten sich um und blickten direkt in Wehlers kantiges Gesicht mit dem Riesenschnauzbart. Der kleine Mann genoss die Aufmerksamkeit und strich mit der flachen Hand über die vergoldeten Knöpfe seiner Eisenbahneruniform.
„Wegen der Mobilmachung werden zivile Gütertransporte eingestellt”, erklärte er den beiden Soldaten in amtlichem Tonfall. „Vorerst mal”, schränkte er dann ein. „Wir brauchen jeden Waggon für die Armee, für Waffen und Nachschub. Euer gutes Bärenbier muss jetzt also erst mal warten.”
Wehler grinste breit. Georg und Paul hörten den triumphierenden Klang in der Stimme des Wichtigtuers. Vor allem Georg konnte den „Bahnle” überhaupt nicht leiden: In ihm sah er einen Wicht, der sich in seiner Uniform größer machte, als er in Wirklichkeit war. Hinzu kam, dass er auch schlechte Erfahrungen mit dem Bahnhofsvorsteher gemacht hatte. Nie würde er vergessen, wie Wehler einmal den Zug vor seiner Nase hatte abfahren lassen. In voller Absicht.
Das war vor drei Jahren an einem Sonntagmorgen im Winter gewesen. Georg hatte Katharina besuchen wollen, die damals vorübergehend bei einer Tante in Lauffen gewohnt hatte. So hatte er sich zum Bahnhof aufgemacht. Doch es hatte gefroren über Nacht, und die Wege waren über und über mit dickem Eis bedeckt gewesen. Alois Wehler hatte ganz genau gesehen, wie Georg zur Abfahrtszeit des Zuges in Richtung Rottweil auf den Bahnsteig gerannt war, hatte aber nur breit gegrinst. Und dann kräftig in seine Pfeife geblasen.
Georg war rot vor Zorn gewesen, als die große schwarze Lokomotive davongedampft war. Doch er hatte es nicht gewagt, auf einen der anfahrenden Waggons aufzuspringen. Ganz bestimmt hätte ihm der kleine Bahnhofstyrann dann mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Beförderungsbestimmungen noch mehr zu schaffen gemacht.
Nun musste Georg schmunzeln, als ihm diese Episode in den Sinn kam. Es ist Krieg, und wir haben alle andere Sorgen, dachte er sich. Dennoch wollte er die Gunst der Stunde ausnutzen: Der kleine Pfeifenheini sollte ihn nicht so schnell vergessen, egal ob er nun aus diesem verdammten Krieg zurückkehren sollte oder nicht.
Er trat einen Schritt nach vorne und baute sich vor Wehler auf und zog das lange Bajonett aus der Lederscheide, die er am Gürtel trug. Er fuhr mit der geschärften Klinge unter einen der Goldknöpfe an Wehlers Jacke und trennte ihn mit einem schnellen Schnitt ab. Wehler war vor Entsetzen wie gelähmt und beobachtete fassungslos, wie sein Knopf über den Bahnsteig kullerte.
Georg ließ das Bajonett in die Scheide zurückgleiten. „Eines sag ich dir, du kleiner Drückeberger: Wenn du hier unser Bärenbier aussäufst, während wir an der Front sitzen, dann schneide ich dir alle deine anderen hübschen goldenen Uniformknöpfe ab und lasse sie dich einzeln aufessen.”