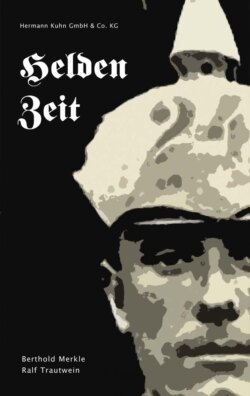Читать книгу Heldenzeit - Ralf Trautwein - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1 - GOTTVERTRAUEN
ОглавлениеWIEN, 19. Juni 1914, 9.00 Uhr. Franz Ferdinand lehnte sich zurück und lachte bitter. „Ja, Conrad, das würde Euch so passen.” Seine Stimme troff vor Ironie. Dann wurde sein Gesicht ernst. Er beugte sich, die Handflächen auf den Tisch gestützt, nach vorne und funkelte den alten Soldaten wütend an. „Merkt Euch eines: Ich lasse mich nicht unter einen Glassturz stellen! – In Lebensgefahr sind wir immer. Wir müssen nur auf Gott vertrauen, General!”
„Gottvertrauen hat noch keinem geschadet, Kaiserliche Hoheit”, entgegnete der Chef des Generalstabs lakonisch. Er wusste um das überschäumende Temperament des Erzherzogs, der sich auch ohne jedes Widerwort unvermittelt in Rage reden konnte, und schlug die Augen nieder. Franz Ferdinand galt als aufbrausend und übellaunig. Es brauchte nicht viel, um ihn zu provozieren.
Franz Conrad von Hötzendorf schreckte das freilich nicht in dem Maße wie die übrigen Minister und Militärs. Allerdings wünschte er sich in diesem Moment, er hätte noch denselben Einfluss auf den Thronfolger, wie er ihn vor einigen Jahren besessen hatte. Indem er den Kopf senkte, deutete er eine Verbeugung an. Einst war er einer der engsten Vertrauten Franz Ferdinands gewesen und dies sogar geblieben, nachdem ihn dessen Onkel, der Kaiser, entlassen hatte. Doch längst hörte der Thronerbe der Habsburger mehr auf andere Berater als auf den alten Kämpen.
Conrad von Hötzendorf war im persönlichen Umgang ausgesprochen konziliant. Das mochte der Grund sein, warum ihn der Thronfolger im Grunde noch immer gut leiden mochte. Als Soldat und Politiker freilich zog Conrad den direkten Weg vor. Von Diplomatie hielt er wenig. Ebenso wenig, wie der greise Franz Joseph von seinem angriffslustigen General hielt. Der Monarch war müde. Er wollte keinen Krieg mehr.
Beim alten Kaiser hatten Conrad und die anderen Falken in der Habsburgischen Regierung deshalb keinen leichten Stand. „Ich will Frieden, und Ihr seid ein elender Kriegstreiber”, hatte ihn der Alte außer sich vor Wut angebrüllt, sodass sein weißer Backenbart dabei gebebt hatte.
Erst als Berchtholds Vorgänger Aehrental, der ungarnfreundliche Quertreiber, das Zeitliche gesegnet hatte, hatte Franz Ferdinand erreichen können, dass ihn der Kaiser vor nun etwas mehr zwei Jahren doch zurückholte. Zum rechten Zeitpunkt, wie Conrad fand, denn die k. u. k.-Armee bedurfte mehr denn je einer harten Hand – ebenso wie eines größeren Wehretats natürlich.
Ach wäre ihm doch nur nicht dieser Redl dazwischengekommen! Dieser Lump! Ein hoher österreichischer Nachrichtenoffizier, der sich als Russen-Spion hergegeben hatte – war das eine Schande! Die Kugel, die sich der Oberst nach seiner Enttarnung in den Kopf gejagt hatte, war das Mindeste gewesen, hatte am Gang der Dinge aber nichts mehr zu ändern vermocht. Franz Joseph war außer sich gewesen, und auch beim Thronfolger hatte sich Hötzendorfs Stellung im Zuge der Affäre zusehends verschlechtert. Sie hatte sich nicht vertuschen lassen, obwohl Conrad von Hötzendorf alles dafür getan hatte: Der lange Schatten der Affäre um Oberst Redl war auch auf ihn gefallen.
Er unternahm einen neuen Versuch. „Eure Hoheit, eine Reise nach Sarajewo wäre nicht nur für Eure Person voller Risiko. Ich bitte zu bedenken: Auch Eure werte Frau Gemahlin könnte Schaden nehmen. Ihr wisst sehr gut: Ich habe den Serben noch nie über den Weg getraut, und ich habe meine guten Gründe dafür. Aber gerade jetzt dürfen wir die Warnungen, die wir bekommen haben, nicht einfach ignorieren.”
Jovan Jovanovic, der serbische Gesandte in Wien, hatte Finanzminister Leon Bilinski aufgesucht und ihm gegenüber Andeutungen gemacht, der Thronfolger könne, sollte er nach Bosnien reisen, in Gefahr geraten. Bilinski hatte sich daraufhin an den Grafen Berchthold gewandt. Berchthold wäre als Außenminister eigentlich erster Ansprechpartner des Gesandten gewesen, doch hielt er wenig von Jovanovic. Berchtold erinnerte sich sehr wohl daran, dass der Serbe nach der Annexion Bosniens durch die Habsburger zu jenen gehört hatte, die Unruhe schürten. Nicht von ungefähr galt Jovanovic als Kandidat der Schwarzen Hand für den Posten des serbischen Außenministers. Mehr als einmal hatte sich Berchthold um die Ablösung dieses feindseligen Diplomaten bemüht; wenn auch vergeblich.
„Schweigt, Conrad.” Franz Ferdinand wischte die Bedenken seines Generals mit einer gebieterischen Handbewegung zur Seite. „Wäre es nach Euch gegangen, so stünden wir schon längst vor Belgrad, wie seinerzeit die Türken vor Wien standen! In nur wenigen Punkten bin ich mir mit meinem Onkel, dem Kaiser, einig. Einer davon ist allerdings die Prämisse, mit den Serben – und damit mit den Russen – keinen Händel anzufangen.”
Conrad von Hötzendorf war kein Zauderer. Ganz gewiss nicht. Entschlusskraft, Tatendrang und unbeugsamer Willen – das waren die Tugenden, die aus seiner Sicht einen Offizier auszeichneten. Am liebsten hätte er schon vor Jahren einen Präventivkrieg gegen die Serben geführt. Der slawische Nationalismus war dem alten General seit jeher ein Dorn im Auge. Den Serben, den Russen und selbst den verbündeten Italienern begegnete er mit Misstrauen. Fünf Jahre war es nun her, dass er Kaiser und Erzherzog fast so weit gehabt hatte, Serbien der Donaumonarchie einzuverleiben. Dass Franz Joseph zumindest kurzzeitig erwogen hatte, diesen Plänen Conrads zu folgen, war freilich nur der damaligen innenpolitischen Lage zuzuschreiben gewesen. Heute sah alles wieder anders aus.
Er ballte die Fäuste. „Mit Verlaub, Majestät – es hätte unserer Monarchie nicht geschadet. Im Gegenteil ...”
„Mein lieber General, ich will nichts mehr davon hören.” Stürgkh und von Krobatin schauten ernst drein. Leon Bilinski hatte eine Leichenbittermiene aufgesetzt. Er fürchtete die Tobsuchtsanfälle des Erzherzogs nicht minder als die meisten anderen Kabinettsmitglieder, und nach Möglichkeit vermied er es, sich den Zorn des künftigen Kaisers zuzuziehen.
„Eure Kaiserliche Hoheit, Ihre Courage wissen wir wohl zu schätzen ...”, begann Karl Stürgkh.
„Jetzt fängt unser Herr Ministerpräsident auch noch zu jammern an”, unterbrach ihn der Erzherzog. „Unser Statthalter Potiorek sitzt nun schon eine ganze Zeit im Konak, meine Herren, und er hat mir berichtet, die Stadt sei sicher. Ärger machen da unten nur ein paar slawische Rotzbuben. Er sagt, die Bosnier erwarten ihren Herrscher. Sie wollen ihren Monarchen erleben, um sich endlich zu besinnen, wohin sie gehören.”
Er legte die Stirn in Falten und schaute in Leopold Graf Berchtolds Richtung. „Uns was meint unser Herr Außenminister?”
Berchtold räusperte sich. „Nun, Kaiserliche Hoheit, ich möchte mich den allgemeinen Bedenken der Herren Kollegen anschließen. Unsere Quellen sind verlässlich, meine ich. Sehr verlässlich, möchte ich sagen. Jovanic ist zwar ein lästiger Aufwiegler. Aber er verfügt – lassen Sie es mich so sagen – über gewisse Beziehungen. Und ich möchte überdies zu bedenken geben, dass die Serben Ihren Besuch in Bosnien auch als Provokation werten könnten.”
„Provokation! Ha!”, rief der Erzherzog empört. „Das ist doch blanker Unsinn! Was redet Ihr da? Wen soll ich provozieren? Ich will niemanden provozieren, auch Belgrad nicht. Das wissen Sie ganz genau, das weiß unser Generalstabschef, und die Serben wissen es auch. Deren Land ist mir völlig egal! Was sollte ich denn mit diesem Serbien überhaupt anfangen?”
Franz Ferdinand hielt einen Augenblick inne, bevor er weitersprach. Er spürte, wie ihn die Wut packte. Die Spannung im Raum stieg. „Gütiger Gott, behüte uns davor, dass wir jemals Serbien annektieren, wie wir es mit Bosnien getan haben! Das war der Alte, der uns Bosnien einverleibt hat! – Was sollte ich wohl mit einem total verschuldeten Land voller Königsmörder und Spitzbuben wollen? Merkt Euch, Conrad: Die Politik, zuzuschauen, wie sich die anderen die Schädel einhauen, ist auf dem Balkan die richtige Politik in diesen Zeiten! Auch wenn Ihr das wahrscheinlich nie begreifen wollt!”
Franz Conrad von Hötzendorf ahnte, warum sich der Thronfolger nicht von seiner Bosnienreise abbringen ließ. Franz Ferdinand wollte offenbar ein Zeichen setzen, sah er in den Slawen doch ein Gegengewicht zu den Ungarn. Er beabsichtigte ganz offensichtlich, wäre er erst einmal Kaiser, sie zur dritten Staatsnation der Habsburger Monarchie zu erheben. Damit würde er, da war sich Conrad mit Außenminister Berchthold einig, den slawischen Nationalisten, hinter denen fraglos russische Interessen standen, den Wind aus den Segeln nehmen. Eine elegante Lösung, musste Conrad zugeben. Wenn die Nationalistenbrut das allerdings genauso sah, und wenn an Jovanovics Warnungen tatsächlich etwas dran war, würde das Leben des Thronfolgers bei einem Besuch in Bosnien durchaus ernsthaft in Gefahr geraten können.
Der alte General seufzte. „Kaiserliche Hoheit, keiner weiß besser als ich, dass Ihr niemanden provozieren wollt.” Er ließ seine Worte für einen Augenblick im Raum stehen. „Ich wünsche Euch Glück. Gott schütze Euch auf dieser Reise!”