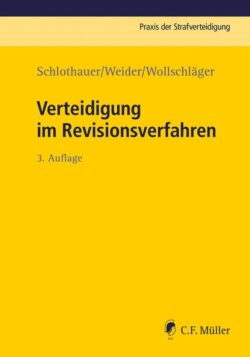Читать книгу Verteidigung im Revisionsverfahren - Reinhold Schlothauer - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTeil I Allgemeine Grundsätze des Revisionsverfahrens › VII. Zur „Psychologie“ des Revisionsverfahrens
VII. Zur „Psychologie“ des Revisionsverfahrens
Teil I Allgemeine Grundsätze des Revisionsverfahrens › VII. Zur „Psychologie“ des Revisionsverfahrens › 1. Vorbemerkung
1. Vorbemerkung
76
Der Revisionsführer muss sich immer vor Augen halten, dass der Tatrichter bei dem Revisionsrichter einen Vertrauensvorschuss genießt. Das Revisionsgericht geht zunächst davon aus, dass der Kollege in der Tatsacheninstanz fair und fehlerfrei verhandelt und das Urteil hinsichtlich Schuld und Rechtsfolgenausspruch sorgfältig beraten hat. Diesem „Vorurteil“ kann nur dadurch begegnet werden, dass die Revisionsbegründung (gravierende) Rechtsfehler präzise herausarbeitet. „Lässliche Sünden“ des Tatrichters verzeiht das Revisionsgericht oftmals, indem ein Beruhen des Urteils auf dem Rechtsfehler ausgeschlossen wird.
Trotz allen Glaubens an die Zuverlässigkeit der Arbeit der Tatrichter wird die Sorgfalt revisionsrichterlicher Kontrolle aber daran deutlich, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Urteilsaufhebungen auf die allgemeine Sachrüge erfolgt, also ohne ausgearbeitete Revisionsbegründung.
Teil I Allgemeine Grundsätze des Revisionsverfahrens › VII. Zur „Psychologie“ des Revisionsverfahrens › 2. Aufbau der Revisionsbegründung
2. Aufbau der Revisionsbegründung
77
Einem scherzhaften Bonmot zufolge sollte die Begründungsschrift so abgefasst sein, dass der Berichterstatter den Text bei einem guten Glas Rotwein im Ohrensessel lesen kann und dabei nicht einschläft bzw. die Ausführungen wie ein gutes Buch verschlingt.
Es empfiehlt sich daher, den Leser durch den Text zu führen.
Überschriften für die einzelnen Rügen und eine ordentliche Gliederung sollten selbstverständlich sein.
Auch sollte den jeweiligen Einzelbeanstandungen eine kurze einleitende Bemerkung vorangestellt werden, aus der ersichtlich wird, was Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen ist.
Gerügt wird die Verletzung formellen und materiellen Rechts. Die Sachrüge wird allgemein erhoben.
I. Rüge der Verletzung formellen Rechts
| 1. | Verletzung von §§ 52, 252 StPO Die nachfolgende Rüge betrifft die fehlerhafte Verwertung der ermittlungsrichterlichen Vernehmung der Zeugin A. wegen unterlassener Belehrung über ihr Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 52 Abs. 3 StPO. a) Verfahrenstatsachen … b) Rechtliche Bewertung … c) Beruhen … |
II. Rüge der Verletzung sachlichen Rechts
Die bereits erhobene allgemeine Sachrüge wird durch folgende Einzelausführungen ergänzt:
| 1. | Lückenhafte Beweiswürdigung im Zusammenhang mit der Würdigung der Angaben des Belastungszeugen B. |
| 2. | Fehlerhafte Strafzumessung a) Verstoß gegen das Doppelverwertungsverbot des § 46 Abs. 3 StGB … b) Fehlerhafte Ablehnung der Strafaussetzung zur Bewährung. … |
78
Bei Rechtsausführungen sollte die in der Revision vertretene Auffassung mit Nachweisen aus Rechtsprechung und Literatur gestützt werden.
Sofern auf Rechtsprechung verwiesen wird, ist es angebracht, zunächst Judikate des erkennenden Senats zu zitieren („ so schon erkennender Senat in …“). Dahinter verbirgt sich die Hoffnung, dass der Senat sich mit seiner eigenen Rechtsprechung auseinandersetzen muss und wohl nicht „ohne Not“ davon abweichen wird.
79
Grundsätzlich bedarf es keiner Ausführungen zur Beruhensfrage, also ob ein kausaler Zusammenhang zwischen dem gerügten Rechtsfehler und dem angefochtenen Urteil besteht.[1] Es ist Aufgabe des Revisionsgerichts, die Beruhensfrage von sich aus zu prüfen.[2] Vorsicht ist jedoch geboten. Gerade bei gerügten Verfahrensverstößen prüft das Revisionsgericht, ob sich bei rechtsfehlerfreiem Vorgehen des Gerichts der Angeklagte anders als geschehen hätte verteidigen können. Da Revisionsrichter keine Verteidiger sind, kann es trotz aller Sorgfalt bei der revisionsgerichtlichen Prüfung sein, dass für einen Verteidiger wegen seiner rollenspezifischen anderen Sichtweise sehr wohl andere und weitere Verteidigungsaktivitäten möglich gewesen wären.[3] Das Fehlen von Ausführungen zur Beruhensfrage wird daher vom Revisionsgericht nicht selten zum Anlass genommen, darauf hinzuweisen, dass auch dem Verteidigungsvorbringen nichts zu entnehmen ist, was das negative Ergebnis der Beruhensprüfung in Frage stellen könnte.[4]
Teil I Allgemeine Grundsätze des Revisionsverfahrens › VII. Zur „Psychologie“ des Revisionsverfahrens › 3. Schrot- oder Blattschuss?
3. Schrot- oder Blattschuss?
80
Der mit der Revisionsbegründung beauftragte Verteidiger steht immer wieder vor dem Problem, welche der gefundenen und möglichen formellen und materiellen Rechtsfehler er rügen soll: alle oder nur eine Auswahl der am erfolgversprechendsten.
Auch hier wird gescherzt, dass der Revisionsrichter mehr als 10 Seiten Revisionsbegründung nicht liest.
Zunächst muss man sich den Arbeitsaufwand des Revisionsrichters vor Augen halten. Der Jahreseingang pro Strafsenat des BGH liegt bei ca. 600 Revisionen. Dies bedeutet, dass der/die Vorsitzende 600 Urteile zu lesen hat, die einen nicht unerheblichen Umfang haben. Hinzu kommen eine nicht unbeträchtliche Zahl von Revisionsbegründungen sowie die Anträge des Generalbundesanwalts. Allein diese Lektüre ist ein Kraftakt, so dass der Hinweis an den Revisionsführer nachvollziehbar erscheint, „weniger wäre mehr gewesen“.
Dies alles kann und darf den Revisionsführer nicht davon abhalten, die von ihm für erforderlich gehaltenen Rügen zu erheben. Allerdings sollte er in Erwägung ziehen, nach gründlicher Prüfung nur die Rügen zu erheben, die nach seiner Auffassung erfolgversprechend sind und von solchen absehen, deren Erfolg eher unwahrscheinlich ist. Allerdings gibt es auch hier warnende Beispiele:
Der Verteidiger eines Angeklagten erhebt eine Verfahrensrüge wegen zweifelhafter Erfolgsaussicht nicht, der Verteidiger des Mitangeklagten erhebt sie. Diese Rüge führt zur Aufhebung des Urteils gegen diesen Angeklagten, die Revision des anderen Angeklagten wird verworfen.
Die Entscheidung, welche Verfahrensrügen erhoben werden und welche Ausführungen zur Begründung der Sachrüge gemacht werden, muss letztlich der Verteidiger in jedem Einzelfall auf der Grundlage der Besonderheit seines Verfahrens treffen. Eine generalisierende Empfehlung ist deshalb unangebracht.
Teil I Allgemeine Grundsätze des Revisionsverfahrens › VII. Zur „Psychologie“ des Revisionsverfahrens › 4. Berufung oder Sprungrevision?
4. Berufung oder Sprungrevision?
81
Die Wahl des Rechtsmittels gegen ein amtsgerichtliches Urteil ist nicht leicht. Die Berufung eröffnet dem Beschwerdeführer eine neue Tatsacheninstanz u.a. mit der Möglichkeit, neue Beweismittel einzubringen. Die Revision führt zwar lediglich zur Überprüfung des Urteils auf materielle Rechtsfehler und im Falle der Erhebung von Verfahrensrügen auch auf die bezeichneten formellen Fehler, aber im Falle der Urteilsaufhebung hat der Beschwerdeführer im Falle erneuter Verurteilung erneut zwei Instanzen.
Da der Verteidiger in aller Regel den Ausgang eines Revisionsverfahrens nicht zuverlässig vorhersagen kann, birgt die Sprungrevision die Gefahr in sich (Beruhensfrage, Anforderungen an den Vortrag bei Verfahrensrügen), dass bei ihrem Scheitern das Verfahren rechtskräftig beendet ist. Es ist deshalb eine sorgfältige Prüfung und Zurückhaltung geboten. Die Sprungrevision sollte auf Fälle beschränkt werden, in denen sich der Verteidiger seines Erfolgs „bombensicher“ ist oder es um strittige Rechtsfragen mit der Folge geht, dass gegen ein dem Angeklagten günstiges Berufungsurteil von der Staatsanwaltschaft ohnehin Revision eingelegt würde.