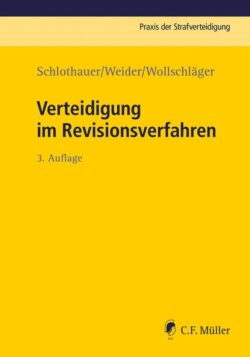Читать книгу Verteidigung im Revisionsverfahren - Reinhold Schlothauer - Страница 61
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Rechtsgrundlagen
Оглавление125
Die Verjährungsproblematik ist so umfangreich und vielfältig, dass sie hier nur bruchstückhaft behandelt werden kann.
Das Verfahrenshindernis der Verjährung prüft das Revisionsgericht von Amts wegen. Die Überprüfung erfolgt im Freibeweisverfahren ohne Bindung an die Feststellungen des Urteils.
Gleichwohl empfiehlt es sich, das Verfahrenshindernis der Verjährung zum Gegenstand einer (Verfahrens-)Rüge zu machen.
Die schlichte Überschreitung der Verjährungsfrist kann das Revisionsgericht bereits auf Grund der allgemeinen Sachrüge überprüfen, da sich der Zeitpunkt der Tat bzw. derjenige ihrer Beendigung[8] aus dem Urteil ergibt.
126
Schwierigkeiten kann es jedoch dann geben, wenn das Ruhen der Verjährung nach § 78b StGB oder die Unterbrechung nach § 78c StGB zu prüfen ist. Oftmals werden sich die dafür notwendigen Details aus den Urteilsgründen nicht ergeben. Dafür sind die einzelnen Unterbrechungshandlungen, die in der Akte dokumentiert sind, heranzuziehen.
127
Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits zweifelhaft ist, ob sich eine Unterbrechungshandlung nach § 78c Abs. 1 StGB auf den verurteilten Angeklagten bezogen hat. Denn nach § 78c Abs. 4 StGB wirkt die Unterbrechung nur gegenüber demjenigen, auf den sich die Handlung bezogen hat. Deswegen ist es erforderlich, dass sich die Unterbrechungshandlung auf eine bestimmte Person, d.h. einen bereits bekannten Tatverdächtigen bezogen hat, der individuell bestimmbar ist. Eine Verfolgung gegen „unbekannt“ reicht nicht.[9] Richtet sich z.B. ein Durchsuchungsbeschluss nicht (auch) gegen den Angeklagten, unterbricht der Beschluss die Verjährung gegen den Angeklagten nicht.
128
Bei mehreren Verdächtigen wirkt eine Handlung nur gegenüber demjenigen, gegen den sie sich richtet, auch wenn die Untersuchungshandlung zugleich auch der Sachaufklärung in Richtung dieses anderen dienen soll.[10]
129
Die Unterbrechungshandlung muss sich auch auf eine bestimmte Tat beziehen.[11]
Der Verfolgungswille der Strafverfolgungsbehörden ist danach das entscheidende Kriterium für die sachliche Reichweite der Unterbrechungswirkung.[12] Für die Bestimmung des Verfolgungswillens der Strafverfolgungsorgane ist maßgeblich, was mit der jeweiligen richterlichen Handlung bezweckt wird. Dabei sind neben dem Wortlaut der Verfügung auch der Sach- und Verfahrenszusammenhang entscheidend.[13] Sofern sich die Reichweite nicht aus der Handlung selbst ergibt, ist der sonstige Akteninhalt zur Auslegung heranzuziehen.[14] Bleiben dann immer noch Zweifel, ist davon auszugehen, dass die betreffende richterliche Handlung die Verjährung nicht unterbrochen hat.[15]
130
Bei mehreren Tatvorwürfen oder Serienstraftaten erstreckt sich die Unterbrechungswirkung von Untersuchungshandlungen grundsätzlich auf alle verfahrensgegenständlichen Taten, wenn in einem Verfahren wegen mehrerer Taten im prozessualen Sinn ermittelt wird. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn der Verfolgungswille des tätig werdenden Strafverfolgungsorgans erkennbar auf eine oder nur einzelne Taten beschränkt ist.[16]
131
Prozessuale Fehlerhaftigkeit einer der in § 78c Abs. 1 StGB genannten Maßnahmen schließt die Unterbrechungswirkung nicht aus, sofern die Mängel nicht so schwerwiegend sind, dass sie zur Unwirksamkeit führen.[17]
132
Der Katalog der Unterbrechungshandlungen des § 78c Abs. 1 StGB ist abschließend.[18] Die Anordnung einer TKÜ unterbricht daher nicht die Verjährung, weil darauf § 78c Abs. 1 Nr. 4 StGB nicht analog anzuwenden ist.[19]