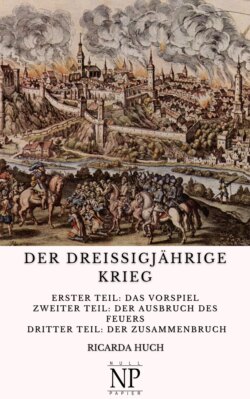Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
16.
ОглавлениеMaximilian von Bayern führte mit Wolfgang Wilhelm von Neuburg viele Gespräche über den Glauben, wobei er alles das wiederholte, was er von den Jesuiten über die Wahrheit des katholischen Bekenntnisses gelernt hatte, während Wolfgang Wilhelm die lutherische Lehre so verteidigte, wie es ihm von Heilbrunner, dem Hofprediger seines Vaters, beigebracht worden war. Dabei gebot ihm der Umstand, dass Maximilian der Ältere war, eine gewisse Bescheidenheit, sodass dieser den Eindruck gewann, sein Schüler werde sachte von der Kraft seiner Beweisführung durchdrungen, und er müsse nur eine Weile zuwarten, um die Früchte seines Eifers zu ernten. Ohne dass etwas Entscheidendes geschehen wäre, reiste Wolfgang Wilhelm wieder ab. Magdalenas bewundernde und fast verliebte Blicke hatten ihm zwar wohlgetan, und obwohl sie blass und kränklich aussah, hatte sie ihm nicht übel gefallen, da sie klug und kräftig von Charakter zu sein schien; aber er konnte das argwöhnische Gefühl nicht loswerden, als sähen sie im Grunde alle ein wenig auf ihn herab, und das verstimmte ihn, wenn es ihn auch zugleich reizte und anzog. Dachte er an seinen Vater, so wurde ihm sehr unbehaglich zumute, und er verfolgte den Gedanken an die bayrische Heirat und alles, was damit zusammenhing, nicht weiter. Zu Hause jedoch gefiel es ihm gar nicht; stets kam es zu Wortwechseln zwischen ihm und seiner Familie, wie sehr er sich auch nach seiner Meinung bemühte, nicht merken zu lassen, dass sein Gesichtskreis sich inzwischen erweitert hatte. In seiner zweifelnden Stimmung beschloss er, sich am Hofe zu Berlin umzusehen, ob sich etwa dort eine Aussicht böte, die ihm Bayern entbehrlich machte. Der Kurfürst von Brandenburg näherte sich dem Plan einer ehelichen Verbindung seiner Tochter mit dem Neuburger behutsam; denn da er sich mit der Absicht trug, öffentlich zum reformierten Glauben überzutreten, wäre ihm eine kalvinische Heirat lieber gewesen. Immerhin wurde ein festliches Essen veranstaltet, wobei sich eine engere Vertraulichkeit entfalten und die Verlobung eingeleitet werden sollte. Die Prinzessin war ein wenig schnippisch und kicherte, anstatt des Freiers Anreden schicklieh zu beantworten; dazu kam, dass die Überheblichkeit, der er hier begegnete, ihn weit mehr ärgerte als die am Münchner Hofe, wo denn doch weit mehr Anstand, Pracht und fürstliches Wesen herrschte. Er gab also zu verstehen, dass er die brandenburgischen Ansprüche an Jülich-Cleve nicht hoch anschlug und voraussetzte, der Kurfürst werde es wohl zufrieden sein, sie mit der Tochter an ihn, als den eigentlichen Erben, abzutreten. Darüber brauste der Kurfürst seinerseits auf und sagte, dass Wolfgang Wilhelms Mutter sich eigentlich durch einen Verzicht ihres Anteils an der Erbschaft begeben habe, nun wolle er das Ganze und seine Tochter noch dazu, die von polnischer, schwedischer und dänischer Seite her Anträge habe und außerdem gar nicht von Berlin fort wolle. Die Prinzessin, sagte Wolfgang Wilhelm, dürfe es sich bei ihm gefallen lassen; in Düsseldorf sei guter Wein und in Neuburg gutes Bier, während in Berlin nicht einmal das Wasser gut sei. Diese Keckheit erzürnte den Kurfürsten so, dass er, ohnehin vom Trunk erhitzt, dem neuburgischen Prinzen eine Ohrfeige versetzte, womit das Gastmahl und die Werbung ein plötzliches Ende nahmen.
Mit dem Gefühl der Rachsucht verließ Wolfgang Wilhelm Berlin und reiste schnurstracks nach München, entschlossen, sich nunmehr Maximilian in die Arme zu werfen. Der katholischen Glaubenslehre, die ihm namentlich von dem gelehrten Jesuiten Reihing einleuchtend unterbreitet wurde, lauschte er bereitwilliger als früher, und nachdem er den Unterricht eine Zeit lang genossen hatte, erklärte er sich für überzeugt und von dem Wunsche beseelt, in den Schoß der Kirche zurückzukehren. Seine den Vater betreffenden Bedenken verstand Maximilian und verschmähte es, ihn in dieser Hinsicht zu drängen. Er möchte, schlug er vor, so schnell wie möglich den Übertritt vollziehen, weil in einer so hochwichtigen Heilsangelegenheit auch nicht ein Tag versäumt werden dürfe; aber im geheimen, damit sein Vater es nicht erfahre. Diesen solle er zunächst mit der Heirat zu befreunden suchen, was leichter gelingen werde, wenn der Gedanke an einen etwaigen Religionswechsel seines Sohnes noch gar nicht bei ihm aufgetaucht sei.
Dementsprechend verfuhr Wolfgang Wilhelm und malte dem alten Herzog aus, welche Hilfe er von dem mächtigen bayrischen Vetter haben werde, um seinen Anspruch auf Jülich durchzusetzen, wozu noch die Aussicht komme, Magdalena werde sich zum lutherischen Glauben bekehren lassen. Er schilderte die Prinzessin als verständig und tugendhaft, sodass er, wenn sie erst seine Frau sei, sie gewiss zur Einsicht des Besseren bringen und sie seinem Wunsche sich fügen werde. Hatte Philipp Ludwig geschwankt, ob er in die gefährliche Heirat willigen sollte, so wurde er durch die Aussicht auf diese Möglichkeit zu ihren Gunsten bewegt, und eine väterliche Neigung für das Mädchen, das er und sein treuer Heilbrunner mit der reinen Religion bekannt machen würden, ergriff sein Herz; nun erst fing er auch an den irdischen Vorteilen der Verbindung Geschmack zu gewinnen an. Vor der Hochzeit freilich, sagte Wolfgang Wilhelm, müssten die Bekehrungsversuche anständigerweise zurückgehalten werden, und es wurde festgesetzt, dass die Vermählung sowohl nach katholischem wie nach evangelischem Gebrauch vollzogen werde, damit der Glaube beider Teile zur Geltung komme und keinem von beiden ein Präjudiz geschehe.
Vorher unternahm Magdalena mit ihrem Vater eine Wallfahrt nach Altötting, um Gott zu danken, dessen weise Führung sie nun erst recht bewundern lernte; denn es zeigte sich ja, was er damit bezweckt hatte, dass er das Opfer ihrer Liebe zu Leopold von ihr forderte, weil er ihr ein weit schöneres Glück und dazu eine erhabene Aufgabe vorbereitet hatte. Auch der alte Herzog von Neuburg wiegte sich in Hoffnungen, die nur zuweilen durch aufsteigende Sorgen getrübt wurden. Eine Sicherheit hatte ihm Wolfgang Wilhelm für die künftige Bekehrung seiner Braut nicht gegeben; konnte der junge Mann nicht durch weibliche Künste und die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur sich haben verblenden lassen, dass er eine der Abgötterei verschworene Jesabel für ein frommes, verständiges Mädchen ansah? Wenn sie sich ihm widersetzte, welche Unzuträglichkeiten würden daraus entstehen, namentlich in Bezug auf die Kinder, die aus der Ehe erzielt werden würden; es war ja leider nicht anders, als dass die Frauen, und namentlich solche, die mit jesuitischen Kniffen umzugehen gewohnt waren, oft den Mann umgarnten, und er würde nicht immer da sein, um Wolfgang Wilhelm durch sein väterliches Ansehen zu stärken. Indessen suchte er solche Gedanken durch sein Vertrauen auf Gott zu bekämpfen, der die Wahrheit nicht zuschanden werden lassen würde.
Nachdem die Hochzeit in München mit großer Pracht begangen war, richtete Philipp Ludwig eine Nachfeier in Neuburg zu, die Kosten nicht scheuend, um dem bayrischen Gepränge nicht nachzustehen, wie denn weder ein Turnier noch ein Feuerwerk, noch auch eine Sauhatz fehlte. In der ersten Nacht brach aber nicht weit vom Schlosse eine große Feuersbrunst aus, die sich so gefährlich anließ, dass der alte Herzog seinen Sohn, der sich eben mit seiner jungen Frau zu Bette begeben wollte, herausklopfte, damit er sich auch wie die anderen Herren am Lösch- und Rettungswerk beteilige. Hier tat sich namentlich Prinz August, Wolfgang Wilhelms jüngerer Bruder, rühmlich hervor, und man sah mit großer Bewunderung seinen hochgewachsenen Körper und sein blondes Haupt unerschrocken zwischen Rauch und Flammen auf- und untertauchen. Philipp Ludwig und seine zur Schwermut neigende Frau standen unterdessen im Schlosse am Fenster, wo sie durch die kahlen Gebüsche, denn es war November, die schwarzen Donauwellen im düsteren Glutschein aufblinken sehen konnten, und beteten nicht ohne trübe Vorahnungen.
Von Neuburg führte Wolfgang Wilhelm seine Frau nach Düsseldorf und hätte sich der neuen Würde uneingeschränkt freuen können, wenn sein Beichtvater ihn nicht gedrängt hätte, nunmehr seine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche offen zu bekennen, weil dies zum Heil seiner Untertanen, die sich ihm anschließen würden und müssten, notwendig sei. Wolfgang Wilhelm wagte keinen Gegengrund zu äußern und ordnete, da es einmal sein musste, die Zeremonie festlich an, damit das vorauszusehende Murren des Volkes durch einen bedeutenden Eindruck überwältigt werde.
An den Hof von Neuburg waren zuweilen Gerüchte von einer großen Veränderung gedrungen, die in Düsseldorf im Schwange sei; aber Philipp Ludwig hatte es nicht laut werden lassen und sich einzureden gesucht, dass ein solcher Verrat seines Sohnes unmöglich sei. Endlich ließ er den Heilbrunner zu sich rufen und fragte ihn, indem er ihn scharf ansah, ob er glaube, dass Wolfgang Wilhelm seinen Gott und seinen Vater zugleich verraten habe? Heilbrunner schwieg eine Weile mit niedergeschlagenen Augen; dann sagte er: »Weil Euer Gnaden es mir befehlen, so will ich antworten. Ich habe mich lange gesträubt, es zu glauben, und mit Gott deswegen gestritten. Abraham hat Isaak unschuldig geopfert und David Absalom schuldig, und beide waren treue Knechte Gottes. Wir müssen kämpfen und ausharren bis ans Ende: das von Euer Gnaden und meines sind nicht mehr fern.« Hierauf setzte sich Philipp Ludwig an seinen Schreibtisch und forderte von seinem Sohne eine runde, offene Erklärung, die denn auch erfolgte. Wolfgang Wilhelm und Magdalena schrieben zusammen in höflichen, entschiedenen Worten, dass es so sei und nicht anders sein könne und dass sie hofften, der Vater werde es ihm, Wolfgang Wilhelm, nicht verargen, dass er nach seiner Überzeugung gehandelt habe.
Das Blatt zitterte in den Händen des alten Mannes, während er las, und die Tränen begannen ihm langsam über das Gesicht zu laufen. Sein Herz war so hart geschlagen, dass er nicht einmal in der Bibel Trost finden konnte. Nicht nur der Abfall seines Sohnes war es, der ihn bekümmerte, sondern der Gedanke an die bitteren Folgen, die für seine armen Untertanen daraus erwachsen mussten, wenn der Abtrünnige ihnen seinen Irrglauben aufzwingen würde. Viele Stunden verbrachte er in leisem Gespräch mit seiner Frau, lange saß er aber auch allein, von einem drohenden Schwall teuflischer Zweifel geängstigt. Warum ließ Gott es zu, dass die Arbeit seines Lebens zunichte gemacht werde, sein Gärtlein, in dem er das Unkraut des Unglaubens und des Lasters ausgejätet, wo er Frömmigkeit, Ordnung und Tugend gesät und aufgehen gesehen hatte, von seinem eigenen Sohne verwüstet wurde? Er hatte geglaubt, der Segen Gottes ruhe auf seinem Tagewerk, und nun sollte sein brechendes Auge es scheitern sehen. War es eine ihm auferlegte Prüfung, wie konnte Gott den Verlust so vieler Seelen damit verbinden?
Den ernstlichen Vorstellungen Heilbrunners, man müsse sich dem Verhängnis Gottes auch dann unterwerfen, wenn man es nach seinem schwachen menschlichen Verstande nicht begreife, fügte er sich, insofern er nicht laut klagte; anstatt dessen beschäftigte er sich in großer Unruhe damit, das Unheil, so viel an ihm war, von seinem Lande abzuwenden. Nachdem er dem Sohne in ernsten Worten sein Unrecht vorgehalten hatte, forderte er von ihm ein bündiges Versprechen, in seinem väterlichen Erblande die Augsburgische Konfession nicht antasten noch ausländische Beamte dort einführen zu wollen, welches Wolfgang Wilhelm nach langem Zögern auch gab, dabei die Unverbrüchlichkeit eines Fürstenwortes betonend. Dann band er seinem zweiten und seinem dritten Sohne, August und Johann Friedrich, aufs Herz, dem reinen Glauben, in dem sie auferzogen wären, unerschütterlich anzuhangen, sich durch keinen irdischen Vorteil, Bedrohung oder Verlockung abwendig machen zu lassen, auch stets für ihre Untertanen, wenn diese etwa trotz aller Verträge von Wolfgang Wilhelm bedrängt werden sollten, väterlich zu sorgen und einzuspringen, da Gott die Seelen der Untertanen von den Fürsten fordern werde. Augusts aufrichtiger Blick und treues Wort beruhigten ihn über dessen Zukunft, für den schwachen und etwas vergnügungssüchtigen Johann Friedrich dagegen musste der ältere Bruder die Verantwortung mit übernehmen. Heilbrunner und die übrigen Geistlichen erhielten den Auftrag, an jedem Sonntag die Gemeinde auf die bevorstehende Gefahr aufmerksam zu machen und sie zur Glaubenstreue zu vermahnen. Es herrschte im ganzen Ländchen Betrübnis und Sorge, und aus freien Stücken beteten alle täglich, Gott möge ihren frommen Fürsten erhalten und das Übel von ihnen abwenden.
Nichtsdestoweniger ging das Leben des schon lange gichtleidenden alten Fürsten schnell zur Neige. Er änderte nichts in seiner Lebensführung, stand in der Morgenfrühe auf, aß zur Mittagszeit seinen Brei, obwohl er ihm fast zuwider war, arbeitete mit seinen Räten und las zur bestimmten Stunde in der Bibel; aber seine Angehörigen sahen ihn oft mitten in der Beschäftigung einschlafen oder leer vor sich hin stieren, während ihm Tränen aus den Augen schlichen. In den ersten Tagen des August ließ er die Frömmsten und Redlichsten aus der Bürgerschaft, wie die Prediger sie vorschlugen, zu sich auf das Schloss fordern, um ihnen Maßregeln für ihr Verhalten nach seinem Tode zu geben. Sie würden nun bald, redete er sie an, eine Herde ohne Hirten sein und könnten leicht den Wölfen, die jederzeit umgingen, zur Beute fallen. Zwar würden seine Söhne ihnen fürstlich und getreulich vorstehen, und Heilbrunner würde ihnen nach wie vor Gottes Wort auslegen und sie zum Guten anhalten, aber sie wüssten jawohl auch, wie böse die Zeitläufte wären, welche Macht der Teufel auf Erden besäße und wie weit der päpstliche Antichrist seine Schlingen würfe. Da müssten sie denn auch selbst mit Beständigkeit gewappnet sein, wenn sie die Prüfung bestehen und dereinst den Himmel gewinnen wollten. Danach fragte er viele von ihnen einzeln, wie sie sich verhalten würden, wenn sie mit Gewalt zur Messe gezwungen werden sollten, ob sie sich fügen oder Hab und Gut preisgeben, auswandern und ihre irdische Zukunft Gott anheimgeben wollten. Einige Männer sagten, sie hofften das Beste, aber landsfremde Bettler würden nirgends gern gesehen, man müsse auch für Weib und Kind Sorge tragen; einige Frauen, sie würden sich nach dem Willen ihrer Männer verhalten; aber ein paar alte Männer und alte Witwen sagten, von Gottes Wort würden sie nicht lassen, sollten sie auch darüber Leib und Gut verlieren müssen, und sie würden dem Herzog gleich die Hand darauf geben.
Er wisse wohl, dass die Prüfung hart sei, sagte Philipp August, aber himmlischer Lohn harre des Überwinders, und er wolle auch hier und dort für sie beten. Dann prägte er ihnen ein, seinen Söhnen Gehorsam zu leisten, wenn er bald nicht mehr sein werde, und sagte ihnen Lebewohl, worauf alle unter herzzerbrechendem Schluchzen auseinandergingen.
Einige Tage später fiel der alte Herzog beim Aufstehen in Ohnmacht, erholte sich aber wieder und ließ sich vollends ankleiden, wennschon die Ärzte Bedenken äußerten und Familie und Dienerschaft sich kopfschüttelnd daran erinnerten, dass man den 12. August schrieb, also gerade drei Monate nach dem Übertritt Wolfgang Wilhelms in Düsseldorf verflossen waren. Wie alltäglich nahm er dann an einer Sitzung der Räte teil und ließ sich von Heilbrunner ein Kapitel aus der Bibel erklären, um doch für alle Fälle auf das Ende vorbereitet zu sein. Beim Mittagessen, das bald nach zehn Uhr stattfand und an dem seine Gemahlin, seine Söhne, Heilbrunner und ein Arzt teilnahmen, legte er plötzlich den Löffel aus der Hand und schlief ein, um nicht mehr zum Leben zu erwachen.
Der Todesfall rief unendlichen Jammer im neuburgischen Lande hervor; nun, hieß es im Volke, würde man das Schicksal des benachbarten Donauwörth erleiden, wo die Schlechten, die ihren Glauben verrieten, Anstellungen und Ämter erhielten und straflos die Besseren quälen und unterdrücken dürften. Es waren in den letzten Jahren viele Donauwörther nach Neuburg gezogen, und diese sahen nun kommen, dass ihres Bleibens auch hier nicht wäre, sondern dass sie weiterwandern müssten, ärmer und hoffnungsloser als zuvor.
Im Februar des folgenden Jahres, nämlich 1615, hielt Wolfgang Wilhelm seinen Einzug in Neuburg und erklärte rundweg, von seinem Erbrecht nichts aufgeben zu wollen, worauf sich August und Johann Friedrich, um nur etwas zu bekommen, zu einem Vertrage bequemten, der jeden von ihnen mit einem kleinen Gebiet abfand, August mit Sulzbach und Johann Friedrich mit Hilpoltsheim, so aber, dass dem Ältesten, Wolfgang Wilhelm, auch über diese Landesteile die Oberhoheit zustand. Traurig verließen die verwitwete Herzogin und ihre Söhne das Neuburger Schloss, denen bald auch Jakob Heilbrunner, von der neuen Regierung verabschiedet, folgte.