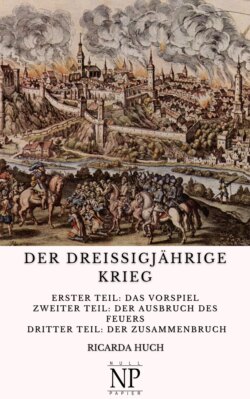Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
18.
ОглавлениеNach Rudolfs Tode nahmen die Streitigkeiten in der habsburgischen Familie ihren Fortgang und drehten sich jetzt besonders um die Person Khlesls, den Matthias nach seiner Thronbesteigung sogleich zum Direktor des Geheimen Rates ernannt hatte. Dem rüstigen Manne wollte fast der Mut sinken, als er sich in dem Wust umsah, wo er Ordnung schaffen sollte: da war die nun entlassene Dienerschaft des verstorbenen Kaisers, die, seit Jahren nicht bezahlt, aus bitterem Elend heraus um ihr Recht klagte, da waren die vielen Personen, die sich während der vergangenen Kämpfe um Matthias verdient gemacht hatten und ihren Lohn forderten, und statt Geldes waren da die unter Rudolf zu Millionen angeschwollenen Schulden. Dazu lief der Waffenstillstand mit der Türkei ab, und ein neuer, fürchterlicher Krieg konnte entstehen, während im Reiche die Union und die Liga trotzten und nirgendwo auf redlichen Beistand zu rechnen war. Der Reichstag lief kläglich auseinander, denn die evangelischen Stände wollten sich zu keiner Steuer verstehen, bevor nicht die Stadt Donauwörth dem Herzog von Bayern abgenommen und wiederhergestellt würde, dieser aber wollte den Raub nicht herausgeben und konnte von dem Kaiser nicht dazu gezwungen werden.
Bald bemerkten die Eiferer unter den Katholischen voll Missvergnügen, dass der ehemalige Vertilger der Ketzer eine versöhnliche Haltung gegen dieselben annahm, ja sie zuweilen geradezu zu begünstigen schien. Auf diesbezügliche Vorwürfe verantwortete sich Khlesl mit solchen Worten: Wer etwas ausrichten wolle, müsse die facta gelten lassen, und er lerne nun als ein factum kennen, dass die Evangelischen im Reiche zu mächtig wären, als dass sie gänzlich könnten ausgerottet oder unterdrückt werden. Also müsse man sich mit ihnen einzurichten suchen. Diejenigen, die in Kirchen und Klöstern steckten und nur Heiligenbilder um sich herum sähen, könnten sich wohl einbilden, der ganze Teig ließe sich in einen himmlischen Model kneten; wer aber in der Welt zu tun hätte, müsse sich aller Art Pasteten gefallen lassen, sonst käme zuletzt gar nichts auf den Tisch. Man müsse die Glaubenssachen von den politicis trennen, es herrschten in der Welt nun einmal nicht die gleichen Grundsätze wie im Reiche Gottes. Der rechte Glauben eröffne dem Menschen den Himmel, auf Erden komme es darauf an, dass einer ein fester und gehorsamer Untertan sei, und es komme vor, dass die Ketzer ihre Pflicht gründlicher täten als rechtgläubige Katholiken.
Dieser Umschwung in Khlesls Politik erzürnte vor allem den Erzherzog Ferdinand, den der Bischof früher in seinem reformatorischen Treiben unterstützt hatte und den er jetzt warnte, er solle die Untertanen nicht zur Verzweiflung und von Haus und Hof treiben, sonst mache er sein Land zur Einöde anstatt zu einem Gottesstaate. Das eigenmächtige Walten des hochfahrenden Bischofs kam Ferdinand überhaupt wie ein Eingriff in seine Rechte vor, da er sich schon als künftiger Herrscher fühlte; denn die oft ausgesprengten Gerüchte von der Schwangerschaft der Kaiserin erwiesen sich stets als Täuschung, und ebenso blieb Erzherzog Albrechts Ehe kinderlos. Erzherzog Maximilian, der Tirol regierte und dem die Evangelischen den Vorzug gegeben hätten, lebte in einem angenehmen Verhältnis mit einer Frau von Rosenberg und wollte seine gesicherte Behaglichkeit nicht um unabsehbare Kämpfe und Widerwärtigkeiten aufgeben, sondern verbündete sich mit Ferdinand, um diesem die Nachfolge seines Bruders zu verschaffen. Während Maximilian seine Abneigung gegen Khlesl weder verbergen konnte noch wollte, behielt Ferdinand einen freundlichen Verkehr mit ihm bei, um sich bei seinem Oheim als ein liebevoller und getreuer Sohn einzunisten. Zunächst kam es ihm darauf an, sich in Besitz der verschiedenen habsburgischen Kronländer zu bringen, und Matthias, der den Tag mit Brett- und Kartenspiel bei seiner Frau verbrachte und sich ungern durch Geschäfte darin stören ließ, versprach denn auch, was er haben wollte. Auf Khlesls Vorwürfe verteidigte sich Matthias, Khlesl hätte lieber den Ferdinand nicht zu ihm lassen sollen, anstatt ihn jetzt zu schelten. Was er denn hätte machen sollen?
Ob er denn nicht einmal nein sagen könnte, sagte Khlesl ungeduldig; das hätte doch selbst der verstorbene Kaiser Rudolf getan, als Matthias ihn um die Nachfolge angesprochen hätte, obwohl er sonst faul und gleichgültig genug in den Geschäften gewesen sei.
»Eben das ist es«, sagte Matthias. »Ferdinand macht es mit mir, wie ich es mit meinem Bruder Rudolf gemacht habe; das muss nun seinen Lauf nehmen.«
»O heilige Melancholie im Lehnstuhl!« rief Khlesl, die Hände zusammenschlagend, aus, »das muss es freilich, wenn Sie ebenso werden, wie Ihr Bruder Rudolf war. Können Sie sich denn nicht wehren? Können Sie nicht vergnügt und tätig sein, wie Ihr verstorbener Herr Vater war?«
»Wenn du mir sagst, was ich tun soll, will ich es tun«, seufzte Matthias. Ferdinand habe ihm versprochen, sich bei seinen Lebzeiten in nichts einzumischen, es sei nur eine Formsache, wenn er ihm die Kronen von Österreich und Böhmen abträte, man brauche es nicht so wichtig aufzufassen.
Ja, sagte Khlesl, mit dem Leim pflege man stets die Ruten zu bestreichen, mit denen man Vögel fangen wolle.
Der Ferdinand habe sich doch bisher als ein frommer, offenherziger junger Mann gezeigt, meinte Matthias.
Ach Gott freilich, sagte Khlesl, dem Ferdinand sitze die Maske trefflich, er habe sie mit auf die Welt gebracht.
Ein unerwartetes Hindernis trat den beiden Erzherzögen von befreundeter Seite entgegen, indem der König von Spanien als ein Nachkomme König Ferdinands I. Ansprüche auf die Erblande erhob. Vergebens stellten sie dem spanischen Gesandten vor, wie unvorsichtig es zurzeit von der Familie sei, sich in offener und heimlicher Feindschaft vielfach zu zerspalten; er blieb unerschütterlich, wohl wissend, die armen deutschen Habsburger würden die geldmächtige spanische Verwandtschaft nicht aufs Spiel zu setzen wagen. In der Tat bequemten sich Maximilian und Ferdinand dazu, mit Spanien um den Preis seines Verzichts zu handeln, was sich, da auf der einen Seite möglichst viel verlangt wurde, auf der anderen so wenig wie möglich gezahlt werden wollte, durch viele Monate hinzog. Inzwischen begannen die Verhandlungen mit Khlesl, der sich grundsätzlich zwar mit der Nachfolge Ferdinands einverstanden erklärte, aber behauptete, erst müsse das Reich unter einen Hut gebracht werden, bevor man einen neuen Kaiser dazu suche. Bestehe denn überhaupt noch eine Reichsverfassung, wenn kein Tribunal mehr da sei, dessen Entscheid düngen sich alle unterwürfen, und also kein Recht mehr zu erlangen sei? Wenn jeder Stand nach Belieben Bündnisse schlösse und einer wider den anderen praktiziere und rüste? Auch würden nur wenig Fürsten mit Ferdinands Wahl einverstanden sein, bevor ein Vergleich geschaffen sei, und einen solchen herzustellen, müsse also der kaiserlichen Regierung erstes Bemühen sein.
Dagegen eiferte Maximilian, das wären nur Vorwände, durch die Khlesl die Sache hinausschieben wolle; den Ketzern entgegenzukommen, helfe und ändere nichts; man müsse diesen vielmehr den Meister zeigen, wie es auch früher Khlesls Meinung gewesen sei; nun aber gehe er auf gottlose Ränke und Schliche aus, um die Macht in der Hand zu behalten.
Noch in einem anderen Falle hatte Ferdinand die Gegnerschaft Khlesls zu spüren. Es gehörte zu seinem Erblande die sogenannte kroatische Mark, die zum Teil von einer wunderlich gemischten Bevölkerung besiedelt war. Zu Flüchtlingen, die der türkischen Herrschaft entsprungen waren, gesellte sich mancherlei wildes Gesindel von den Küsten und Bergen Istriens, und so entstand um die Stadt Zengg herum ein Seeräubervolk, das man Uskoken nannte und das unter dem Schutze der Erzherzöge von Steiermark ein abenteuerndes, gefährliches Wesen trieb. Häufig kamen nun die Uskoken in Streit mit der benachbarten Republik Venedig, die die Herrschaft im Adriatischen Meere ausübte und beanspruchte und der die Abenteurer zwar nicht ernstlich Trotz bieten, die sie aber durch Überfall, Raub und Mord empfindlich schädigen konnten. Da Ferdinand auf die Klagen Venedigs die Schuldigen nur dem Scheine nach bestrafte, in Wirklichkeit aber beschirmte, kam es zum Kriege zwischen ihm und der Republik, in den sich auch Matthias mit hineinziehen ließ, sehr zum Ärger Khlesls, der Ferdinand vergeblich zum Nachgeben hatte bestimmen wollen. Seiner Ansicht nach war Ferdinand im Unrecht, da er mit Seeräubern gemeine Sache mache; überhaupt aber, sagte er, sei überall so viel entzündlicher Stoff auf Weg und Steg versteckt, dass jedes Feuer, irgendwo aufgegangen, einen allgemeinen, nicht mehr zu löschenden Brand erregen könne, und man müsse deshalb den Frieden zu erhalten suchen und keine Funken fliegen lassen.
Namentlich dem Erzherzog Maximilian wurde es immer unleidlicher, sich überall von der Macht und Pracht Khlesls übertrumpft und ausgestochen zu finden. Da er selbst ein sparsamer Hauswirt war und doch niemals mit seinen Einkünften reichte, wurmte es ihn über alle Maßen, wenn er die mit sechs Pferden bespannte Karosse des Bischofs daherfahren sah, oder den mit Zobel gefütterten Mantel, den er im Winter trug, und die Kragen von feuerroter und violetter Seide, auf denen die gelbe Farbe seines Gesichtes hässlich hervortrat. Nicht nur wusste Khlesl geschickt seine Einkünfte zu vermehren, sondern er bezog auch von vielen Seiten, namentlich von Spanien, reiche Pensionen und half dem notleidenden Kaiser oft mit kleinen Summen aus. Sogar seine Diener konnten als Herren auftreten, denn ohne sie zu bestechen, gelangte niemand zu ihm. Schon seit Jahren sprach man davon, dass der ehrgeizige Bischof nach der Kardinalswürde strebe, und nun hieß es, der Papst könne dem Wunsche des um die Kirche so hochverdienten Mannes nicht länger widerstreben. Voll Ingrimm glaubte Maximilian wahrzunehmen, wie er den Kopf bereits höher aufwerfe und sich in Kleidern und Gebärden pfauenhafter spreize als sonst, und es schien ihm keine Zeit mehr zu krummen Wegen zu sein. Entschlossen legte er Matthias seine und Ferdinands unumstößliche Forderungen vor: Ferdinand müsse durchaus so bald wie möglich in den Erblanden und im Reiche zum Nachfolger gewählt werden. Ein Kurfürstentag müsse ausgeschrieben und die Kurfürsten zur Wahl veranlasst werden; machten die Evangelischen Einwände oder erschienen sie nicht, so müsse die Wahl ohne sie vorgenommen werden. Damit dem ungewöhnlichen Verfahren Nachdruck gegeben werden könne, müsse Matthias unverzüglich ein Heer rüsten, dann könne es ihm nicht fehlen. Nach einigem Sträuben und Wehklagen gab Matthias nach, sodass Maximilian schon den Sieg davongetragen zu haben glaubte.
Plötzlich jedoch nahm die Sache eine ganz andere Wendung: Das Memorial, in welchem Maximilian seine Forderungen aufgezählt und begründet und welches er der kaiserlichen Kanzlei eingereicht hatte, war auf unerklärliche Weise in die Hände der Evangelischen geraten, die sich nun beizeiten gegen die desperaten Anschläge zur Wehr setzen konnten. Es litt bei Maximilian keinen Zweifel, dass Khlesl der Urheber dieses Verrates sei, und er beschloss die Niederlage mit den äußersten Mitteln zu rächen. Sein Hass nahm zu, als eine päpstliche Abordnung dem Bischof die Ernennung zur Kardinalswürde überbrachte, wodurch der Bäckerssohn zum Range der Erzherzöge erhoben wurde. Khlesl verfehlte nicht, dies seine Feinde auf glimpfliche Art merken zu lassen, wenn er auch übrigens gern beiläufig erwähnte, dass er keinen Wert auf äußerliche Auszeichnungen lege.
Von der Ausführung des scharfen Planes, den Maximilian ausgeheckt hatte, konnte nun keine Rede mehr sein, im Gegenteil galt es am Hofe von Dresden die vertrauliche Stimmung wieder herzustellen, dessen reichstreue Politik durch das argwöhnische Memorial ein wenig erschüttert war. Deshalb wurde ein Besuch des Kaisers Matthias und seines Neffen Ferdinand in Dresden vereinbart, bei welcher Gelegenheit die Grundlagen künftigen Zusammenhaltens besprochen werden sollten.
Dies war aus vielen Gründen eine schwere Angelegenheit für Matthias, den bald Gicht, bald Magenschwäche und Verdauungsbeschwerden plagten und der unzählige Übel für seine Gesundheit aus dem mühseligen Reisegeschäft und dem am sächsischen Hofe üblichen Vollsaufen hervorgehen sah. Ferner wurde er durch Ferdinand drangsaliert, weil der die Reise ohne Khlesl machen wollte, den Matthias gerade bei diesem Anlass, wo wichtige Dinge verhandelt werden sollten, nicht von sich lassen wollte und der auch selbst gar nicht darauf verzichtet hätte. In seinem erfinderischen Kopf hatte Khlesl sich ausgedacht, wie dieser Besuch zum Besten seiner Politik auszunützen sei. Es hatte nämlich Erzherzog Ferdinand seine kränkliche bayrische Gemahlin inzwischen durch den Tod verloren, und bei einer neuen Verbindung konnte der Ausgleich mit den Evangelischen etwa mit berücksichtigt werden. Wenn Ferdinand die Witwe des verstorbenen Kurfürsten Christian heiratete und also die künftige Kaiserin evangelisch wäre, so, dachte Khlesl, könnte dies als ein schönes Symbol des hergestellten Einverständnisses im neugeeinigten Reiche ausgedeutet werden und recht wohl auf die beiderseitige Haltung Einfluss gewinnen. Freilich war es ungewiss, ob der ausschweifende Gedanke die päpstliche Billigung finden würde; aber vielleicht kam ihm die Anmut der dänischen Fürstin, die bereits eine feurige, wenn auch vergebliche Liebesneigung in dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt entzündet hatte, zu Hilfe, was besonders bei Ferdinands leicht entflammbarem Temperament nicht unmöglich war.
Nachdem zuvor Ferdinands Krönung zum König von Böhmen vollzogen war, wurde die Reise angetreten, und zwar so, dass die letzte Strecke bis Dresden zu Schiff auf der Elbe gemacht wurde. An der Grenze bewillkommnete der Kurfürst die Österreicher in festlicher Weise durch eine Wasserjagd, indem das Wild durch Treiber und Hunde in den Fluss gehetzt und dort von den in ihren Schiffen befindlichen Gästen erlegt wurde.
Ferdinand genoss die dargebotenen Lustbarkeiten, die für den Kaiser meistenteils beschwerlich waren, in vollen Zügen. Er hatte zwar von Khlesls Heiratsplan nichts wissen wollen, freute sich aber doch auf die Bekanntschaft der schönen Witwe und wurde denn auch durch ihr freies Anlächeln und rätselhaftes Blicken sofort bezaubert. Er fand, dass sie viel feiner und klüger zu reden wusste als seine Schwestern oder seine verstorbene Frau, und die anschmiegende Beweglichkeit ihres zierlichen Leibes war selbst durch den steifen Brokat ihres Kleides zu fühlen. Nachdem er mit ihr getanzt und den Druck ihrer Hand sowie die Zärtlichkeit ihrer Nähe überhaupt gefühlt hatte, schlug das Feuer ihm vollends über dem Kopfe zusammen, sodass Erzherzog Maximilian ihn mit Blicken strafte und Eggenberg für nötig hielt, ihm vor dem Schlafengehen vertraulich zuzureden. Er solle um Gottes willen die Zügel nicht so fahren lassen, sagte er, sondern bedenken, wohin das blinde Rößlein ihn zuletzt tragen werde. Was werde der Papst zu einer so verwegenen Heirat sagen, vom Erzherzog Maximilian zu schweigen, der ihm seine väterliche Zuneigung ganz entziehen werde. Ob er der Kirche und der Verwandtschaft, der ganzen katholischen Welt trotzen wolle? Die Kurfürstin meine es gewiss auch nicht redlich mit ihm, denn sie sei fest lutherisch, werde nie davon weichen. Die dänische Familie sei schön von Gesicht, aber üppig und verbuhlt; der Kurfürstin könne man ja nichts nachsagen, aber sie werde auch nicht anders sein als ihr Bruder, der König von Dänemark; solche Frauen hätten keine Beschaffenheit zur Ehe, passten besonders nicht für das Erzhaus. Gott möge es dem Khlesl verzeihen, dass er das Feuer angelegt und angefacht habe, er habe sicherlich sein Verderben damit stiften wollen, Ferdinand solle sein Heil bedenken und dem Kardinal zum Torte die Flamme im Entstehen zertreten.
Der kurfürstliche Wirt war in bester Laune, unermüdlich vortrinkend und laut schwörend, dass er beim Hause Österreich leben und sterben wolle. Hatte er in seiner Hauptstadt auch nicht viel Kunstwerke und Raritäten vorzuweisen, so entzückte er doch namentlich Ferdinand durch eine Sauhatz, die mitten in der Stadt auf dem Markte abgehalten wurde, wie auch ebenso durch die Musik, die zur Tafel aufspielte. Während der Kurfürst und sein Hof sich bei Tische nicht sonderlich um die Kapelle bekümmerten, horchten die Gäste zuweilen erstaunt und freudig auf, und Ferdinands Freund, Fürst Eggenberg, stand sogar mehrmals auf, brachte dem Kapellmeister ein Glas voll Wein, stieß mit ihm an und beglückwünschte ihn wegen der Kunst, mit der er die Kapelle leitete. Als der Kurfürst dies bemerkte, erzählte er lachend, dieser Kapellmeister, namens Heinrich Schütz, habe einen besonderen Wert für ihn, weil er ihn dem Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel abgejagt habe. Dieser habe den Schütz als einen talentvollen Knaben entdeckt, ihn im Gesang unterrichten lassen und später an seinen Hof gezogen. Als er gehört habe, was für ein großes Wesen der Landgraf aus dem Schütz machte, habe er sich ihn einmal schicken lassen und ihn dann ganz für sich behalten wollen, was der Landgraf Moritz sehr ungern vernommen habe. Da aber der Schütz auf kursächsischem Gebiet geboren sei und da der Landgraf ihm wohl auch nicht dauernd habe zuwider sein mögen, sei der Handel zustande gekommen, was ihn besonders freue, weil Landgraf Moritz sich bekanntlich einbilde, mehr zu wissen und zu können als andere Leute und an seinem Hofe besonders gelehrt und neumodisch eingerichtet zu sein. Er bekomme zuletzt immer, was er wolle, sagte der Kurfürst behaglich, und zwar ohne sich zu rühren. Mit Fechten und Schwitzen könne jeder etwas ausrichten, aber mit Stillsitzen den Sieg davonzutragen, sei die wahre politische Kunst, auf die sich nicht jeder verstehe.
Als vornehmste Ergötzung wurde den Gästen eines Abends eine Komposition Schützens, nämlich ein musikalisches Gespräch zwischen Apollo und den Musen, vorgeführt. In einem Saale des Schlosses war eine kleine Bühne hergerichtet, auf welcher die Sänger auftraten, Apollo mit einem Lorbeerkranz in den blonden Locken, in goldgesticktem Wams und purpurnem Mantel, die Musen in altdeutschen Gewändern mit gepufften Ärmeln. Den Hintergrund bildeten, auf eine Wand gemalt, ein dunkelgrüner Hain und ein weißer Tempel auf sonnenbeschienenem Hügel. Zufrieden lächelnd, beobachtete Johann Georg das Erstaunen und die Bewunderung seiner Gäste während der Darstellung: Matthias und die Kaiserin weinten, Ferdinand wiegte seinen weichen Körper hin und her, und seine blauen Augen funkelten in feuchter Wonne, Fürst Eggenberg schien jeden Ton wie einen aus Wolken tauenden ambrosischen Tropfen aufzufangen und innig zu schlürfen. Am Schlusse des Spiels, das mit einer Huldigung für das Kaiserpaar endete, wurde Schütz vor die Majestäten befohlen, um ihr Lob in Empfang zu nehmen. Ferdinand klopfte ihm auf die Schulter und sagte gemütlich: »Er versteht seine Sache. Ich gebe zehn von meinen großmäuligen Standesherren um ein solches Ketzerle, wie Er ist.« Eggenberg nötigte den Kapellmeister, sich zu ihm in eine Ecke zu setzen, und fragte ihn über seine Komposition aus. Woher er das habe? Das sei etwas Neues und Gewaltsames, aber Wundervolles. Die Musik sei sonst eine überirdische Erscheinung unter den Menschen gewesen, vestalisch verhüllt und unnahbar; nun aber sei es ihm so gewesen, als hätte sie ihre Brust gleich einem Zauberspiegel entschleiert, und ein jeder hätte sich selbst darin erblickt, so wie Gott sich vorbehalten habe, sich zu erkennen, sodass es ihm fast verboten und schaurig vorgekommen sei. Da er nun das genossen habe, glaube er, es werde ihm kein Tonstück von der alten Art mehr schmecken.
Schütz erklärte, dass er derartige Musik in Venedig kennengelernt habe, wo er jahrelang bei dem berühmten Meister Gabrieli studiert habe, und dass er hoffe, mit der Zeit noch größere Vortrefflichkeit darin zu erreichen. Die Musik sei bisher in der babylonischen Gefangenschaft gewesen, und er möchte sie in ihre Heimat zurückführen. Das sei schwer zu erklären und schwer zu begreifen. Er wolle die alte Musik nicht herabsetzen, keineswegs, denn sie sei eine Offenbarung Gottes gewesen; nun aber müsse der Tönebrunnen aus der Menschen Herz ausfließen und künden, was darinnen sei.
»Mein Freund«, sagte Eggenberg, »Ihr seid nur ein bescheidener Kapellmeister, und doch seid Ihr mehr als irgendeiner von uns, wie mir scheint, den Göttern ähnlich. Ihr lasst Licht werden und zaubert tönende Geschöpfe aus dem Abgrund und verbindet die chaotischen Stimmen zu einer geregelten, in Vollkommenheit schwebenden Harmonie.«
Das feine, von heimlicher Träumerei umdunkelte Gesicht Schützens erhellte ein gütiges Lächeln. Sein Geschäft müsse doch um vieles leichter sein als das des Herrgotts, sagte er; denn dessen Kreaturen ständen trotz seiner Allmacht in lauter Hader und Disputieren, die Disharmonien lösten sich niemals auf, und es würde damit immer schlimmer statt besser.
»Ja, das sind Geheimnisse«, nickte Eggenberg ein wenig zurückhaltend. »Wir Menschen machen so viel Lärm auf der Erde, dass wir die Harmonie Gottes nicht vernehmen können.«
Khlesl hatte, auch abgesehen von dem Missglücken seines Heiratsplanes, manche Bitterkeit zu schlucken. Er hatte kraft seines Kardinalsranges das Recht, bei Tische zwischen den Erzherzögen zu sitzen; da diese aber mit Abreise drohten, wenn sie nicht über ihn gesetzt würden, was wiederum Khlesl sich nicht gefallen lassen wollte, schlug der bedrängte Hofmarschall vor, Khlesl möchte an einer anderen Tafel sitzen, wo er den unbestrittenen Ehrenplatz einnehmen würde. Hierauf ging Khlesl mit saurer Miene ein, obwohl er wusste, dass es ihm zu Despekt und Schimpf gereichen würde, und es entging ihm auch nicht, mit welcher Schadenfreude Maximilian ihn vom kaiserlichen Ehrentische aus beobachtete.