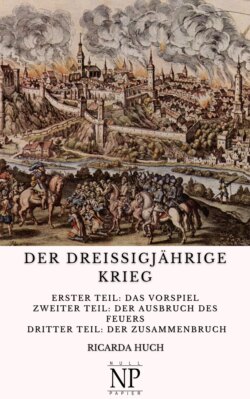Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
17.
ОглавлениеWar die neuburgische Vermählung unheilvoll für die evangelische Sache gewesen, so wurde in dem älteren Zweige der pfälzischen Familie im selben Jahre eine gefeiert, die den Verlust reicher einbringen zu sollen schien: der junge, eben mündig gewordene Kurfürst Friedrich V. nämlich führte die englische Prinzessin Elisabeth, Tochter Jakobs I., heim, deren Name an die große Beschützerin der protestantischen Freiheit erinnerte. Die pfälzischen Räte rühmten und freuten sich dieses Erfolges ihrer Diplomatie nicht wenig, denn sie glaubten damit die Unterstützung derjenigen Macht gewonnen zu haben, deren herrlicher Triumph über die spanische Tyrannei noch frisch in aller Gedächtnis war. Der junge Friedrich ließ sich gern sagen, wie gut er nunmehr versorgt und für seine hohe Rolle ausgerüstet sei, wie weit er durch die königliche Verwandtschaft andere Fürsten überrage; doch waren ihm die schöne Braut, die vielfachen Annehmlichkeiten des Ehelebens, die Hochzeit und der Empfang zu Hause, der das Übliche an Pracht übertreffen sollte, zunächst wichtiger. Der verwöhnten Engländerin sollte das neue Reich am Rheine nicht armselig erscheinen, vielmehr sollte sie womöglich durch Überfluss überrascht werden. Ein mit farbigen Tüchern ausstaffiertes, von bunten Fahnen umflattertes, wie ein schwimmendes Schlösslein mit Gold- und Silberzeug eingerichtetes Schiff führte sie bis Mainz, wo ihr Gemahl, der ihr vorausgereist war, sie erwartete. Von allen pfälzischen Städten hatte ihr die Festung Frankenthal, welche als eine Kolonie aus Frankreich auswandernder Hugenotten von dem Kurfürsten Friedrich III. war gegründet worden, den schönsten Empfang bereitet. Aus einem rosigen Gewölk blühender Aprikosen- und Apfelbäume stiegen die grauen Mauern kantig hervor, hinter denen das heitere Städtchen voll zierlich gegiebelter Häuser in gepflegten Gärten sich barg. Wie wenn ein in Eisen gerüsteter Ritter das Visier öffnet und ein freundliches Jünglingsgesicht zwischen den dunklen Platten sichtbar wird, so überraschte das Bild der geschmückten Stadt die durch das Tor Einziehenden. Festliche Jugend überreichte der Königstochter ein von Frankenthals berühmten Goldschmieden angefertigtes Kleinod: eine große, von einem aus Saphiren und Smaragden bestehenden Stirnband, welches das Meer versinnbildlichte, herabhängende Perle, mit Anspielung auf Elisabeths Beinamen ›die Perle von England‹. Die Ehrenbogen, die über die Hauptstraße ausgespannt waren, trugen Bilder mit Inschriften, unter denen das wichtigste eine Darstellung des Seesieges der englischen Flotte über die von Philipp II. ausgesandte furchtbare Armada darstellte. Darüber waren die Worte geschrieben: ›Elisabeth rex‹, das heißt: Elisabeth König, und darüber: ›Deus flavit‹, das heißt: Gott blies. An dieser Pforte wurde der nunmehrigen Kurfürstin eine Anrede in deutscher Sprache gehalten, von welcher sie, des Deutschen unkundig, nichts verstand; auch hätte sie ohnehin, von herrlichen Gefühlen allzu ungestüm bewegt, den umständlichen Worten nicht folgen können. Auch ihr Name, das fühlte sie, konnte ein Zauberwort für die evangelischen Völker werden, hatte sie doch Kraft und Begeisterung genug; es sollte nur Feindeswut sich heranwälzen, ihr Herz würde wie ein Fels stehen und wie die Sonne Segen verbreiten, ohne je verdunkelt zu werden. Sie lächelte das Volk, das ihr zujubelte, verheißungsvoll an und wandte sich nach ihrem Gatten um, dessen Blicke verliebt an ihr hingen; nein, sie würde es niemals bereuen, dass sie, auf die Ansprüche ihrer königlichen Geburt verzichtend, eine Kurfürstin im Reiche geworden war. Wie ansehnlich ihres Mannes Stellung war, zeigte sich vollends in Heidelberg, als ihr seine Vasallen entgegenzogen, unter denen einige Fürsten und viele Grafen und Ritter waren. Diese Herren, als die Helden des Trojanischen Krieges ausstaffiert, begrüßten Elisabeth als die schöne Helena und geleiteten sie durch die Stadt den Hügel hinauf nach dem Schlosse, sodass es von weitem aussah, als werde eine riesenhafte Blumengirlande den verschlungenen Weg hinauf gewunden; staunend sah das gedrängte Volk die blanken Rüstungen, das prunkvolle Geschirr der Rosse, die flatternden Helmbüsche und Schärpen durch das frühlingshelle Grün der Gebüsche blitzen.
Einige Jahre später heiratete die Schwester Friedrichs V. den jungen Kurprinzen von Brandenburg, Georg Wilhelm, wodurch diese beiden reformierten Häuser nahe miteinander verbunden wurden und gemeinsame Wirksamkeit desto natürlicher schien. Noch ein Hoffnungsstern ging den unierten Fürsten um diese Zeit im Norden auf, indem nach dem Tode König Karls IX. von Schweden dessen Sohn Gustav Adolf den Thron bestieg, dem das Gerücht trotz seiner Jugend heroische Neigungen und Tätigkeiten zuschrieb.
Nachdem Karl IX. im Jahre 1611 gestorben war, übernahm sein Sohn Gustav Adolf nach Wahl der Stände die Regierung und ernannte alsbald seinen Erzieher und Freund, den um etwa zwölf Jahre älteren Grafen Axel Oxenstierna, zu seinem Minister. Als Knabe hatte er inniger einem anderen Lehrer, dem aus dem Volke stammenden Johann Skytte angehangen, der ihn mit den Sagen aus der Urzeit der nordischen Völker und mit den Geschichten seiner Vorfahren, der Wasa, das Herz so mächtig zu erschüttern wusste. Am liebsten ließ sich der junge Königssohn von seinem unglücklichen Oheim Erich erzählen, der im Wahnsinn, als Gefangener seines Bruders Johann und wahrscheinlich durch denselben ermordet, gestorben war: von der Unbändigkeit seines Wissensdranges und seiner Eroberungssucht; denn nicht nur hätte Schweden seiner unersättlichen Begier keine Genüge getan, sondern, erzählte Skytte, wenn die Erde sein gewesen wäre, würde er sich über die Sterne haben ausbreiten wollen; dann wie zuweilen eine uralte heidnische Wildheit in ihm aufgekocht sei, in der er nach Blut gelechzt habe wie ein Wolf, und wie er einmal in einer solchen Raserei die Sture, die ihm trotzten, mit eigenen Händen erschlagen habe; dann wie er voll Musik gewesen sei und ihrer so mächtig, dass in der Zeit seiner Gefangenschaft und seines Wahnsinns König Johann ihm die Laute habe fortnehmen lassen, damit die Süßigkeit seiner Gesänge nicht die Kerkermeister betöre.
Es machte Skytte schweren Kummer, dass sein Zögling sich in den Jünglingsjahren mehr dem Oxenstierna anschloss, dem er als einem von Adel misstraute und dessen Einfluss er für gefährlich hielt, weil er glaubte, dass er Gustav Adolf in seiner Neigung zu einer kriegerischen, weit ausgreifenden Politik bestärke. Nach seiner Meinung war es die Aufgabe eines schwedischen Königs, Frieden und Ordnung im Innern des Reiches herzustellen, wo der Adel ebenbürtig und auf die königliche Vorherrschaft eifersüchtig, wo die Städte arm und das Gewerbe unentwickelt sei, nicht aber, das so vielfach bedürftige Reich zu vergrößern. Gustav Adolf ließ es sich angelegen sein, Skyttes Empfindlichkeit zu beschwichtigen, und hatte darüber eine Unterredung mit ihm im Schloss, wo er sich etwa ein Jahr nach seiner Thronbesteigung während der Friedensverhandlungen mit Dänemark aufhielt.
Er habe unrecht, begann er gegen Skytte, Oxenstierna zu misstrauen, der ihn liebe und es treu mit ihm meine. Ja, sagte Skytte, indem er sich bedächtig seinen schwarzen gegabelten Bart strich, dessen Enden geflochten und von einer roten Schnur durchzogen waren, ja, so treu es ein Adliger mit seinem König meinen könne, dem er sich im Grunde überlegen fühle.
Gustav Adolf zögerte einen Augenblick, dann lachte er und sagte, am letzten Ende sei es doch das Volk, das den König am wenigsten lieben könne; es halte nur zu ihm, solange der Adel es drücke.
Wenn das wahr sei, sagte Skytte, sei es ein schlechtes Zeichen für die Könige. »Was willst du?« sagte Gustav Adolf, »sie sind nun einmal da, so wie Gott da ist. Möchtest du auch aus dem Himmel eine Republik machen? Einer muss die Zügel führen, und das werde ich tun trotz Oxenstierna.«
Er wolle es glauben, erwiderte Skytte; aber der Mensch folge auch unbewusst dem Rat, der ihm beständig ins Ohr falle. Er wisse wohl, was Oxenstierna im Sinne habe: er wolle den König durch Krieg beschäftigen, damit sich der Adel daheim des Steuers wieder bemächtigen könne. Darum wecke er in Gustav Adolf die Erinnerung an das alte skandinavische Dreikönigreich und reize ihn gegen Dänemark, mit dem er es doch nicht aufnehmen könne.
Nein, rief der junge König rasch und heftig aufspringend, wenn er es wissen wolle, so sei es umgekehrt. Er, ja er, hätte sich blind auf den König von Dänemark stürzen und ihn am liebsten mit den Händen erwürgen mögen, den aufgeblasenen Prahler, der sich erdreistet hätte, ihn mit seiner Flotte bis in das Schloss von Stockholm zu beunruhigen! Oxenstierna sei es, der ihm zurede und vorstelle, er müsse jetzt an sich halten, bis er seine Flotte verstärkt und ein tüchtiges Heer formiert und es im Kampfe mit schwächeren Feinden geübt habe. Er sei weder eine Puppe in Oxenstiernas Händen noch ein Schwächling, der sich vor dem König von Dänemark verkrieche, das wolle er seinerzeit beweisen!
Skytte trat einen Schritt zurück und betrachtete nicht ohne Wohlgefallen die hohe und breite Gestalt des blonden Königsknaben, der auf ihn zugesprungen war und mit blitzenden Augen drohend vor ihm stand. »Es scheint zuweilen«, sagte er sinnend, »als hätte ein Geschlecht nur einen einzigen durch die Zeit sich streckenden Riesenleib; denn so, wie du jetzt vor mir stehst, denke ich mir deinen Oheim, den unglückseligen Erich Wasa.«
»Und warum nicht?« sagte Gustav Adolf, »habe ich doch sein Blut in meinen Adern.«
»Das Blut der Wasa«, sagte Skytte, die Stirn zusammenziehend, »fließt nicht wie ein breiter, befahrener Strom, sondern wie die Katarakte des Nordens, die donnern und schäumen und hoch aufspritzen.«
»Das ist rechtes Königsblut!« fiel Gustav Adolf rasch ein, dessen blaue Augen leuchteten.
Skyttes Gesicht verdüsterte sich immer mehr. »Wie könnte ein König wohltätig herrschen«, sagte er, »der sein eigenes Herz nicht bändigen kann!« Nun, sagte Gustav Adolf, es seien jetzt andere Zeiten als die seines Großvaters und seiner Oheime, und er habe wohl ihr Blut, aber einen anderen Geist. Dass er sein Herz bemeistern könne, beweise er jetzt in der dänischen Angelegenheit und werde es ferner tun; aber es bleibe doch wahr, dass eines Königs Brust heißer und begieriger sein müsse als die anderer Menschen; denn in ihm schlage das Herz des ganzen Volkes.
Wenn das wahr wäre, sagte Skytte eigensinnig, würde er, Gustav Adolf, die Scholle lieben, die das Volk pflüge, nicht aber nach dem Meere trachten. Was früge das Volk, das sein Leben auf den Schlachtfeldern verbluten lassen müsse, nach fremden Ländern, deren Schätze den König zum Tyrannen machten?
Von plötzlicher Ungeduld überwältigt, schlug Gustav Adolf mehrmals mit der geballten Faust auf den Tisch und rief, was denn alles dies heißen solle? Er, Skytte, sei es gewesen, der ihm als Knaben, während er ihn an der Hand durch die stillen verschneiten Wälder führte, von den Strömen des Nordens erzählt habe und wie man durch den Donner ihrer Wasserfälle zuweilen die schmelzende Harfe könne singen hören, die der Neck spiele. Er, Skytte, sei es gewesen, der ihm zuerst von seinem Großvater Gustav Wasa und von seinen Oheimen erzählt und seine Brust mit Träumen seines ungeheuren Geschlechts erfüllt habe. Warum er das getan hätte? Warum er seinen Großvater den Hort Schwedens und die Sonne des Nordens genannt hätte? Nun schelte er ihn, weil er Wolfsblut habe und König sei.
Skytte sah den erzürnten Jüngling erstaunt an und bedachte sich eine lange Weile. »Jener war ein Bauernkönig«, sagte er, »darum liebte ich ihn.«
Ob er das etwa nicht sei, sagte Gustav Adolf eifrig. Ob ihm die Bauern nicht zujubelten und anhingen? Aus seinen Bauern wolle er ein unbesiegbares Heer machen und unsterbliche Taten mit ihnen tun. Er verachte die Tugenden der Bauern nicht, ihre Genügsamkeit und Rauheit sei ihm mehr wert als weichliche Bildung. Was er zu tun vorhabe, werde er zum Wohle des schwedischen Volkes tun und zum Heil und Ruhm des reinen Christenglaubens, dessen Bekenner er sei.
Als Skytte ihn verlassen hatte, hing Gustav Adolf noch lange den mächtig durcheinanderflutenden Gedanken nach, die das Gespräch in ihm erregt hatte. Das leicht aus Holz gebaute Schloss, in dem er sich befand, bebte zuweilen von den Stößen des von einem starken Wind an die Küste geschleuderten Meeres, ohne dass es dem Träumenden zum Bewusstsein kam. Er dachte an das, was er dem dänischen König gegenüber bereits durchgesetzt hatte, dass er nämlich wie jener Wappen und Titel der drei skandinavischen Königreiche führen durfte und dass er ihm die große Summe, die er ihm zu zahlen sich verpflichtete, nicht als Schuldigkeit oder Tribut, sondern als freiwilliges Geschenk leistete. Viele Gesandtschaften waren darüber hin und her gegangen und viele Verhandlungen gepflogen, und auf keine der anzüglichen Prahlereien König Christians war er ihm die Antwort schuldig geblieben. Das mochte der Welt wenig scheinen, und es kostete ihn viele Mühe, sich mit so versteckten, einer Niederlage abgerungenen Erfolgen zu begnügen; aber einst würden sie seine Mäßigkeit und Weisheit bewundern und begreifen, um welch heroischer Ziele willen er seine Ansprüche und seinen Mut gezügelt hatte. Die Zeit würde kommen, wo Christian IV., der vermeintliche Riese des Nordens, kleingebeugt vor ihm weichen würde, wo seine Angelegenheiten die des ganzen Erdkreises sein würden. Er fürchtete weder ihn noch die anmaßenden Hansestädte, noch die reichen holländischen Staaten, die Griechen der neuen Zeit, noch England, noch seinen Vetter, den polnischen König Sigismund, der ihm die Krone streitig machte, und am wenigsten den gichtbrüchigen Jesuitenkaiser mitsamt seiner spanischen Verwandtschaft, die jenen offen und heimlich unterstützten; es war eine unaussprechliche Gewissheit in ihm, dass er, wenn er einmal seine ganze Kraft ausströmen ließe, über sie alle hinausginge. Er war nur der arme Schwedenkönig; aber sein war das salzige Meer, das einen Ring um die Erde schloss. Während in grauer Vorzeit die Völker des Festlandes miteinander um die Erde stritten, hatten die Nordmänner das Meer unterjocht, das Urelement, das Länder gebiert und verschlingt. Über das Meer hin rauschten sie auf geflügelten Drachen und gründeten stolze Staaten mitten in der Wonne des Südens. Auch er wollte nun reisen und die Welt sehen. Sowohl Skytte wie Oxenstierna hatten Deutschland bereist und ihm von seinen Wundern viel erzählt; seitdem liebte er es, sich das uralte Reich vorzustellen, schwer von Ruhm und Weisheit, geheimnisvoll starrend und glühend von den Juwelen seiner Städte, die wie köstliche Schreine den heiligen Staub von Jahrhunderten verwahrten. Da waren die handelsmächtigen Hansestädte Bremen, Lübeck, Stralsund, Braunschweig, Magdeburg, mit dem strengen Prunk und der kampfgekrönten Ehre ihrer Rathäuser, mit ihren Domen, die Burgen Gottes glichen, mit der gebieterischen Wucht ihrer Mauern und Türme. Dann öffneten sich die reizenden Gefilde des Südens, durch welche Rhein, Main und Neckar, Donau und viele andere Ströme, traubenumrankt und segentriefend, sich ergossen, widerspiegelnd die himmelhohen Türme des goldenen Mainz, die reichen Märkte Frankfurts, die strotzenden Kaufhäuser Ulms, das bilderprangende Augsburg und das königliche Prag. Es schien ihm unbegreiflich, dass die Kaiser, in deren Hände noch dazu die neuen Reichtümer Spaniens flossen, dass die vielen, von gelehrten Räten umgebenen Fürsten, die Herren aller dieser Macht und Pracht, so ratlos und hilflos nach ausländischem Beistand suchten, unfähig, sich aus der Verwirrung, in die sie sich selbst gebracht hatten, zu lösen oder gewaltsam zu reißen. Waren sie entartet oder verweichlicht, oder war es vielleicht Gottes Ratschluss, der sie verblendete, um eine neue Herrlichkeit zu seiner Ehre über den Trümmern zu errichten? Wollte er sich aus den gestürzten Säulen der alten verrotteten Kaiserherrlichkeit ein Jerusalem bauen, an dessen Altären dem wahren Glauben gedient wurde? Und wies sein allmächtiger Finger auf ihn als den Baumeister, der das himmlische Werk gründen sollte? Er hatte Augenblicke, wo er sich fühlte, als sei er auserwählt, etwas Großes zu vollbringen, und wo er seine Brust von dem Gotteswillen geschwellt glaubte, der in ihm wirkte.
Er nahm seine Laute von der Wand und griff träumend ein paar Akkorde; es ging ihm plötzlich durch den Sinn, dass er alle diese Herrlichkeit, ja die Welt hingeben würde um den Besitz eines Mädchens, das er liebte und auf die er, so sagten Oxenstierna sowohl wie seine Mutter, verzichten müsse, weil sie zwar adligen, aber nicht fürstlichen Standes war. Wenn die Leute erst einmal merkten, sagte Oxenstierna, dass die Gräben zwischen den Ständen sich überspringen ließen, würde keiner mehr Untertan sein wollen. Das Heiraten sei ein Geschäft, und jeder wolle doch ein gutes Geschäft machen, bei dem er sich verbessere. Heirate er eine vom Adel, das würde Einmischungen, Einreden und Übergriffe der Verwandtschaft, Eifersucht der anderen geben; anstatt dessen könne ein fürstlicher Schwiegervater ihm im Notfall Verstärkung geben und sein Ansehen erhöhen. Zu seiner Mutter sagte er, dass die Geliebte klüger und feiner sei als alle Königstöchter der Welt und dass er, indem er sie heirate, sie zur Königin mache; worauf seine Mutter entgegnete: was Herz und Geist eines Menschen tauge, gehe Gott an, die Menschen müssten nun einmal nach Titel und Stand unterscheiden. Wer in der Welt fortkommen wolle, müsse das Weltliche und Göttliche auseinanderhalten, denn das beides vermische sich nicht. Wolle man sich das Gebäude irdischen Wohlergehens errichten, müsste man Stein und Mörtel, Holz und Balken dazu nehmen. Liebe, Großmut, Mitleid und Frömmigkeit, das sei alles gut an seinem Ort, nur dürfe es keine Folgen im Weltlichen haben. Es stehe deshalb auch geschrieben, der Mensch könne nicht Gott dienen und dem Mammon. Ach und die Liebe! Er werde doch ein paar warme Nächte nicht mit seinem Leben bezahlen? Seiner Mutter könne er vertrauen: an die Liebe glaube nur, wer nie ein Geliebtes besessen habe.
Dies alles leuchtete Gustav Adolf nicht ein; denn gab es überhaupt Vorschriften für einen Willen? Machte ein Wille nicht alle Erfahrungen und Gesetze schmelzen wie die Sonne den Schnee? Er, er sollte nicht zugleich in der Welt herrschen und Gott dienen können? Dennoch brachte er die Vorstellung nicht wieder aus dem Sinn, wie die verschwägerte Adelssippe ihn beeinträchtigen und belästigen würde, während verwandte Fürsten, etwa im Reich, sein Ansehen heben und seine Macht verstärken könnten. Gerade eine solche Heirat würde ihn in den Stand setzen, Gott zu dienen, indem er seine Anhänger um sich scharte und, von ihnen unterstützt, seine Widersacher bekämpfte.