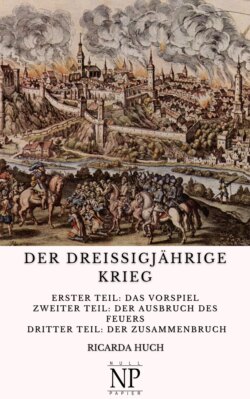Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
21.
ОглавлениеMoritz von Hessen hatte Ursache, stolz auf seine Kinder zu sein; namentlich war er es auf die anmutige und kluge Elisabeth, die so bescheiden zuzuhören wusste, wenn ihr Vater sich mit gelehrten Männern unterhielt, und so überraschend gedankenvoll mitzusprechen, wenn sie dazu aufgefordert wurde. Schöner waren die Söhne, denen die frühverstorbene Mutter ihren vielbewunderten Reiz zum Gedächtnis eingeprägt zu haben schien: Otto, der älteste, mit dem vollen griechischen Munde und dem runden Kinn, und Moritz mit den goldstrahlenden Augen, dem braunen Gelock und der mädchenhaft leicht errötenden zarten Haut. Die junge Stiefmutter sah die wundervolle Blüte der bevorzugten Nachkommen ihres Mannes nicht ohne Eifersucht, doch war sie zu einsichtig, um es merken zu lassen, und das Ansehen des Landgrafen in der Familie zu groß, als dass Streit und Misshelligkeit sich laut hervorgewagt hätten.
Es war ein Augenblick schöner Genugtuung für Moritz, als sein Erstgeborener im Jahre 1612 den neugewählten Kaiser Matthias in Frankfurt in einer zierlichen lateinischen Ansprache begrüßte und die Augen der Fürsten neidisch oder wohlwollend auf dem Achtzehnjährigen ruhten, nicht wenige von dem Gedanken erfüllt, wie lieblich der Satan seine gefährlichen Werkzeuge auszuzieren wisse.
Bald darauf traf den glücklichen Vater ein jäher Schlag, indem der zwölfjährige Moritz erkrankte und schon nach zwei Tagen, bevor noch jemand die Gefahr des Zustandes erkannt hatte, starb. Da man nichts anderes annahm, als dass es sich um ein leichtes Fieber handle, stellte Moritz, am Bette des Knaben sitzend, ihm allerlei Aufgaben als Unterhaltung und Prüfung. Er disputierte mit ihm über das Abendmahl, in der Weise, dass er abwechselnd die Rolle eines Lutheraners und eines Papisten spielte und der Kleine die Auffassung der Reformierten beiden gegenüber verteidigen und sie mit Bibelstellen erhärten musste. Dann ließ er ihn Sätze aus dem Deutschen ins Lateinische und Französische übertragen, was alles Moritz zufriedenstellend ausführte, die brennenden Augen eifrig und ein wenig angstvoll auf den Vater gerichtet, dessen Ungeduld beim Unterricht ihm bekannt war. In der Mathematik jedoch, die des Landgrafen Lieblingsfach war, wurden die Antworten des kranken Kindes unsicher und blieben einige Male ganz aus, sodass der Vater es scharf zur Aufmerksamkeit anhielt. »Ich werde es gleich wissen, lieber Vater«, sagte das Kind, erschrocken die Hände faltend, und ließ den Kopf in das Kissen zurückfallen, indem es stammelnd um Wasser bat. Wie der Landgraf das Gesicht seines Sohnes sich verfärben sah, sprang er auf, läutete, rief nach Dienern und Ärzten; eben hatte er noch Zeit, den laut Atmenden in seine Arme zu nehmen und ihm zuzurufen: »Mein Sohn, mein Sohn, denke an Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist!«, als die Augen, die ihn flehend ansahen, brachen, und das geliebte Kindeshaupt leblos auf seine Schulter fiel.
Der Landgraf blieb lange mit dem Leichnam seines Knaben allein und ließ sich während mehrerer Tage nur wenig vor anderen sehen; erschien er aber, so war sein Benehmen sicher und gebietend wie sonst und sprach er ruhig von der Pflicht des Christen, sich dem Schmerz über den Verlust geliebter Personen oder irdischer Güter nicht hinzugeben, sondern die Aufgaben des Tages zu erfüllen. Solche Grundsätze hatte er namentlich seinem ältesten Sohne Otto vorzuhalten, der sich um den Tod des jüngeren Bruders leidenschaftlich grämte und weder durch Arbeit noch durch Betrachtung oder Musik zerstreuen ließ. Plötzlich aber war der Kummer ohne ersichtliche Ursache ganz erloschen; so fing sein Wesen immer verhängnisvoller an, von einer Übertreibung zur anderen zu schwanken. Das väterliche Gebot der Mäßigkeit überschreitend, betrank er sich in loser Gesellschaft, knüpfte ein Liebesverhältnis mit einer älteren Frau an und ward einmal, aus einem übelberüchtigten Hause heimkehrend, berauscht auf der Gasse gefunden. Der Zorn und Schmerz seines Vaters schmetterte ihn zu tiefster Zerknirschung nieder, doch hinderte das nicht, dass er sich bald darauf neuen Ausschweifungen ergab, was durch den Ausbruch einer Krankheit an den Tag kam. Dem verzweifelten Landgrafen, der mit dem Gedanken umging, dem entarteten Sohne die Nachfolge zu entziehen, rieten die Erzieher Ottos, er möchte den nunmehr Zwanzigjährigen verheiraten und dadurch dem geordneten Leben wieder zuführen; und so wurde denn die Vermählung mit einer badischen Prinzessin so schnell wie möglich eingeleitet und vollzogen. Hoffnungsvoll beteiligte sich Moritz selbst an den Vorbereitungen zur Hochzeit, deren vornehmste Unterhaltung ein Kampfspiel der Babylonia und der Ekklesia, eigentlich der babylonischen Hure und der evangelischen Kirche war, die einander beschimpften und herausforderten. Moritz selbst dichtete und komponierte ein Hochzeitslied, das mit den Worten begann: ›Venus, du und dein Sohn, der, dem ihr gnädig seid, Über der Sterblichen Häupter schreitet er sorglos, ein Gott‹; und wider seinen Willen wurden seine Augen nass, als die ernsten Töne sich in feierlichem Rhythmus über den jungen Vermählten drehten. Auf seinen Wunsch stellte der Pfarrer, der sie traute, ihnen die Bedeutung und die Pflichten der Ehe eindringlich vor und dass sie für einen Fürsten und Landesbeherrscher besonders bindend seien, was auch Eindruck auf Otto zu machen schien. Als jedoch nach einem Jahre die junge Frau im Wochenbette starb, nahm er die anstößige Lebensführung allen Ermahnungen und Drohungen zum Trotz wieder auf. Zwischen den Fürbitten und Ratschlägen der Familie und der Räte beschloss Moritz schleunige Wiederverheiratung, obwohl Otto selbst ihr widerstrebte. Bald sagte er trotzig, dass er die aufgedrungene Frau nicht werde lieben können, dann hatte er Anwandlungen, wo er stundenlang weinte, sich anklagte und sagte, man solle nichts mehr mit ihm versuchen, es sei aus mit ihm, er müsse doch zugrunde gehen.
Im Innersten schwer niedergebeugt, hielt sich der Landgraf abseits von dem Treiben am Hofe und in der Familie, bemühte sich, im Studium der Wissenschaften oder bei den Verwaltungsgeschäften zu vergessen, als ein Verbrechen seinen Blick auf neue Untiefen in seiner Umgebung lenkte. Spät am Abend beim Verlassen des Schlosses wurde Herr von Hertinghausen, ein älterer Mann, durch Rudolf von Eckardsburg, einen schönen, im Umgang angenehmen und besonders bei den Damen beliebten jungen Ritter, ermordet, und zwar, wie sich herausstellte, weil jener eine tadelnde Bemerkung über verliebte Beziehungen des Eckardsburg zur Landgräfin Juliane gemacht hatte. Die Untersuchung ergab nichts, als dass Juliane mit dem von Eckardsburg häufiger als mit anderen getanzt und gern mit ihm geplaudert habe; auch unter der Folter beharrte der Angeklagte dabei, dass nichts Strafbares geschehen und dass er seine Augen nie anders als mit der der Fürstin schuldigen Ehrfurcht auf Juliane gerichtet habe. Diese leugnete gleichfalls jede Schuld sowie auch jede Neigung ab und verlangte, dass Eckardsburg freigelassen werde, da er nur einen Verleumder zur Rettung ihrer Ehre im Zweikampf getötet, nicht gemordet habe. Die Zweifel des Landgrafen wurden nicht beschwichtigt, vielmehr, wie wenig er auch vorher an die Möglichkeit ehebrecherischer Liebe seiner Frau zu einem anderen Manne gedacht hatte, so fest stand ihm jetzt, dass beide wenigstens gegenseitiger Zuneigung schuldig seien. Die Erinnerung vergangener Jahre suchte ihn heim, als die junge Frau des alten Landgrafen Ludwig von Hessen eines Liebesverhältnisses mit einem adligen Herrn beschuldigt wurde und er mit richtendem Eifer die strengste Bestrafung der Angeklagten durchzusetzen suchte. Unter Qualen fragte er sich, ob ihn damals noch ein besonderer Hass gegen die Miterbin des dem Tode nahen alten Fürsten bewegt habe? ob er gegen die eigene Frau blind oder nachsichtiger sein dürfe als damals gegen jene? oder ob die Wut seiner Eifersucht ihm einen Vorwand, Strenge zu üben, zuspielen wollte? Bald dachte er diesen schmachvollen Zustand dadurch zu überwinden, dass er den Eckardsburg dem Martertode preisgab, den das Gesetz für solchen Fall vorschrieb; bald wurde er uneins mit sich, wünschte an die Unschuld seiner Frau zu glauben und forderte von seiner Hoheit und Überlegenheit Verzeihen. Erst nachdem die Geistlichkeit ihm versichert hatte, dass Eckardsburg dem Rechte nach nicht anders als mit dem Tode zu bestrafen sei, und nachdem auch die Richter auf Befragen sich dahin ausgesprochen hatten, es liege kein Anlass, Gnade zu üben, vor, unterzeichnete er das Urteil, nach welchem der Schuldige gerädert werden sollte.
Die Landgräfin hatte bemerkt, was im Herzen ihres Mannes vorging, und aufgehört, zu Eckardsburgs Gunsten zu sprechen; sie war schweigsam und hielt sich in ihren Gemächern. Am Tage vor der Hinrichtung teilte er ihr mit, dass das Urteil unter den Fenstern des Schlosses, als auf dem Schauplatze des Verbrechens, vollzogen werde und dass es sein Wille sei, sie solle der Exekution mit ihm zuschauen zum Zeichen für jedermann, dass sie beide an der Bestrafung eines Missetäters, auch wenn er von hohem Range sei, ein Wohlgefallen hätten. Juliane entschuldigte sich damit, dass ihr nicht wohl sei, weshalb sie schon seit mehreren Tagen das Zimmer gehütet habe; doch da er, den Blick scharf auf sie richtend, sagte, sie habe sich sonst wohl auf seinen Wunsch oder aus eigenem Antrieb zu beherrschen gewusst, entgegnete sie nichts mehr und erschien zur festgesetzten Stunde am Fenster. Sie hörte dünnes Geläut den langsamen Zug verkünden und sah den von zwei Geistlichen geleiteten Verurteilten im langen schwarzen Gewande heranschreiten, das weiche blonde Haar sorgfältig geordnet, hinter ihm rüstige Henker mit Keulen in den muskelstarken Armen. Er zitterte vor Furcht und heimlicher Hoffnung; denn er konnte es doch nicht glauben, dass er, der Schöne und Vielgeliebte, zu einem so gräulichen Tode bestimmt sei. Als er das Rad aufgerichtet sah, auf dem er hingeschlachtet werden sollte, schauderte er und blieb gelähmt stehen, indem er unwillkürlich flehend am Schlosse hinaufsah. Sein Auge begegnete dem starren Blick der Landgräfin, in dem nichts von Gnade zu lesen war, und gleichzeitig stießen ihn die Knechte vorwärts. Juliane stand während der ganzen Zeit aufrecht ohne sich zu rühren: ihre großen dunklen Augen sahen leer auf den menschenerfüllten Platz, und auf ihren schmalen Lippen saß ein schwaches Lächeln.
Am Nachmittage begleitete sie den Landgrafen auf die Jagd und gab sich wie sonst ihrer Lust an wagehalsigem Reiten hin, eine Veränderung in ihrem Wesen höchstens insofern zeigend, als sie ihrem Manne gegenüber schweigsam und von verhaltener Reizbarkeit war.
Zur zweiten Frau seines ältesten Sohnes wählte Moritz ein Mädchen aus der Anhaltischen Familie, das sich besonders durch Vernunft und Frömmigkeit empfahl und mehrere Jahre älter als Otto war. Die junge Frau klagte über nichts, sondern äußerte sich dem Landgrafen gegenüber zufrieden. Einige Monate nach der Hochzeit jedoch wurde Otto am Morgen erschossen im Bette aufgefunden, wahrscheinlich durch eigene Hand gefallen, jedenfalls als ein Opfer seiner lasterhaften Verwilderung.
Nun war Wilhelm, der jüngste Sohn der schönen Agnes, Erbe des Landes. Er war, wenn auch hübsch und fein von Gesicht, ernst und fleißig, doch weniger glänzend begabt als die Brüder und war von seinem Vater stets etwas zurückgesetzt gewesen, freilich ohne dessen Wissen und Willen, der in der Behandlung seiner Kinder auf Gerechtigkeit hielt. Wilhelm suchte die Liebe des strengen Vaters, dem er in bescheidener Zurückhaltung ergeben war, durch Arbeitsamkeit und Pflichteifer zu gewinnen. Seinen zarten Körper stählte er durch ritterliche Übungen und wurde mehr infolge dieser Willenskraft als aus natürlicher Anlage ein tüchtiger Jäger und Soldat.