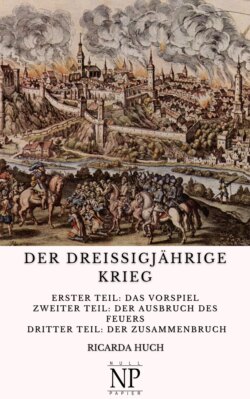Читать книгу Der Dreißigjährige Krieg - Ricarda Huch - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
32.
ОглавлениеUm die Gesinnung des Kurfürsten von Sachsen wegen der böhmischen Thronfolge zu erforschen, begab sich Graf Joachim Andreas Schlick, der ein Jugendgespiele Johann Georgs gewesen war, nach Dresden und erlangte auch nach einigen Weiterungen eine Audienz. Der Kurfürst dachte zwar nicht im Ernst daran, die Krone anzunehmen, wollte sie aber auch nicht geradezu ablehnen, einerseits, weil seine Stände größtenteils böhmisch gesinnt waren, sodann, um sich dem Kaiser kostbar zu machen, der in diesem Streite jedenfalls seiner Hilfe bedurfte. Er empfing deshalb den Grafen nicht allzu freundlich, und als dieser sich dreimal bis auf den Boden verneigte und darauf Gott anflehte, einen so großmütigen Herrn wie den Kurfürsten der Welt, dem Reich und der lutherischen Kirche zu erhalten, nickte er nur beiläufig, ohne den Blick von seiner Beschäftigung wegzuwenden. Auf einem vor ihm stehenden Tischlein nämlich lag ein Haufen sauber geputzter Gänseknochen, welche er auseinanderlas, ans Licht hielt und betastete. Nach einer Weile sagte er zu dem bescheiden wartenden Grafen, er gehe damit um, die Gänseknochen zu verwerten, denn bei einem fürstlichen Haushalt, an dem so viele Mäuler zehrten, müsse Sparsamkeit herrschen, davon hänge das Gemeinwohl ab; daran dächten freilich die adligen Herren nicht, die nur daherkämen, um zu fressen und zu saufen, und nicht fragten, woher es komme; ein gewisses Knöchlein, nämlich das Steißbein, werde verpulvert und komme dann in die Apotheke seiner Frau als ein vorzügliches schweißtreibendes Mittel, für die anderen habe er noch keine Verwendung, aber es werde ihm schon etwas einfallen.
Nachdem er die landesväterliche Fürsorge des Kurfürsten gepriesen hatte, sagte Graf Schlick, er habe als Bube auf dem Gänsebrustknochen blasen können, und wenn es der Kurfürst gestatte, wolle er ihm das Stücklein vormachen. »Ei der Tausend«, rief Johann Georg, als Schlick ausgepfiffen hatte, indem er einen erstaunten Blick auf ihn warf, »ich hätte nicht gedacht, dass du ein solcher Teufelskerl wärest«, hieß ihn sich an seine Seite setzen und ihm das Experiment noch einmal gründlich zeigen. Schlick entschuldigte sich errötend, dass er dem Kurfürsten mit einer bescheidenen Kunst aus der Bubenzeit zu dienen sich unterstehe, es würde gar nichts daran sein, wenn der Kurfürst nicht so gnädig und großmütig zuzuhören geruhe. »Ach was, Schlick«, sagte Johann Georg, »eine blinde Henne darf auch einmal ein Körnlein finden, darum bleibt der Gockel doch Gockel«, und lachte über diesen Spaß, dass ihm die Tränen aus den Augen liefen.
Nachdem somit ein vertraulicher Ton angeschlagen war, brachte Schlick das Gespräch auf die Politik, erzählte von den Kriegsvorfällen, was verfehlt und wie es hätte besser gemacht werden können, und dass die Kalviner mit ihrem tollen Dreinfahren den Karren nur immer tiefer in den Dreck zögen. So erlaubten sie jetzt ihren Bauern, ja ermunterten sie noch dazu, das Fest des Hus zu feiern, obwohl es der Kaiser streng untersagt habe, und mit Recht, da es ein offenkundiger Heiligendienst sei. Er selbst habe den Budowec sagen hören, Hus sei ein Heiliger, weil er sie vom päpstlichen Aberglauben befreit habe, außerdem sei es für die Bauern gleich, ob sie diesen oder jenen Götzen anbeteten, wenn sie nur gehorchten; den wahren Gott, der Christen und Heiden miteinander erschaffen habe, könnten sie doch nicht erkennen. Bei diesen Leuten hätte es oft den Anschein, als ob Doktor Luther gar nicht oder umsonst gelebt habe.
Der Kurfürst schüttelte misstrauisch den Kopf und fragte, was es denn mit dem Hus eigentlich für eine Bewandtnis habe. Nachdem er von Kaiser und Papst öffentlich verbrannt worden sei, schicke es sich nicht für einen treuen Reichsstand, einen solchen Malefikanten zu verehren. Ja, sagte Schlick seufzend, es sei eben die Eigenart der Böhmen, immer wider den Stachel zu löcken; wenn der prächtigste Hut vor ihnen läge, nähmen sie ihn nicht an, um lieber mit ihrer eigenen Narrenkappe zu schellklingeln. Aber, setzte er hinzu, sie fühlten jetzt wohl, dass sie sich nicht selbst aus dem Sumpfe reißen könnten, und wenn ein weiser Fürst an ihre Spitze treten wollte, würden sie es ihm kniend danken.
Der Kurfürst überhörte diese Anspielung, war aber während der Tafel, zu welcher Schlick geladen war, sehr aufgeräumt, erzählte von dem Musikinstrument, das er erfunden habe, und warf dem Hofnarren, der hinter ihm am Boden kauerte, einen Gänsebrustknochen zu, indem er sagte, wenn er ihn rein abnage, solle er noch einen Flügel dazu bekommen. »Und wenn ich ihn aus Versehen auffresse?« fragte der Narr. »So bekommst du zwanzig Stockprügel und wirst einen Tag lang zu den Hunden an die Kette gelegt, weil du Knochen frisst wie ein Köter!« rief der Kurfürst unter dem Gelächter der Gäste. Als das Gänsebein blank war, schwenkte der Kurfürst es gegen Schütz, der die Tafelmusik leitete, und rief ihm über den Tisch zu, er habe ein Blasinstrument erdacht, welches besser töne als die Flöte, die sein alter Heidenprinz Apollo geblasen habe; Schütz solle einmal herankommen und ihn, den Kurfürsten, die Notenschrift lehren, so wolle er ihm jedes beliebige Stücklein blasen, dass Schütz sich verwundern solle. Schütz trat in bescheidener Haltung an den Stuhl des Kurfürsten und sagte, die Noten seien zu harte Nüsse, als dass man sie so eins, zwei, drei zum Nachtisch knacken könnte; aber er sei überzeugt, der Kurfürst könne sich auch ohne Noten auf dem Gänseknochen recht hübsch hören lassen. Johann Georg wusste nicht recht, ob er diese Worte als Schmeichelei oder als Kränkung auffassen sollte, hieß Schlick spielen und sagte zu Schütz in verdrießlichem und spöttischem Tone, die Musikanten und die Apotheker bliesen sich gern auf, als ob sie eine geheime Kunst verständen; aber man wisse wohl, dass Mist und Dreck die beste Medizin wäre und dass Frösche und Vögel schon zu Adams Zeiten Konzerte gegeben hätten. Dann erzählte er, was ihn die Kapelle koste, was für liederliche Kerle die Sänger wären, dass sie geschmiert werden wollten wie kreischende Wagenräder, und wie überhaupt die Hofhaltung täglich kostbarer werde. Er lasse sich die Mühe nicht verdrießen, täglich selbst den Küchenzettel nachzusehen, dies und das zu streichen und darauf zu achten, dass die Überbleibsel gut verwendet würden. Auf diese Weise hätte sein Großvater, der weise Kurfürst August, Sachsen mächtig und ansehnlich gemacht, und dieser Tage sei es noch notwendiger, aufzupassen, wo das neumodische französische Wesen einzureißen anfange. Da kämen schon seine kleinen Söhne, wollten seidene Strümpfe und wohlriechende Handschuhe und wohl gar französische Hofmeister haben und würden Schutz und Förderung bei ihrer Mutter finden, wenn er nicht allen miteinander dann und wann auf die Finger klopfte.
Graf Schlick, der dem Kurfürsten häufig mit dem Becher Bescheid tun musste, brachte seine Gesundheit aus und rief laut, er fordere jeden vor sein Schwert, der behaupten wolle, es gebe einen weiseren, edleren und tapfereren Fürsten als Johann Georg und ein glückseligeres Land als das Kurfürstentum Sachsen, wobei ihm die Tränen über die Backen liefen.
Gegen das Ende des Gastmahls saß Schlick, den Kopf in beide Hände gestützt, und weinte geradeheraus. Ein solcher Fürst, schluchzte er, sei wie ein Leuchtturm am Meere; wenn es brauste und wütete, lasse er beständiges Licht aus und weise den Schiffbrüchigen das rettende Ufer. Wenn nur seinem Vaterlande in diesen bösen Zeiten ein solches fürstliches Licht erstrahlte, so brauchten sie nicht länger wie Waisenkinder ratlos von den wilden Wassern verschlagen zu werden.
Auch dem Kurfürsten fingen die Augen an überzulaufen, und er brüllte, wer von ihm sage, dass er seine Glaubensgenossen verlasse, der sei ein Hundsfott, seinem Jugendgespielen Schlick könne er nichts versagen, er habe ein Herz für alle seine Untertanen, nur die Kalviner wolle er ausrotten, denn sie seien Schelme und vom Teufel gesätes Unkraut.
Nachdem Graf Schlick noch eine Denkschrift eingereicht hatte, in welcher dem Kurfürsten, für den Fall, dass er die böhmische Krone annähme, der Besitz der benachbarten Lausitz angepriesen wurde, auf welche er längst ein Auge geworfen hatte, begab er sich wieder nach Prag, um vom Erfolge seiner Reise Bericht zu erstatten. Im Hause des Grafen Wilhelm von Lobkowitz fand er auch den Grafen Thurn, der vom Kriegsschauplatz hereingekommen war, um Geld zur Bezahlung der unzufriedenen Söldner aufzutreiben. Lobkowitz blätterte mit niedergeschlagener Miene in dem neuen Kalender für das Jahr 1620, welcher kürzlich ausgegeben worden war und in welchem eine böse Aussicht für die nächste Zukunft eröffnet wurde. Was ihn anbelange, sagte Schlick, so bringe er günstigen Bericht. Er sei vom Kurfürsten in langer Audienz empfangen worden und habe gute Vertröstung von ihm erhalten. Ein bestimmtes Versprechen habe der Kurfürst zwar nicht von sich geben wollen, habe aber fest zugesagt, dass er seine Glaubensgenossen nicht im Stiche lassen werde, desgleichen hätten ihm viele Standespersonen und gute Freunde versichert, sie hielten es mit den Lutherischen und nicht mit den Päpstlichen.
Ob es denn nicht an dem sei, fragte Thurn, dass der Hofprediger Hoë eine goldene Gnadenkette vom Kaiser erhalten habe und dass der erste Rat Kaspar von Schönberg im vertraulichen Gespräch gesagt habe, der Kaiser könne wegen des Kurfürsten unbesorgt sein, ihm schmecke ein Täublein, das der Kaiser ihm verehre, besser als ein Huhn, das er ihm aus dem Stall gestohlen habe.
Das sei nur ein Geschwätz, sagte Schlick, sie möchten es wohl mit dem Kaiser nicht verderben, aber sie hätten es ihm gegenüber an freundlichen Bezeigungen nicht fehlen lassen.
Lobkowitz schüttelte den Kopf und sagte, das möchte wohl gut sein, wenn nur der Kalender nicht wäre. Es wäre für Böhmen großes Blutvergießen geweissagt, sowohl der Herren wie der Untertanen, weil man sich die Warnung Gottes durch den Kometen nicht zu Gemüt gezogen habe, sondern in den alten Sünden dahingefahren sei.
Der Komet habe doch nicht über Böhmen allein gestanden, sagte Thurn, die Schultern zuckend; in den sächsischen und österreichischen Ländern habe man ihn auch gesehen, so viel er wisse. Wenn Gott ihren Untergang beschlossen habe, so sei dagegen nichts auszurichten; einstweilen halte er es aber für das beste, sich zu wehren und sich durch böse Zeichen nur desto mehr anspornen zu lassen.
Man könne doch aber auch in sich gehen und sich bedenken, meinte Lobkowitz. Vielleicht sei ihre Rebellion doch Sünde gewesen, und es sei ja noch Zeit, umzukehren.
Wie? rief Thurn aus, umkehren? Den Majestätsbrief und den Glauben und alle teuer erkauften Freiheiten preisgeben? Blut sei einmal geflossen, jetzt gelte es zu siegen, er für sein Teil wolle sich lieber in die Schlacht wagen als in die Hände der rachsüchtigen Jesuiten fallen.
Auch Schlick war der Meinung, man sei zu weit gegangen, um noch zurück zu können, und wenn sie nur erst ein richtiges Haupt hätten, besonders wenn es der Kurfürst von Sachsen wäre, könne noch alles gut werden. Das große Blutvergießen angehend, könne ja auch das Blut ihrer Feinde damit gemeint sein, und obwohl er für seine Person nicht blutdürstig sei, müsse man doch Gott schalten lassen und ihm Beifall geben.
Diese Aussicht ermunterte Wilhelm von Lobkowitz wieder, und die Verhandlungen nahmen ihren Fortgang, wobei freilich die Aussicht, den Kurfürsten von Sachsen zu gewinnen, bald schwand; denn da der Kaiser ihm für seinen Beistand, ebenso wie die Böhmen, den Besitz der Lausitz versprach, fiel auch diese noch in die Waagschale der altbewährten Politik, und über einige von seiner Frau angeregte Gewissensbedenken half ihm der Hofprediger Hoë hinweg, indem er ihm erklärte, ein guter altdeutscher patriotischer Reichsfürst müsse selbst diese zuweilen dem Reichsoberhaupt zum Opfer bringen.