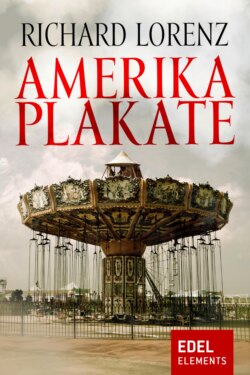Читать книгу Amerika-Plakate - Richard Lorenz - Страница 9
2
ОглавлениеDie späten Siebzigerjahre, in einer kleinen Stadt. Wir hatten hier einen winzigen Supermarkt, eine Bäckerei, einen Metzger, ein Postamt und eine Schule. Zwei Telefonzellen, denen man jedoch nicht sonderlich vertraute (man könnte schließlich eingeschlossen werden). Hier kannte man beinahe jeden, der über die Straße lief – und jedem, den man nicht kannte, begegnete man mit Misstrauen und Argwohn, die durchaus in Feindseligkeiten enden konnten.
Die Leute lebten in gekalkten Häusern, und so gut wie niemand hatte ein Telefon. Im Grunde dachte damals niemand, dass man Telefone im eigenen Haus jemals brauchen würde.
Ein, zwei Mal im Jahr ging ich mit meiner Mutter zum Postamt, um unsere Verwandten in München anzurufen. Die einzige Telefonkabine war so groß wie ein Auto und roch nach feuchter, ungewaschener Haut. Das magische Rattern der Wählscheibe, während ich nach draußen schaute. An den getünchten Wänden die Fahndungsplakate der RAF-Bande, Baader und Meinhof. Leute, die durch die Stadt fuhren, ohne anzuhalten, waren von der RAF, da gab es gar keinen Zweifel. Wir Kinder erwarteten sowieso, erschossen zu werden, bevor wir fünfzehn sein würden. Einmal zu neugierig aus der Tür geguckt, und schon hätte es passieren können. Damals spürten wir, dass sich die Zeit verändern sollte. Gerade so, als wäre ein schlimmes Unwetter aufgezogen; die Wolken standen noch am Himmel, aber niemand ahnte, was danach kommen würde.
Es war unsere Stadt, so viel stand fest. Wir kannten jeden Winkel und jede Ecke, geheime Plätze und verborgene Geheimnisse. Natürlich gab es hier auch ein Gespensterhaus, wie jedes leer stehende Haus in jeder Kindheit ein Gespensterhaus sein konnte. Unseres lag am Ende der Straße, die wie eine tote graue Zunge zu einem Waldstück führte, es durchleckte und nirgendwo endete. Die alte Gantner hatte sich in diesem Haus vor über zehn Jahren in der Küche erhängt. Ihr Mann und ihr Sohn waren von Russland nicht mehr heimgekommen, und von Tag zu Tag war sie seltsamer geworden. Die Leute erzählten, dass es an jedem Todestag der alten Gantner in ihrer schimmeligen Küche regnen würde – es regnete Sterbebilder, wie es hieß. Sterbebilder jener Leute, die in diesem Jahr sterben würden. Natürlich glaubten wir das. Leibrand und ich hatten die alte Frau einige Male am Fenster sitzen sehen, lange nach ihrem Tod. Ein böses dunkles Gesicht, ein zahnloser offener Mund, der unsere Namen flüsterte, so leise, dass wir es nur in unseren Bäuchen hören konnten.
Gerade in den dunklen Herbst- und Wintermonaten erzählten sich die Erwachsenen viele solcher Geschichten. Schwarz-Weiß-Episoden, während das Holz der Öfen knisterte und schnalzte. Von Männern und Frauen, die man im Sarg angenagelt hatte, damit sie nicht wiederkommen konnten. Von Kindern, die nachts über Glasscherben gingen und mit blutigen Füßen auf den Dachsimsen wanderten. Fußspuren im Schnee, die im Teufelsloch endeten, Zwielicht-Gestalten, angeführt von der alten Gantner, die keine Ruhe fand. An Sonntagen war die Kirche voll, und bei jedem Unwetter verspritzte man Weihwasser vor den Türen, um die bösen Geister um Mitternacht zu vertreiben.
Das große Unheil begann in den längsten Sommerferien unseres Lebens, Ende der Siebzigerjahre. Ein heißer Sommer, flirrend die Luft über dem Asphalt. Die Straße, in der ich und Leibrand wohnten, war unsere Straße. Als hätte man sie ausschließlich für uns gelassen, eine schlafende Schlange, die nur darauf wartete, von uns erweckt zu werden.
Wir waren elf Jahre alt, aber Leibrand war immer schon groß gewesen. Ein Junge, der ebenso gut vom Himmel gefallen hätte sein können. Leibrand war nicht so wie wir, nicht wie die anderen Kinder, nicht einmal so wie die anderen Menschen. Er schlief mit den Eidechsen und wachte mit den Wölfen.
Ich kann mich nicht erinnern, wann Leibrand hier gewesen war. In den Nächten scheint es, als wäre er plötzlich von einem auf den anderen Tag aufgetaucht, alleine nur, um die Welt zu verändern.