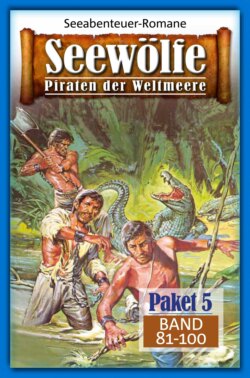Читать книгу Seewölfe Paket 5 - Roy Palmer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.
ОглавлениеDer Rest des Tages verlief ohne weitere Zwischenfälle. Er war nur eine Folge erbitterter Abwehr von Fliegen und Mücken, ein nie endender Kampf gegen Land und Klima.
Als die Sonne immer tiefer sank, machte sich Enttäuschung breit. Sie hatten das Meer nicht vor Einbruch der Dunkelheit erreicht. Sie waren am Ende ihrer Kräfte. Und doch hätten sie lieber noch ein paar Meilen zurückgelegt, als wieder im Dschungel zu rasten.
Die Trommeln der Indios klangen jetzt deutlich und warnend. Die Seewölfe begannen, nach allen Seiten zu sichern. Diese Nacht würde keiner der Posten wagen, auch nur ein Auge zu schließen.
Kurz vor Einbruch der Dämmerung, der sofort in den Tropen die Nacht folgte, befahl Hasard an einem halbwegs geeigneten Platz Halt.
Sie litten keinen Mangel mehr an Wasser. Der nahe Fluß versorgte sie. Es war besser, ein paar Hände Wasser zu schöpfen und den Magen damit zu füllen, als nach Früchten zu suchen und von der Dunkelheit im unzugänglichen Urwald überrascht zu werden.
Die Männer fielen hin, wo sie standen, und schliefen augenblicklich ein, überwältigt von der Müdigkeit, ausgelaugt von den Anstrengungen des ungewohnten Dschungelmarsches, zermürbt von der Hitze und der feuchten Luft, die sich wie ein Schwamm auf die Lunge legte und das Atmen zur Qual werden ließ.
Der Dschungel dampfte vor Feuchtigkeit.
Sie hatten nicht einmal die Möglichkeit, ein Feuer anzuzünden. Der Qualm hätte vielleicht die Insekten ferngehalten, die sich nur zum Teil mit dem scheidenden Tag verabschiedeten.
Die Fliegen verschwanden, und die Moskitos besorgten das Geschäft allein. Immer wieder wurde die Stille von dem Klatschen einer flachen Hand unterbrochen, die versuchte, den Quälgeist zu töten. Dann hatte man kurz Ruhe, bis wieder das feine, metallische Sirren ertönte. Es war ein nervenzerfetzendes Geräusch.
Schwer und traumlos schliefen die Seewölfe.
Mit einer Ausnahme.
Smoky wälzte sich rastlos herum. Er phantasierte ärger als zuvor, wiederholte irgendwelche Segelkommandos und brüllte: „Aye, aye, Sir!“
Die Wachen sahen ständig nach ihm.
Gegen Morgen zog Blacky auf, ein kräftiger Kerl mit Eisenfäusten, der einst sogar versucht hatte, sich mit Hasard anzulegen. Jetzt war er ein Wrack, ein Schatten seiner selbst in zerlumpter Kleidung, von Beulen und Moskitostichen übersät, hungrig und verzweifelt.
Er umrundete die Schlafstellen seiner Gefährten und folgte den ausgetretenen Pfaden seiner Vorgänger. Viel Bewegungsfreiheit hatte niemand im Dschungel.
Langsam wurde es hell über den Wipfeln. Immer mehr Einzelheiten schälten sich aus dem Dunkel der Nacht.
Blacky spürte den gleichen Juckreiz an der Wange wie schon so oft. Mechanisch langte er ins Gesicht und kratzte sich. Dabei öffnete er die Beule auf seiner Wange.
Er wischte die austretende Flüssigkeit weg und betrachtete seine Hand.
Sein Schrei ließ die Schläfer hochfahren.
Fassungslos starrte Blacky auf seine Hand.
Die Fingerspitzen wimmelten von feinen beweglichen Maden, die sich in seinem Fleisch eingenistet hatten. Wie wahnsinnig fegte Blacky herum, suchte angstschlotternd nach dem Kutscher und war nicht in der Lage, eine klare Frage zu beantworten.
Sehr schnell erübrigte sich das.
Die Panik kannte keine Grenzen.
Würmer, wohin man schaute. Sie hatten nachts ihr Zerstörungswerk begonnen. Jede offene Wunde wimmelte von ihnen. Sie hatten sich überall ausgebreitet.
Insekten hatten in den zerschundenen Leibern der Seewölfe ihre Eier abgelegt. Kaum einer war verschont geblieben. Die Maden, gereift in der schwülen Tropenhitze, fraßen die Männer bei lebendigem Leibe auf, wenn sie sich nicht schleunigst gegenseitig halfen.
Ein großer Teil des Morgens ging mit der Säuberungsaktion verloren. Jeder half jedem.
Das Grauen packte die Männer.
Niemand wußte, was nächste Nacht werden sollte.
„Wir verfaulen bei lebendigem Leibe!“ schrie Luke Morgan entsetzt. „Wir sind hilfloser Fraß für die Maden.“
„Reißt euch zusammen, Männer“, mahnte Hasard unerschüttert. „Wir erreichen das offene Meer. Dafür verbürge ich mich. Das Salzwasser wird mit dieser Plage schnell aufräumen.“
„Außerdem haben wir die gröbsten Schäden beseitigt“, tröstete der Kutscher die Verzweifelten.
Sie brachen auf.
Es war eher eine überstürzte Flucht. Niemand brauchte mehr angetrieben zu werden. Niemand verlangte nach einer zusätzlichen Rast. Sie flohen wie von Sinnen vor der Gefahr, bei lebendigem Leibe ein Fraß der Maden zu werden. Ihr Heil lag am Meer.
Aber wo war die offene See? Keine frische Brise kündigte sie an, kein Brandungsgeräusch.
Verloren wankten sie durch die Fieberhölle. Kaum, daß jemand etwas Eßbares suchte, um den grimmigen Hunger zu stillen.
Nur der unverwüstliche Pete Ballie erlaubte sich einen makaberen Scherz.
„Kehren wir doch den Spieß einfach um“, schlug er vor. „Würmer kann man essen, oder? Wir züchten uns den eigenen Proviant.“
Niemand reagierte auf die Bemerkung.
Die Männer waren viel zu abgestumpft. Die Katastrophe drohte.
Sie gingen nicht mehr, sie taumelten und torkelten wie Betrunkene auf Landgang. Immer mehr zog sich die Kolonne auseinander.
Hasard hatte alle Mühe, die Männer zusammenzuhalten. Denn war erst einmal die Verbindung abgerissen, würde man sich in dieser Endlosigkeit nie wieder finden.
Und was den Versprengten drohte, das schienen die Trommeln anzukündigen. Es war, als habe sich ein Kreis geschlossen.
Überall lärmten die Indios.
Sie selbst sah niemand. Aber sie waren da, unüberhörbar. Das monotone Wummern der Signaltrommeln wurde zu einer zusätzlichen Folter auf dem Todesmarsch der Seewölfe.
Den Spaniern waren sie entwischt – um hier bei lebendigem Leibe zu verfaulen oder im Kochtopf der Indios zu landen?
„Die warten nur, bis die Würmer in uns schön fett und rund sind“, sagte Pete Ballie mit Galgenhumor. Aber er war der einzige, der über diese Bemerkung lachte.
Apathisch setzten die anderen ihren Weg fort.
Das geringste Hindernis schon ließ sie stolpern. Ihre Gesichter waren unförmig, die Augen gerötet und geschwollen.
Fast jeder spielte mit dem Gedanken, aufzugeben, sich fallen zu lassen, eins zu werden mit der modernden grünen Hölle, die alles verschlang, alles überlebte, alles überwucherte.
Hasard hatte wirklich alle Hände voll zu tun, um seine Männer in Trab zu halten. Wo Ermahnungen nichts nutzten, wandte er Gewalt an. Ein paar Backenstreiche brachten mehr als einen, der bereits versinken und untergehen wollte, wieder zur Besinnung und zwangen ihn, seine letzten Kraftreserven zu mobilisieren.
Zwischendurch prasselte ein Tropengewitter nieder. Der Regen brachte keine Erfrischung. Der Wald verwandelte sich in eine Waschküche.
Sie rutschten und stolperten durch Pfützen, Morast und schleimiges Grün, bis die Kräfte versagten. Die Männer warfen sich hin. Nichts konnte sie mehr auf die Beine treiben.
Hasard, Ferris Tucker, Carberry und Ben Brighton liefen auf und ab wie die Wachhunde, packten diesen oder jenen am Kragen, schleppten ihn ein paar Schritte weiter und brüllten ihn an. Aber sobald sie den armen Kerl losließen, um sich dem nächsten zu widmen, kippte er um und blieb regungslos liegen, erschöpft, fix und fertig, am Ende.
Die meisten vermochten den Sturz nicht einmal mehr mit den Händen abzufangen. Sie landeten auf dem Gesicht. Trübe Regenbrühe spritzte hoch. Mit einem wohligen Stöhnen wälzte sich der Mann zurecht und war nicht mehr aufzuwecken.
Selbst wenn ihnen Musketenfeuer gedroht hätte, sie wären lieber gestorben, als noch einen Schritt zu laufen.
Hier und da waren sie im Fluß an Egel geraten. Die Tiere hingen vollgesogen und fett bis zum Platzen an ihren Waden. Niemand bereitete sich die Mühe, sie zu entfernen, zumal der Kutscher davor warnte.
„Laßt das, Leute“, sagte er. „Ihr reißt die Viecher nur durch. Die Köpfe bleiben im Fleisch und rufen bösartige Entzündungen hervor.“
Er hatte das ernst gemeint.
Aber was konnte ihnen noch schaden, was konnte sie überhaupt noch schrecken?
Sie waren durch alle Höllen gegangen. Vor wie vielen Tagen hatten sie eigentlich die letzte Nahrung zu sich genommen?
Sie lagen am Boden.
Verzweifelt hockte sich Hasard nieder. Er wußte auch nicht mehr weiter und fühlte sich am Ende.
Das Dröhnen der Trommeln rückte näher.
Der Klang schien an Stärke und Intensität zuzunehmen. Er füllte die Nacht aus, übertönte die Tierstimmen und verscheuchte das Wild.
Die Indios mußten ganz nahe sein.
Hasard schaute sich um.
Er erwartete jede Sekunde einen Angriff. Aber wie sollte er sich wehren? Sie hatten keine ernstzunehmenden Waffen.
Kein Fluchen und Toben der Besonnenen brachte die Erschöpften wieder auf die Beine, nicht einmal der Hinweis, daß die Küste nicht mehr fern sei.
Hasard beschwor die Vision einer „Isabella“, die nur darauf wartete, sie wieder an Bord zu nehmen.
Die Seewölfe seufzten nur. Sie träumten von nichts anderem. Aber was nutzte es? Die Tatsachen redeten eine andere Sprache.
Sie hockten hier im Dschungel, weit ab von ihrem stolzen Schiff, von Beulen und Stichen übersät, in der Gefahr, bei lebendigem Leib zu verfaulen oder von Maden gefressen zu werden, ohne Nahrungsmittel, umzingelt von Eingeborenen. Keiner konnte voraussagen, was wirklich geschah, wenn sie ihnen begegneten. Und an der Küste warteten die Spanier.
Das war die Wirklichkeit.
Die „Isabella“ war nur ein schöner Traum und würde es wohl auch bleiben.
„Wenn ich nicht bald was zwischen die Zähne kriege, drehe ich durch“, brummte selbst der Profos.
„Ich könnte mich nicht einmal vor den Indios verstecken“, pflichtete ihm Big Old Shane bei. „Die müßten mich bei meinem knurrenden Magen sofort entdecken.“
Ben Brighton, Hasards Stellvertreter und erster Offizier, ein zuverlässiger ruhiger Mann, biß die Zähne zusammen. Er war ein hervorragender Seemann, aber ein weniger guter Marschierer, ein mutiger Kämpfer, aber nicht immun gegen die Strapazen dieses Todesmarsches durch die Fieberhölle von Guayana. Er fürchtete weder Entermesser noch Belegnägel noch Degenspitzen, aber dieser Urwald mit seinen tückischen Gefahren konnte den besten Mann zermürben.
Matt Davies mit seiner Hakenhand benutzte die Prothese auf abenteuerliche Weise. Er wanderte mit unsicheren Schritten von Baum zu Baum. Der Eisenhaken fetzte die Rinde herunter. Was auch immer Matt suchte – manchmal führte er die gesunde Hand zum Mund und kaute, spuckte aber gleich darauf angewidert aus. Die Kerbtiere, die er entdeckt hatte, waren ungenießbar oder sogar giftig.
Hasard rief Davies zur Ordnung.
„Wir haben bereits genug mit Smoky zu tun. Einen zweiten Kranken können wir uns nicht leisten.“
Matt Davies kehrte um.
„Ich weiß nur eins: wenn ich nicht bald was zwischen die Kiemen kriege, geh ich ein“, sagte er. „Möglich, daß ein Mensch sieben Tage und mehr nichts zu essen braucht – wenn er bequem in seiner Koje liegt. Aber wir verbrauchen dauernd Kraft, um uns durch diesen verdammten Dschungel zu quälen. Und die Tortur nimmt kein Ende.“
„Morgen ist so oder so alles zu Ende“, antwortete Al Conroy. „Wenn wir morgen die Küste nicht erreichen, schaffen wir es nie.“
Die Männer schliefen während der Rast nicht mehr. Sie litten an nervöser Erschöpfung. Sie fanden keine Ruhe mehr – wie Tiere, die den Tod instinktiv spüren.
Jeder suchte nach Eßbarem, nach Wildfrüchten vielleicht oder nach Taubeneiern oder besser: nach fetten Nestlingen. So etwas mußte es hier doch auch geben. Aber man entdeckte nichts. Die Unergründlichkeit dieser Urwaldlandschaft erdrückte einen. Man ging darin unter wie die Fliege im Milchtopf. Man konnte den Kopf verdrehen wie man wollte, in diesem Gewirr von regennassen Blättern, Farnen und moosigen Baumstämmen konnte man keine Einzelheiten erkennen. Das verschmolz alles zu einer Sinfonie aus Grün, hier und da bereichert von einer bunten Blüte.
Die Seewölfe wären sogar einverstanden gewesen, einem Rudel der gefürchteten Pekaris zu begegnen, jenen Wildschweinen, die beim geringsten Zeichen von Gefahr nicht etwa flohen, sondern, auf die Macht der größeren Zahl vertrauend, sich augenblicklich formierten und dann angriffen.
Aber die Seewölfe erhielten keine Chance, die wirkliche Gefährlichkeit dieser Tiere auf die Probe zu stellen. Sie ließen sich nicht blicken.
Stenmark, der große blonde Schwede, entfernte sich weiter vom Rastplatz als alle seine Gefährten. Er schlich durch die Wildnis und hatte die Augen überall. Er hätte selbst Papageiennisthöhlen geplündert – wenn er nur welche gesehen hätte.
Überall war lautes, huschendes Leben, aber es gab nichts zu sehen. Ein Seemann war in dieser unbändigen Natur verloren, nicht gerüstet, hier zu überleben. Sein Revier war die weite See, nicht die dampfende Fieberhölle von Guayana.
Stenmark arbeitete sich durch das Unterholz.
Er achtete nicht mehr auf die wütenden Attacken der Moskitos. Myriden von Quälgeistern erhoben sich aus schlammigen Pfützen, verließen ihre Verstecke unter den Farnblättern und stürzten sich auf ihr Opfer, um sich vollzusaugen.
In einem weiten Halbkreis bewegte sich Stenmark.
Er drang bis zum Fluß vor. Dies war die letzte Möglichkeit, auf etwas Nahrhaftes zu stoßen. Ihn trieb der Gedanke, es könnte eßbare Fische geben. Also näherte er sich dem Ufer und wanderte stromaufwärts. Er wußte, daß er Geduld haben mußte.
Der Boden war feucht und modrig. Bisweilen schwankte er unter den Füßen. Überall entdeckte Stenmark Tierspuren. Sie mochten daher rühren, daß alle Lebewesen des Dschungels, selbst der scheue Tapir, irgendwann am Fluß tranken.
Der Leguan wurde Stenmark zum Verhängnis.
Die grüne Echse lag regungslos auf einem starken Ast und lauerte auf Beute – Fressen und Gefressenwerden, das Gesetz des Dschungels.
Stenmark lief das Wasser im Mund zusammen.
Er wußte, daß Leguane wegen ihres schmackhaften Fleisches mit Vorliebe von den Indios gejagt wurden. Dieser hier war ein Prachtexemplar, groß genug, um jedem der Seewölfe eine Handvoll Nahrung zu liefern und die Mägen aller, wenn schon nicht zu sättigen, so doch wenigstens zu beschäftigen.
Stenmark bewegte sich langsam weiter.
Er fror trotz der Hitze bei dem Gedanken, daß die Echse ihn rechtzeitig bemerken könnte. Wie schnell diese Tiere waren, konnte er sich vorstellen. Dabei stellten ihre Klauen Waffen dar, die sie zwar nicht bewußt zum Kämpfen benutzten, sondern eher zum Ersteigen der Bäume, aber wehe dem, der mit ihnen in Berührung geriet. Selbst Lederkleidung würde diesen Krallen kaum widerstehen, geschweige denn nackte Haut.
Stenmark wußte, daß ihm ein mörderischer Kampf bevorstand. Er hatte keine Waffe, nicht einmal ein Messer. Er mußte mit bloßen Händen zupacken, das Tier festhalten und versuchen, es zu töten. Aber er mußte aufpassen, daß es ihm nicht in letzter Sekunde entwischte, sonst wurde nichts aus dem Festmahl.
Der Leguan beobachtete den Fluß.
Die schwärzliche Zunge fuhr unruhig hin und her, aber der grüne grobgeschuppte Leib bewegte sich nicht.
Stenmark konnte seinen Blick nicht von der Beute reißen. Er achtete nicht auf den Weg, sondern setzte nur behutsam einen Fuß vor den anderen, ängstlich darauf bedacht, nicht zu stürzen oder ein Geräusch zu verursachen.
Er achtete kaum darauf, daß er manchmal bis zu den Knöcheln im Schlamm des Ufers versank.
Und dann passierte es.
Ein Fehltritt! Stenmark ruderte mit den Armen, weil er plötzlich den Halt verlor. Dabei starrte er noch immer auf den schönen fetten Leguan.
Die Echse nahm gar keine Notiz von ihm, das brauchte sie auch nicht, weil der Angreifer in ganzer Länge hinschlug und sofort begann, im Schlamm zu versinken.
Jahrelang hatte der Fluß hier seinen Unrat abgeladen. So war eine Uferausbuchtung entstanden, die sich mit einem schwärzlichen, stinkenden Schlick gefüllt hatte.
Stenmark kämpfte um sein Leben.
Weder konnte er auf allen vieren zurückkriechen, noch fand er überhaupt Halt. Arme und Knie versanken. Der Grund gab nach.
Erschreckt flogen bunte Schmetterlinge davon, die auf diesem feuchten Uferstreifen, der nur bei Flut unter Wasser geriet, ihren Durst gestillt hatten.
Siedendheiß durchzuckte Stenmark der Gedanke, wie weit er sich bereits von seinen Gefährten entfernt haben mußte.
Er war allein. Und er konnte sich nicht helfen.
Stenmark begann zu schreien. Seine Stimme wurde von dem grünen Meer geschluckt. Es hatte keinen Sinn. Und doch mußte er brüllen. Es brachte nichts, aber seelenruhig dem eigenen Ende zuzuschauen, brachte der Schwede nicht fertig.
Er stellte fest, daß er schneller versank, wenn er sich bewegte. Also rührte er sich nicht mehr.
Er lag nur zwei Schritte vom Rand dieser tödlichen Falle entfernt und konnte doch nichts unternehmen.
Er stützte sich mit den Armen ab und beobachtete fassungslos, wie sein Gesicht sich immer mehr dem schwarzen Brei näherte, der ihn spurlos schlukken würde. Schon reichte ihm der Morast bis zu den Ellenbogen. Er hockte auf der tückischen Fläche und versank wie ein vor Schreck erstarrter Frosch.
Die ganze Zeit schrie Stenmark.
Niemand antwortete ihm.
Aber irgendwann wurde es dem Leguan zu dumm. Er lief den Ast entlang, stürzte kopfüber ins aufspritzende Wasser und verschwand aus dem Gesichtskreis Stenmarks.
Noch ein paar Minuten zuvor hätte Stenmark bei einem solchen Zwischenfall hemmungslos geflucht. Jetzt dachte er nicht mehr daran, sich den Magen vollzuschlagen. Er hatte andere Sorgen. Es ging ums Überleben, wobei er sehr wohl ahnte, daß sein Leben keinen Pfifferling mehr wert war.
Hierher würde niemand versuchen, sich durchzuschlagen. Warum auch? Die anderen brachen ihre Jagd nach Nahrungsmitteln sicher wesentlich früher ab und kehrten zurück ins Camp, um nicht unnötig Kräfte zu verschwenden.
Nur er, Stenmark, mit seiner verdammten schwedischen Zähigkeit, hatte sich soweit verirren müssen. Jetzt erhielt er die Quittung.
Er verzweifelte, als ihm der Morast bis zum Kinn reichte. Er legte den Kopf in den Nacken, um das Ende herauszuzögern.
Sein Gebrüll wurde noch dringlicher. Todesangst verlieh ihm übermenschliche Kräfte. Aber was nutzte das? Dieser Schlick war nicht durch Kraft zu besiegen. Er arbeitete still und geduldig am Untergang seiner Opfer.
Da bewegten sich Zweige.
Stenmark wurde aufmerksam.
„Hier bin ich!“ schrie er, fast wahnsinnig vor Angst. „Hier.“
Niemand antwortete ihm.
Seine Enttäuschung war grenzenlos. Hatte ihn ein Tier genarrt? Hatte ein Jaguar mit feinem Instinkt gemerkt, daß hier eine leichte Beute wartete? Sollte er sich nur anpirschen und springen. Dann konnte er gleich mitversakken.
Schadenfreude erfüllte Stenmark. Der Gedanke, seinen Mörder mit in das feuchte Grab zu reißen, erfüllte ihn mit einer unglaublichen Befriedigung.
Vielleicht kürzte der Jaguar auch das Verfahren ab. Alles schien besser als dieser langsame qualvolle Tod durch Ersticken.
In seiner Not bewegte sich Stenmark und beschleunigte prompt seinen Untergang.
Da klatschte etwas vor ihn in den Sumpf – eine lange Liane.
Stenmark begriff seine Chance. Er riß die Arme hoch, um sie aus dem Schlamm zu befreien. Schmatzend gab die saugende zähe Masse nach.
Stenmark erwischte den Rettungsstrick, geriet dafür aber mit seinem Hinterteil in Bedrängnis und verschwand bis zu den Oberschenkeln im Morast.
Er kümmerte sich nicht darum.
Er begann, sich an Land zu ziehen.
Niemand half ihm, niemand erwartete ihn. Stenmark stand vor einem Rätsel. Die Liane war doch nicht vom Himmel gefallen!
Er verschob die Lösung dieses Rätsels auf später. Ihn erfüllte eine tiefe Genugtuung. Er war dem Tod von der Schippe gesprungen. Auch wenn es eine unerhörte Anstrengung bedeutete, sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf auf das feste Land zu retten, so wußte er doch, daß er nicht aufgeben würde. Er spielte nicht einmal mit diesem Gedanken. Ihm saß die kalte Todesangst im Nacken.
Mit einem kräftigen Ruck brachte er sich endgültig in Sicherheit. Erst jetzt, ausgepumpt, atemlos, mit flimmernden Sternen vor Augen, konnte er sich gehen lassen.
Aber nicht lange.
Schon warnte ihn das Gehirn vor einer noch größeren Gefahr als der, der er soeben mit fremder Hilfe entronnen war. Was, wenn jetzt die Indios angriffen, weil er völlig erschöpft war? Er fuhr hoch und drang in das Gewirr von Zweigen und Blättern ein.
Der Dschungel mit seinem Treibhausklima hatte ihn wieder. Am Fluß hatte er, wohl weil das Meer nahe war, besser und freier atmen können. Jetzt rang er wieder nach Luft.
Stenmark bemerkte keine Menschenseele.
Er suchte nach Spuren und fand die Abdrücke nackter Füße. Kein Zweifel: er hatte Kontakt mit den Wilden gehabt. Aber sie hatten ihn keineswegs umgebracht, sondern diskret gerettet und sich dann überstürzt zurückgezogen. Weil sie Angst hatten?
Stenmark mußte lachen.
Nach den Fährten zu urteilen, hatte sich mindestens eine Horde von zwölf Wilden an ihn herangeschlichen. Womöglich hatten sie ihn auf seinem einsamen Marsch durch die Wildnis heimlich begleitet, ohne ihm einen Hinterhalt zu stellen oder nur einen einzigen Giftpfeil abzuschießen. Also waren sie friedlich, es drohte von ihnen keine Gefahr. Vielleicht konnte man bei ihnen Nahrungsmittel eintauschen?
Der Gedanke brachte Stenmark in Trab.
Er reinigte sich flüchtig von dem gröbsten Schmutz. Der Schlamm bedeckte in einer grauen, schnell erstarrenden Masse seinen Körper wie ein spanischer Harnisch. Jetzt brach die Kruste und bröckelte ab.
Stenmark setzte sich in Bewegung.
Er versuchte, den eigenen Spuren zu folgen. Das war keine leichte Aufgabe in diesem grünen Einerlei, das sich hinter jedem Lebewesen wie eine Mauer schloß.
Stenmark fing bald an, nach seinen Gefährten zu rufen. Erkennen konnte er nichts. Er war nicht einmal mehr ganz sicher, ob er den richtigen Kurs hatte.
Aber da erklang, ganz dünn und fern, Antwort.
Die Verbindung war wieder hergestellt.
Stenmark war den Tränen nahe vor Glück. Er hatte zweimal an diesem Tag Glück gehabt. Da war ihm vor der Zukunft nicht mehr bange.