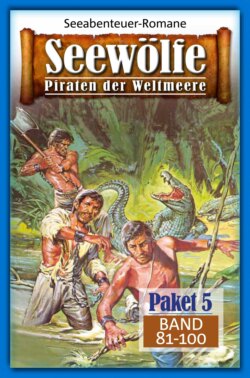Читать книгу Seewölfe Paket 5 - Roy Palmer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8.
ОглавлениеIm Lager war nach dem Abmarsch von Hasards Gruppe Smokys Fieber wieder gestiegen.
Der Decksälteste sah zum Fürchten aus. Schmutzig, zerstochen und abgezehrt lag er auf seinem Lager aus Palmblättern und Farnkraut.
Die verletzte Schulter war bis zur Unkenntlichkeit geschwollen. Smoky konnte sie nicht mehr bewegen. Er lag apathisch da und ließ sich immer wieder Wasser einflößen. Sein Durst war grenzenlos. Flüssigkeit war das einzige, was ihn noch interessierte.
Der Kutscher lief sich die Hacken ab, um den Verwundeten zu versorgen. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit drang niemals ein Fluch über seine Lippen.
Besorgt tastete er die Wunde ab. Smoky brüllte wie am Spieß. Als der Kutscher ihm riet, auf ein Stück Holz zu beißen, tat er es.
Der Kutscher schüttelte den Kopf.
„Sieht böse aus“, murmelte er. „Wenn wir nicht schneiden, gehst du drauf. Dann stirbst du in den nächsten drei Tagen.“
„Weiß ich selbst“, keuchte Smoky. „Tu, was du willst. Meine Erlaubnis hast du. Alles ist besser, als hier zu liegen und bei lebendigem Leibe zu verfaulen. Denn darauf läuft es doch hinaus. Mann, muß da Eiter drin sein. In der Wunde klopft es wie verrückt.“
Der Kutscher nickte nur. Die Wundränder, gezackt und verformt, und die Wunde selbst glühten.
„Ich tu mein bestes, Smoky“, versprach der Kutscher. „Aber ob du es überlebst, weiß ich nicht. Sicher bin ich nur, daß du tot bist, wenn ich nicht schneide.“
„Beeil dich, damit ich es hinter mir habe“, stieß Smoky hervor. „Wie konnte ich auch nur so‘n Pech haben. Alle kommen durch, nur mir verpassen die Dons ein Ding, das sich gewaschen hat.“
Der Kutscher schaute Smoky ernst an. „Ich vermute, da steckt noch ein Stück Blei drin. Wenn wir das herausgeholt haben, geht es dir gleich besser. Dann bist du in einer Woche wieder munter.“
„Hoffentlich.“
Der Schmerz der Untersuchung hatte Smoky bereits die Tränen in die Augen getrieben. Wenn jetzt geschnitten wurde, konnte er sich ausmalen, was geschah. Er würde vielleicht vor Schmerzen ohnmächtig werden.
„Besser, du fesselst mir die Hände“, forderte Smoky. „Sonst knall ich dir noch eine, wenn ich überschnappe.“
„Du hast recht“, sagte der Kutscher und winkte den drei Männern, die zurückgeblieben waren. Er wies seine Hilfskräfte ein.
Will Thorne, der alte Segelmacher, nahm Smokys Beine und setzte sich darauf. Jeff Bowie, der links eine Hakenprothese hatte, stützte sich auf die gesunde Schulter des Decksältesten und hielt ihm zugleich den Kopf fest.
Der dritte Mann, Bob Grey, setzte sich auf den Bauch Smokys, während der Kutscher sich neben ihn kniete. Vorsichtig setzte er das Messer an. Die Klinge drang leicht ein. Als Smoky aufbrüllte, war sie schon fast einen Inch eingedrungen. Blut und Eiter schossen aus der Wunde.
Smoky brüllte wie am Spieß und bäumte sich auf. Die drei Männer hielten ihn mit Gewalt fest.
Ein paarmal mußte der Kutscher aufhören, in der Wunde zu sondieren, weil Smoky sich zu stark bewegte.
Aber dann fischte er doch aus der Wunde ein gezacktes Stück Blei heraus. Er betastete noch einmal die Wunde und konnte nur hoffen, daß Smoky nicht noch mehr Blei kassiert hatte. Aber es sah nicht so aus.
Sie erneuerten den Verband, so gut es ging.
Jeder opferte ein Stück von seinem Hosenbein, zuunterst wurde eine Lage sauberer Blätter plaziert. Geschmeidige Lianen hielten das Ganze.
Smoky wollte nicht mehr leben. Er wimmerte nur noch. Aber dann fing er sich wieder.
„Deine stärksten Augenblicke waren die, in denen du ohnmächtig warst“, sagte der Kutscher grinsend und wischte die blutige Klinge sauber. „Ich bin zwar kein richtiger Arzt, aber ich möchte behaupten, daß du es schaffst.“
„Wenn alles umsonst gewesen ist, verfluche ich dich bis in alle Ewigkeit“, drohte Smoky.
Daß der Decksälteste schon wieder aggressiv wurde, schien eigentlich ein gutes Zeichen.
Smoky lag jetzt ganz ruhig.
Noch tobte das Fieber, aber sicher klang es mit der Zeit ab. Die Krise mußte gegen Abend eintreten. Wenn er am Morgen noch lebte und sein Zustand sich nicht entscheidend verschlimmert hatte, war er über den Berg.
„Nach der Aufregung könnte ich einen Rum gebrauchen“, stöhnte der Kutscher. „Aber wir haben ja nichts. Nicht mal was zu essen.“
„Wenn das so weiter geht, fange ich an, Gras zu fressen“, meinte Bob Grey. „Ob Hasard etwas aufgestöbert hat?“
Sie machten sich gegenseitig den Mund wässerig, indem sie sich ausmalten, welche Köstlichkeiten Hasard erbeuten würde. In ihrer Vorstellung marschierte eine lange Reihe zerlumpter Seewölfe durch den Dschungel, beladen mit frischem Fleisch und riesigen wohlschmekkenden Früchten.
Die Wirklichkeit sah grau aus.
Als Hasard und seine Männer tatsächlich zum Lager zurückkehrten, hatten sie nur wenig zu bieten. Gelbe und grüne Früchte, einige groß wie Papayas, andere wie Melonen. Und eine Handvoll merkwürdiger Maden, eingewickelt in ein Palmblatt und überreicht wie eine Köstlichkeit.
Hasard sah sofort nach Smoky. Er stellte fest, daß das Fieber nicht mehr so wütete.
„Du hast die Zeit gut genutzt, Kutscher“, lobte Hasard.
„Du nicht. Du rennst Meile um Meile durch den verdammten Urwald und findest nur ein paar scheußliche Maden, die kein Christenmensch essen kann“, jammerte der Kutscher. „Warum bist du überhaupt so weit gelaufen? Diese Dinger hättest du hier auch finden können. In diesem verfaulten Baumstamm. Da leben Millionen. Aber ich wäre nie darauf verfallen, die auch zu essen.“
Die Mitteilung des Kutschers löste eine lebhafte Jagd aus. Wer seinen Abscheu und seinen ersten Ekel überwunden und die Maden gekostet hatte, wollte sich gern eine Extraration beschaffen. So beschäftigten sich die rauhen Seewölfe den Rest des Tages damit, die Würmer zu finden, die sie bei den Indios kennengelernt hatten. Wer einen fand, stopfte ihn schleunigst in den Mund.
Dann gingen sie zur Ruhe über.
„Morgen sind wir an der Küste, Leute“, gelobte der Seewolf.
Der Hunger trieb sie zeitig wieder hoch.
Sie marschierten jetzt, so schnell ihre Kräfte es erlaubten, der Küste entgegen. Eine weitere Berührung mit den Indios hatten sie nicht. Aber sie hatten gelernt, wie man sich aus dem Lande ernähren konnte. So geschah es immer wieder, daß Männer zurückblieben, um morsche Baumstämme nach Nahrung abzuklopfen.
Matt Davies und Jeff Bowie mit ihren stählernen Armprothesen brachten es zu einer Meisterschaft im Schälen von Holz und dem Aufbrechen gewinnträchtiger Gänge und Bohrlöcher.
Sie gaben von ihrem Überfluß ab.
Einer, der sich gar nicht mit dieser Kost anfreunden mochte, grub in seiner Verzweiflung Wurzeln aus und probierte sie. Sie schmeckten bitter. Er versuchte erst wenig und wartete die Wirkung ab. Als er sicher sein durfte, sich nicht vergiftet zu haben und auch andere unangenehme Reaktionen des Körpers ausblieben, verriet er sein Rezept und fand Nachahmer.
Das einzig Erfreuliche war, daß Smoky sich wesentlich besser fühlte. Bei richtiger Ernährung wäre er schnell wieder auf den Beinen gewesen. So aber, doppelt entkräftet, blieb er auf seine Gefährten angewiesen, denen es immer schwerer fiel, ihn mitzuschleppen.
Das Tempo der Kolonne blieb bescheiden.
Noch immer schien das Ende der grünen Hölle nicht erreicht. Jeder Schritt im Dschungel mußte erkämpft werden.
Die Axt Ferris Tuckers war mittlerweile fast unbrauchbar. Stumpf geworden, schnitt sie nicht mehr, sondern zerschmetterte – eine Methode, die wesentlich mehr Kraft erforderte. Und genau die hatten die Seewölfe nicht mehr. Die Schnelligkeit der Gruppe aber hing davon ab, wie gut der Mann an der Spitze vorwärtskam.
Hasard fiel eine geniale Lösung des Transportproblems ein. Er ließ für Smoky ein Floß bauen. Eine Schicht dürrer Äste wurde auf zwei parallele Baumstämme geschichtet. Lianentaue verbanden die beiden Querhölzer. Sogar ein Haltetau flocht Will Thorne.
Smoky wurde auf das primitive Wasserfahrzeug gelegt und von da an geflößt.
Er erhielt sogar einen wichtigen Auftrag. Er mußte von Zeit zu Zeit das Wasser prüfen, das ihn trug. Aber nie konnte er melden, daß der Salzgehalt zunahm und damit die Küste näher gerückt war.
Die Sicht im Urwald war so beengt, daß niemand voraussagen konnte, ob sie wirklich auf direktem Kurs die Küste ansteuerten.
Die Hitze setzte ihnen zu.
Selbst der eiserne Carberry zeigte erste Anzeichen beginnender Demoralisierung. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und knurrte: „Es wird Zeit, daß wir die Küste erreichen. Sonst lege ich mich hin und sterbe.“
„Reiß dich zusammen“, befahl Hasard. „Wir müssen immer daran denken, den anderen ein Vorbild zu sein. Aufgeben möchte jeder. Solange wir uns aber weiterschleppen, wagt es niemand. Verstehst du? Einer stützt den anderen. Aber wehe, der erste gibt auf. Das wäre wirklich das Ende. Du brächtest keinen mehr auf die Füße. Die Kerle lassen sich zu Boden sinken und erheben sich niemals mehr. Kaputt genug sind wir schließlich alle. Ich möchte auch lieber sterben, als weiter durch diese Wildnis zu ziehen. Die Farbe Grün kann ich für den Rest meines Lebens nicht mehr sehen.“
Sie stolperten weiter.
Und dann ertönte ein Schrei von Dan. Er war den Stamm einer schiefen Palme hochgestiegen, um einen besseren Überblick zu gewinnen und einmal weiter sehen zu können als bis zum nächsten Busch, zum nächsten Baumstamm oder gar bis zum roten verschwitzten Genick des Vordermannes.
„Was siehst du, Dan?“ fragte Hasard erregt.
Er konnte eine gute Nachricht gebrauchen, er und jeder Mann. Dieser Tag mußte sie an die Küste bringen, oder sie konnten morgen vor Erschöpfung nicht einmal mehr kriechen. Ihre Füße waren von Geschwüren übersät. Eiternde Wunden bedeckten ihre Beine.
„Ich sehe Wasser! Eine Riesenmenge Wasser! Das Meer!“ schrie Dan.
Die Männer brüllten: „Hurra!“
„Keine Luftspiegelung?“ forschte Hasard mißtrauisch.
„Bestimmt nicht. Wenn ihr wüßtet, wie frisch die Brise hier oben geht. Nur unter dem Blätterdach ist es so schwül. Hier finde ich es richtig angenehm.“ Dan geriet förmlich aus dem Häuschen.
„Siehst du die Teufelsinsel?“
Dan schaute sich gründlich um.
„Ob sie es ist, weiß ich nicht, Hasard“, erwiderte er entsetzt. „Aber ich kann da links, ein paar Meilen voraus, ein dunkles Gebilde mitten im Wasser erkennen. Das wird sie wohl sein.“
„Sicher“, bestätigte Hasard voll dunkler Ahnung. „Es gibt nur eine Insel hier vor der Küste, die in Frage kommt. Aber bedeutet das etwa, daß wir uns auf der falschen Seite des Flusses befinden?“
Augenblicklich trat Ruhe ein, eisiges erschrecktes Schweigen.
Alle warteten auf die Antwort Dan O‘Flynns wie auf das Urteil eines Richters. Denn jeder wußte: irgendwelche Extratouren konnten sie sich nicht mehr leisten. Das bißchen Kraft, das ihnen geblieben war, brauchten sie, um überhaupt noch die Küste zu erreichen.
Wenn sie die auf einer Flußüberquerung verplemperten, waren sie erledigt. Ganz abgesehen davon, daß sie nicht wußten, was sich alles im Strom tummelte, wie viele unbekannte Gefahren dort drohten. Denn aus dem Rinnsal tief im Urwald war inzwischen ein respektabler Strom geworden.
„Mach‘s Maul auf, du Rübenschwein!“ forderte der Profos grimmig. Seine schmutzigen Hände spielten mit dem verfilzten Bart. Nervös kämmte er pausenlos mit den Fingern das Haar.
Dan senkte den Kopf. Bedrückt schaute er auf Hasard.
„Sag‘s ihnen. Sie werden es wie Männer tragen“, befahl der Seewolf und zitterte selbst vor der Antwort.
„Wir befinden uns auf der falschen Seite“, sagte Dan in einem Ton, als trage er für dieses Unglück die alleinige Schuld.
„Verdammte Scheiße!“ brüllte Ferris Tucker.
Er hieb die Axt bis zum Anschlag in einen Baumstamm.
Die Männer kippten um wie die Fliegen. Sie ließen sich einfach zu Boden fallen, als habe diese Nachricht ihnen die Beine weggerissen.
„Das schaffen wir nie. Nicht in unserem Zustand“, stöhnte Pete Ballie. „Und Flöße können wir nicht bauen. Das dauert zu lange. Bis dahin sind wir alle verhungert.“
„Keine Müdigkeit vorschützen“, sagte Hasard scharf. „Seit wann kneift ihr angesichts kleinerer Schwierigkeiten? Vom Jammern kriegen wir die ‚Isabella‘ nicht wieder. Die will erobert sein. Ist doch klar. Also hoch, Leute, Jeder sucht sich ein tragfähiges Stück Holz. Das spart viel Kraft, wenn wir übersetzen.“
Er scheuchte die Männer erbarmungslos hoch.
„Ihr werdet doch so kurz vor dem Ziel nicht aufgeben, Kerls! Gebraucht mal euren Grips! Die ‚Isabella‘ ist in greifbare Nähe gerückt! Nur dieser Fluß trennt uns noch von ihr!“ spornte Hasard die Crew an.
„Und die See. Bist du kräftig genug, um diesmal in die umgekehrte Richtung zu schwimmen?“ fragte Matt Davies bitter. „Mich kriegst du nicht mehr hinein.“
„Kommt Zeit, kommt Rat“, sagte Hasard. „Wahrscheinlich bewachen die Spanier sowieso die ‚Isabella‘. Da könnte ich euch alle gar nicht gebrauchen. Das erledige ich allein mit einer Handvoll zuverlässiger, mutiger Leute. Mit denen, die in dieser Lage auch noch nicht aufgegeben haben. Also, wer ist mit von der Partie?“
Hasard wollte seine Leute mit dieser Frage provozieren und sie zwingen, sich noch einmal aufzuraffen. Er erreichte das Ziel.
Nach und nach reckten sich Hände in die Luft. Kaum einer schloß sich aus. Sie hatten alle begriffen, daß ihr weiteres Schicksal davon abhing, ob sie die „Isabella“ wieder in ihren Besitz brachten. Sonst blieben sie in der Fieberhölle von Guayana hängen und verfaulten in diesem sumpfigen Küstenstreifen.
Hasard konnte den nächsten Schritt wagen.
„Dazu müssen wir erst einmal über den Fluß“, sagte er trocken. „Na los, Leute! Auf was wartet ihr noch? Eben wolltet ihr mit mir zur ‚Isabella‘ hinüberschwimmen und jetzt kapituliert ihr angesichts dieses jämmerlichen Baches.“
Hasard untertrieb absichtlich.
Er kannte wohl die Gefahren, so dicht an der Mündung des Flusses, nahe des offenen Meeres, überzusetzen. Wer hier abtrieb, war rettungslos verloren.
Und die Flüsse in diesem Land hatten so ihre Tücken. Sie wurden von yardhohen Flutwellen heimgesucht, wenn das Wasser stieg. Oder es entstand ein unwiderstehlicher Sog bei Ebbe, wenn schlammige Küstenstreifen aus den Fluten stiegen und bis zur nächsten Flut das Anlegen von Schiffen verhinderten.
Man konnte nicht immer auf den Augenblick warten, da sich Kräfte des ablaufenden und des auflaufenden Wassers gegenseitig fast neutralisierten. Die Seewölfe schon gar nicht. Sie mußten hinüber, egal wie. Sie mußten ihren Plan zur Rückeroberung des gestrandeten Schiffes schleunigst in die Tat umsetzen.
Dies war ihr vierter Tag in der Fieberhölle von Guayana.
Mehr konnte keiner ertragen. Sie hatten nichts mehr zu verlieren, aber alles zu gewinnen.
Hasard gelang es noch einmal, seine Männer zur letzten Anstrengung zu treiben. Sie besorgten sich alle irgendwelche Schwimmhilfen. Treibholz gab es genügend. Der Strom brachte entwurzelte Bäume mit, die noch schwimmfähig waren und zwei, drei Männern Halt und Unterstützung boten. Nur lagen die Behelfsflöße nicht gebrauchsfertig herum. Oft mußten die Stämme erst mühsam aus dem Uferschlick geborgen werden. Es war eine mörderische Plackerei.
„Mehr habe ich unter der Peitsche der Dons auch nicht geleistet“, stöhnte Pete Ballie.
Er und Luke Morgan wuchteten einen drei Yards langen Stamm aus dem Dschungel zum Fluß. Sie mußten immer wieder Pausen einlegen.
Hasard und der Kutscher hatten ein Floß gebaut, das auch noch für den verletzten Smoky reichte.
Er befand sich sichtlich auf dem Wege der Besserung. Das Fieber war verschwunden. Aber natürlich konnte er mit seinem verletzten Arm nicht schwimmen. Noch tat jede Bewegung entsetzlich weh. Die Haut spannte. Die Wunde verheilte schlecht. Smoky scheuchte Fliegen. Er wußte, was passierte, wenn sie ihre Eier ablegten. Ihm steckte noch die Madengeschichte in den Knochen.
Sie warfen sich einer nach dem anderen in den Fluß. Dicht beieinander versuchten sie, so schnell wie möglich das andere Ufer zu erreichen. Jeder spürte sofort die Kraft des Stromes, der ständig versuchte, sie abzudrängen und ins offene Meer zu treiben.
Selbst Hasard hatte sich die Sache leichter vorgestellt.
In der Mitte des Flusses merkte jeder, daß es um Sein oder Nichtsein ging. Selbst die Überquerung der See, mitten im Unwetter, war ein Kinderspiel gegen die Bewältigung dieses Hindernisses gewesen.
Zweimal mußte Hasard eingreifen, als ein Erschöpfter auf seinem Rettungsbalken vorbeitrieb und offensichtlich den zermürbenden Kampf aufgegeben hatte. Er schnappte sich den Schiffbrüchigen und band ihn an das eigene Floß – mit dem Ergebnis, daß er selbst kaum noch vorwärtskam.
Erst, als die Geretteten sich einigermaßen erholt hatten, konnten sie ihn wieder unterstützen.
Sie arbeiteten wie wild. Besonders die letzten zehn Yards vor dem jenseitigen Ufer kosteten Kraft. Hier gab es eine noch stärkere Strömung, die verhinderte, den anvisierten Punkt zu erreichen, der gegenüber der Ablegestelle lag.
Sie verloren gute zweihundert Yards, ehe sie völlig erschöpft an Land krochen.
Hasard konnte Smoky gerade noch mitschleppen. Dann verließen ihn endgültig die Kräfte. Er torkelte genau zwei Schritte an Land. Dann kippte er zu Boden und blieb völlig ausgepumpt liegen. Er hätte sterben können vor Erschöpfung.
Aber der Gedanke an seine Männer ließ ihm keine Ruhe.
Er rappelte sich auf, hockte am Ufer und beobachtete die Schwimmer, die noch im Wasser waren. Sie paddelten wie wild.
Langsam erhob sich Hasard.
Er brüllte Befehle, gab Hinweise auf Männer, die nicht mehr konnten, und sorgte dafür, daß sie von ihren Gefährten aufgefangen wurden. Er selbst hätte nicht mehr eingreifen können, wenn einer der Männer aufs offene Meer getrieben worden wäre.
Aber es ging alles klar.
Nach und nach trafen die Nachzügler ein.
Manche hatten es erst beim sechsten Anlauf geschafft, das rettende Ufer zu erreichen.
Hasard griff ihnen unter die Arme, schleppte sie in den Schatten der Palmen und sprach ihnen gut zu.
Die Ermattung der Männer war total. Niemand hatte mehr etwas zuzusetzen. Auch Hasard fühlte sich hundeelend. Die Strapazen des Dschungelmarsches, die Entbehrungen machten sich deutlich bemerkbar.
Dennoch erstieg Hasard eine Palme, um die „Isabella“ in Augenschein zu nehmen.
Während seine Gefährten apathisch am Boden lagen, hielt Hasard Ausschau. Er stand auf einem Knick des schlanken Palmenstammes, lehnte sich an und beschattete seine Augen.
Er brauchte nicht zu fürchten, von einem Ausguck der Spanier entdeckt zu werden. Die üppigen Palmwedel erlaubten ihm gute Sicht, schützten ihn aber gleichzeitig vor neugierigen Blicken der anderen Seite.
Hasard erkannte die Umrisse der spanischen Zwingburg, an der sie hatten mitarbeiten müssen. Er dachte an El Verdugo, den Henker, der sie so unmenschlich angetrieben hatte. Er war seiner gerechten Strafe nicht entgangen.
Es mußte dort drüben von Soldaten wimmeln, aber Einzelheiten konnte Hasard nicht erkennen.
Was Hasard wirklich entsetzte, war der Anblick zweier spanischer Galeonen, die auf Reede lagen und bewiesen, wie ernst die Spanier noch immer die Seewölfe nahmen. Von ihrem Tod waren sie offenbar nicht restlos überzeugt, Sie wußten genau, daß es für die Männer um Hasard nur eine Rettung gab, wenn sie am Leben waren: die Rückkehr zur Teufelsinsel, um zu versuchen, ein Schiff, möglichst das eigene, in Besitz zu nehmen und unter vollen Segeln davonzurauschen.
Daher lag die „Isabella“ noch immer leicht gekrängt auf der Sandbank, auf der sie aufgelaufen war. Damit hatte das Dilemma begonnen. Natürlich hatten sich die Spanier gehütet, das Schiff flottzumachen. Sie wollten dem Seewolf doch nicht die Arbeit abnehmen. Sie rechneten damit, daß der Anblick seines stolzen Schiffes ihn blenden mußte. Er würde sein Schiff holen wollen – und dann konnten sie über ihn herfallen.
Der Köder war ausgelegt. Eine teuflische Falle, wie Hasard gestehen mußte. Die Zeit arbeitete für die Spanier.
Sicher hatten sie Posten auf der „Isabella“, aber er konnte nichts erkennen. Er wußte, was ihn erwartete. Die kommende Nacht würde die Entscheidung bringen.