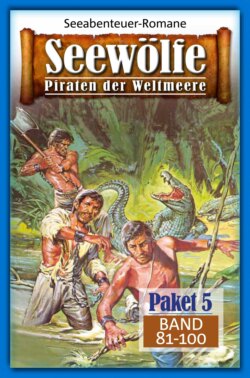Читать книгу Seewölfe Paket 5 - Roy Palmer - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7.
ОглавлениеLeises Plätschern begleitete das Boot, das sich aus dem tiefen Schatten der Klippen löste.
Siri-Tong stand neben dem Wikinger an der Schmuckbalustrade des Achterkastells und spähte zur Küste hinüber. Sie hatte genau zwei Minuten gebraucht, um sich die verschiedenen Röcke, Überröcke, Unterröcke und spitzenverzierten Wäschestücke vom Körper zu zerren, und eine weitere Minute, um wieder in ihre gewohnte Kleidung zu schlüpfen.
Nur noch die wilde Lockenpracht erinnerte an das hinter ihr liegende Abenteuer. Und der dritte Blusenknopf von oben, der jetzt ebenfalls offenstand, weil er abgesprungen war, als Siri-Tong vor ihrem Aufbruch die Bluse wutentbrannt und entsprechend vehement ausgezogen hatte.
Jetzt war das Gesicht der roten Korsarin blaß und unbewegt, die Haltung gespannt wie eine geschmeidige Stahlsaite. Der Wikinger stand wie ein Baum neben ihr. Stimmen klangen über die Decks, das Schiff war erfüllt von den Geräuschen fieberhafter Tätigkeit. Die Männer, die auf der Kuhl erschienen, um dem Boot entgegenzusehen, hatten entzündete Augen und rieben sich erschöpft den Schweiß aus den Gesichtern.
Die ganze Nacht hatten sie geschuftet wie die Irren: Segelkartuschen genäht, Kugeln und Stangenkugeln gemannt, genügend Pulvervorräte an Deck geschafft, unermüdlich an den Geschützen exerziert. Im Vorderkastell waren die Gestelle zum Abschießen der fremdartigen Raketen klariert worden, von denen sich immer noch eine Unzahl an Bord befand.
Diese handlichen, mit keinem Mittel zu löschenden Brandsätze waren die stärkste Waffe des schwarzen Seglers – und die furchtbarste, mörderisch in ihrer Wirkung. Aber wo es galt, mit einem einzigen Schiff eine stark befestigte spanische Siedlung und ein ganzes Geschwader schwerbestückter Kriegsgaleonen anzugreifen, da war jedes Mittel recht.
Siri-Tong beobachtete, wie der Boston-Mann das Boot an die Jakobsleiter heranpullte und aufenterte. Minuten später standen er, Thorfin Njal und die Rote Korsarin wieder in der Kapitänskammer, und der Boston-Mann berichtete, was er in Erfahrung gebracht hatte.
Tatsächlich war am frühen Abend das spanische Geschwader in den Hafen von Cayenne eingelaufen.
Der Boston-Mann grinste verwegen, als er mit ein paar Strichen aufzeichnete, wie die Galeonen im Hafenbecken verteilt lagen – entgegenkommenderweise genau so, daß der schwarze Segler nur schnurgerade in die Einfahrt zu laufen brauchte, um Backbord- und Steuerbordkanonen gleichzeitig einsetzen zu können.
Auch die Lage der Befestigungen hatte sich der Boston-Mann eingeprägt. Er zeichnete sie ebenfalls auf, und Siri-Tong und der Wikinger stießen fast mit den Köpfen zusammen, als sie sich über die Skizze beugten.
Die Rote Korsarin lächelte. Etwa so, wie man sich das Lächeln einer Tigerin vorstellen mochte, die schon dabei ist, ihre Beute zu verdauen.
„Das schießen wir alles mit Leichtigkeit in Fetzen“, sagte sie kategorisch. „Die Galeonen werden Kleinholz. Und mit den Befestigungsanlagen können die Dons dann vielleicht ihre Straßen pflastern.“
„Hm!“ Der Wikinger kratzte an seinem Kupferhelm, runzelte die Stirn und grinste gleichzeitig. Und das tat er nur, wenn er bei einer äußerst heiklen, gefährlichen Angelegenheit sehr große Lust verspürte, sich mitten hineinzustürzen.
Der Boston-Mann hatte Planwagen und Maultiere getreulich wieder mitgebracht.
Die Händler hatten keine Chance, ihre Landsleute jetzt noch zu warnen, dafür war der Weg zu weit. Sie wurden an Land gesetzt, mit dem dringenden Rat, sich nicht nach Cayenne zu wenden, da man dort in nächster Zeit allenfalls noch Verbandszeug gewinnbringend verkaufen könne.
In allerletzter Minute hätte es fast doch noch Mord und Totschlag gegeben. Agnessa, der ahnungslose Engel, bot nämlich der Roten Korsarin an, das fatale Kleid zu behalten – und nur eilige Flucht rettete sie vor Siri-Tongs Krallen.
Eine knappe Stunde später lief der schwarze Segler aus der Bucht und pirschte sich im Schutz der Dunkelheit auf die Reede von Cayenne zu.
Die spanische Siedlung schlief. Sie fühlte sich sicher im Schutz ihrer starken Befestigungen, doppelt sicher, seit das Geschwader der Kriegsgaleonen im Hafen lag.
Noch ahnte niemand das Verhängnis, das sich lautlos näherte.
Auch den spanischen Wachtposten auf der „Isabella“ näherte sich das Verhängnis, aber durchaus nicht lautlos.
Dan O’Flynn platschte mit völliger Selbstverständlichkeit durch den Schlick vor der Sandbank. Die Wellen der auflaufenden Flut spülten um seine Stiefel. Er blickte zum Himmel, gähnte wie jemand, der unterwegs ist, weil er sich langweilt, und stellte noch einmal fest, daß das Wasser tatsächlich schon wesentlich höher stand als gewöhnlich.
Die Wachtposten hatten nur einmal kurz zu ihm herübergesehen, kümmerten sich jedoch nicht weiter um ihn. Sie waren zu dritt. Da Wachen normalerweise in Zweiergruppen gingen, vermutete Dan, daß der dritte Spanier an Bord lediglich seine Zeit totschlug. Also würde es auch nicht auffallen, wenn sich ein vierter Mann dazugesellte, und Dan fühlte sich einigermaßen sicher, als er an der Jakobsleiter aufenterte.
„Buena Noche“, brummelte er in den nicht vorhandenen Bart.
Einer der Posten wandte uninteressiert den Kopf.
Glanz auf den Augen, stellte Dan fest. Das lag sicher nicht an der blakenden Öllampe, die die Gesichter nur verschwommen erkennen ließ, sondern an der Rumflasche.
„Hast du ’ne Buddel dabei?“ fragte jemand begierig.
Dan schüttelte den Kopf und gähnte wieder.
„Scheißinsel“, sagte er.
Das Spanisch, das er sich auf der „Tortuga“ und später angeeignet hatte, beschränkte sich auf seemännische Kommandos, die Flüche, mit denen brutale Aufseher die Rudersklaven bedacht hatten, und den Sprachschatz einseitiger Unterhaltung über Weiber, Suff und Prügeleien an Land. In einer anderen Umgebung als dieser wäre er damit kaum sehr weit gelangt. Aber für die drei angetrunkenen Soldaten mußte es reichen.
Die Würfel klapperten.
Das Spiel schien gerade spannend zu werden, denn die drei Männer stierten gebannt auf die umgedrehte Pütz, die sie als Tisch benutzten. Dan schlenderte zur Nagelbank. Noch einmal überzeugte er sich, daß er nicht beobachtet wurde, dann schnappte er sich einen handlichen Belegnagel und verbarg ihn hinter dem Rücken.
„Habt ihr’s bald hinter euch?“ erkundigte er sich beiläufig.
Die Frage war wichtig, äußerst wichtig. Denn von dem Rhythmus der Wachablösungen hing es ab, wie schnell die Spanier auf der Insel Verdacht schöpfen würden.
„Blöde Frage“, brummte einer der Soldaten. „Noch den halben Törn, zwei Stunden. Wolltest du uns nachher zu ’ner Buddel einladen, oder was?“
„Blödmann“, sagte Dan. Eine längere Erklärung für seine Neugier hätte er sich erst zurechtlegen müssen. Allzu viele Fragen durfte er nicht mehr stellen, aber das war auch gar nicht nötig.
Der Fall lag klar.
Alle vier Stunden Wachablösung – das bedeutete, daß sie noch genau zwei Stunden Zeit hatten, um sich auf der „Isabella“ so einzurichten, daß sie auch die nächsten Posten lautlos ausschalten konnten. Zwei Stunden reichten, aber sie ließen auch nicht viel Zeit übrig. Was wiederum bedeutete, daß er, Dan, jetzt umgehend handeln mußte.
„Trink, Kamerad!“ brummte einer der Soldaten.
Dabei hielt er die Rumflasche hoch, ohne hinzusehen. Dan griff mit der Linken zu. Erneut klapperten die Würfel. Einer der Spanier stieß einen Laut des Triumphes aus, die anderen fluchten.
Dan hob die Flasche und nahm gleichzeitig die Rechte vom Rücken.
Schade um das schöne Gesöff, dachte er. Und dann ließ er die Buddel mit Wucht auf den Schädel des edlen Spenders krachen.
Der zweite Spanier kriegte den Belegnagel auf den Kopf. Der dritte, der auf der anderen Seite der Pütz kauerte, kriegte große Augen. Dan grinste ihn an und glitt einen Schritt zur Seite.
„Wa … Arrr!“ stieß der Soldat hervor.
Eigentlich sollte es eine Frage werden, die mit „Was“ anfing, aber Dans Stiefelspitze war dazwischengeraten. Sie knallte dem Spanier ans Kinn, und der Bursche legte sich lang an Deck. Sein Gesicht spiegelte immer noch die Überraschung. Dan fand, daß er wie ein erstauntes Baby aussah.
Wider Erwarten war die Rumflasche härter gewesen als der spanische Schädel. Dan grinste, als er sie entkorkte und einen tiefen Schluck nahm. Und noch einen. Den dritten verkniff er sich mit Rücksicht auf die anderen. Wobei er sich äußerst edelmütig fühlte.
Mit zwei Schritten stand er am Backbord-Schanzkleid und winkte.
Daß er mit einer Flasche winkte, war vor dem Hintergrund der blakenden Öllampe nicht zu übersehen. Die Seewölfe hatten sich so nah wie möglich an die Sandbank herangepirscht, um Dan Rückendeckung zu geben, Rückendeckung, die er zum Glück nicht benötigt hatte. Hasard atmete erleichtert auf. Ferris Tukkers entzückter Seufzer bezog sich mehr auf die Buddel. Prompt bekam er einen Dämpfer.
„Du sagst den anderen Bescheid“, ordnete der Seewolf an. „Dann gehst du mit Blacky und Batuti zurück und siehst zu, daß die Ausrüstung über die Insel geschafft wird. Klar?“
„Aye, aye!“ Tucker grinste. Die Rumflasche lockte ihn ganz erheblich, aber immerhin wußte er, daß Hasard und Ben Brighton die letzten waren, die sie allein lenzen würden.
Lautlos huschte Ferris Tucker zurück zu den Felsen, zwischen denen sich die Hauptstreitmacht der Seewölfe verborgen hielt.
Ein paar geflüsterte Worte klärten die Lage. Blacky, Batuti und der hünenhafte Schiffszimmermann brachen zur anderen Seite der Insel auf, wo vier Mann zur Verteidigung von Booten und Ausrüstung zurückgeblieben waren: Ed Carberry und Big Old Shane, weil die beiden notfalls eine Armee ersetzen konnten, der Kutscher und Smoky mit seiner verletzten Schulter, weil der Seewolf sie aus der vordersten Schußlinie hatte heraushalten wollen.
Der kleine Bill war mitten unter den anderen sicherer als an einem Platz, wo sein Ungestüm vielleicht Unheil anrichten konnte, wenn es kritisch wurde.
Aber auf diesen Gedanken kam er natürlich nicht. Seine Augen glänzten, sein Gesicht war vor Eifer gerötet. Der Seewolf hatte ihn mit an die vorderste Front genommen. Wenn es Kampf gegeben hätte, wäre er, Bill, mittendrin gewesen. Und jetzt, als er mit den anderen in weitem Bogen auf die Sandbank zuschlich, bedauerte er im Grunde seines Herzens fast, daß alles so glatt gegangen war.
Hasard und Ben waren bereits an Bord. Die anderen enterten an der dem Land abgewandten Seite auf. Sie mußten durchs Wasser waten, wurden naß bis zu den Hüften, aber es gab niemanden, den das gestört hätte.
Als sie sich in den tiefen Schatten des Achterkastells duckten, schliefen die spanischen Wachtposten immer noch.
Sie waren gefesselt und geknebelt. Einem von ihnen fehlte die Uniform, und Hasard lächelte, als er Bill zu sich winkte.
„Zieh das an, Junge! Falls wir hier beobachtet werden, darf niemand auf die Idee verfallen, daß die Wachen pennen.“
Bills Gesicht strahlte auf. Wohl selten hatte sich jemand so schnell umgezogen, wie er das jetzt schaffte. Mit glänzenden Augen hockte er sich neben Dan an den Platz, wo vorher die Spanier gesessen hatten, und für die nächste Stunde fühlte er sich sämtlichen drohenden Gefahren zum Trotz im siebenten Himmel.
Die Seewölfe sahen zu, daß sie sich versteckten. Hasard hatte die Rumflasche für diejenigen reserviert, die das schwere Wasserfaß und den Rest der Vorräte schleppen mußten. Immer wieder spähte er zu der Insel hinüber. Alles war still und schien in tiefem Schlaf zu liegen, aber das konnte täuschen. Esteban Jerez hatte es bewiesen, der jetzt mit den anderen Spaniern in der Vorpiek lag. Und die Reaktion der Wachtposten auf Dans Erscheinen ließ ebenfalls keinen Zweifel daran, daß man mit Leuten rechnen mußte, die sich aus purer Langeweile in der Nähe der „Isabella“ herumtrieben.
Hasard war erleichtert, als der Rest seiner Männer wie aus dem Nichts auftauchte. Minuten später waren auch sie an Bord.
Zur Freude von Ferris Tucker kreiste die Rumflasche. Viel war nicht mehr darin, und viel Zeit zur Erholung blieb ihnen auch nicht. Jeden Augenblick mußte die Ablösung für die spanischen Wachen auftauchen, und Hasard beeilte sich, den größten Teil der Männer unter Deck zu scheuchen.
Ferris Tucker nahm die leere Rumbuddel mit, nachdem er als seine erste Arbeit an Bord die gebrochene Ruderkette repariert hatte, durch die sie bei ihrem Seegefecht gegen die spanische Übermacht steuerlos geworden waren.
Was er mit der Flasche wollte, war klar: sie würde dem gleichen Zweck dienen wie all die anderen leeren Flaschen, die an Bord der „Isabella“ gesammelt wurden und für die sich der rothaarige Schiffszimmermann eine ganz besondere Verwendung ausgetüftelt hatte. Sie wurden mit Pulver, Nägeln und Blei gefüllt, mit kurzen Lunten gezündet und dann einfach geworfen.
Wenn diese Dinger explodierten, war die Wirkung unter den ahnungslosen Gegnern jedesmal verheerend.
Noch hofften die Seewölfe, daß es ihnen gelingen würde, im Sturm mit der „Isabella“ unbemerkt das Weite zu suchen.
Aber verlassen konnten sie sich nicht darauf. Wenn sie Pech hatten und die Spanier vorzeitig Verdacht schöpften, würden sie sich zu wehren wissen.
Hasard ahnte, daß die Männer unter Deck bereits dabeiwaren, eine ganze Menge von Ferris Tuckers Flaschenbomben zu basteln.
„Sie kommen“ sagte Dan O’Flynn leise.
Hasard hob den Kopf und riskierte einen vorsichtigen Blick über das Schanzkleid. Ja, sie kamen: zwei unlustig einherstolpernde Gestalten mit einer tanzenden Lampe. Nicht eben eilig folgten sie dem Weg, der von den Felsen herunterführte, und schlurften durch den Sand. Einer fluchte erbittert: das Wasser stand höher als sonst, und er kriegte nasse Füße. Etwas flotter als vorher marschierten sie auf die Jakobsleiter zu.
Hasard hoffte, daß sie nicht warten würden, bis ihre vermeintlichen Kameraden ihnen entgegenkamen.
Nein, offenbar nicht.
Der erste Spanier enterte auf, seine Stiefel verursachten kratzende Geräusche. Dan und Bill hatten die Öllampe so gestellt, daß sie nicht ihre Gesichter beleuchtete. Links und rechts von der Jakobsleiter kauerten Hasard, Carberry, Matt Davies und Big Old Shane im Schutz des Schanzkleides und warteten darauf, daß ihr Opfer an Bord sprang.
„Pennt ihr?“ murrte der Spanier. „Wohl zuviel gesoffen, was? Oder wollt ihr uns noch Gesellschaft lei …“
Weiter gelangte er nicht.
Matt Davies knallte ihm wuchtig seinen Stahlhaken auf den Schädel. Der Spanier sackte lautlos zusammen. Und Matt, der im selben Augenblick seinen eigenen Fehler erkannte, produzierte rasch ein krächzendes Husten, um die Erklärung dafür nachzuliefern, daß der Bewußtlose mitten im Satz verstummt war.
Ed Carberry zog den Spanier leise zur Seite. Hasard durchbohrte Matt Davies mit einem Blick, und der zog schuldbewußt den Kopf zwischen die Schultern.
„Wohl verschluckt, was?“ fragte der zweite Wachtposten erheitert.
„Hrrr!“ krächzte Matt undeutlich.
Der Spanier nahm es als Zustimmung. Sein Kopf erschien über dem Schanzkleid. Da er seinen Kameraden zu sehen erwartete, würde er zweifellos etwas früher stutzig werden als der andere, und deshalb richtete sich Big Old Shane blitzartig zu seiner vollen Größe auf.
„He!“ brachte der Spanier noch heraus.
Dann hatte er das Gefühl, als falle ihm der Himmel auf den Kopf. Er war zu schnell bewußtlos, um noch zu merken, daß es lediglich die Faust des Schmieds von Arwenack gewesen war.
„Fesseln, knebeln, ab in die Vorpiek!“ befahl Ed Carberry.
Hasard grinste. „Moment noch! Dem Klotz von Kerl da müssen wir die Uniform ausziehen. Er hat deine Figur, Ed.“
„Die halbe Portion? Außerdem haben wir schon zwei Mann, die Wache schieben für den Fall …“
„… für den Fall, daß die Spanier uns beobachten“, ergänzte Hasard sanft. „Und die Dons würden sich sehr wundern, wenn ihr Herkules plötzlich auf die Maße unseres kleinen Bill geschrumpft wäre.“
„Eh – ja …“ Der Profos kratzte sich verlegen sein Rammkinn. „Affenarsch und Seemannsscheiße!“ fluchte er dann los. „Was hockt ihr noch da herum? Wollt ihr dem Kerl endlich die Klamotten abpellen, oder soll ich das vielleicht tun, was, wie?“
Er verstummte, weil Blacky und Stenmark schon dabei waren, den großgewachsenen Spanier zu entkleiden. Daß er Carberrys Statur hatte, stimmte tatsächlich nur annähernd. Der Profos war ein Riese von einem Mann, hatte Schultern so breit wie ein Rahsegel und einen Brustkasten wie ein Bierfaß, und er schaffte es nur unter Ächzen und Stöhnen und natürlich einer ellenlangen Kette von Flüchen, sich in die Uniform zu zwängen.
Ein paar Minuten später gingen er und Dan O’Flynn gut sichtbar Wache, während die anderen Seewölfe nicht einmal eine Haarspitze über das Schanzkleid hoben.
Im Bauch der „Isabella“ war eine Gruppe wie besessen dabei, die Flaschenbomben mit der verheerenden Ladung herzustellen. Geschütze wurden klariert, Kugeln gemannt, Segeltuchkartuschen vorbereitet – und das alles leise, unauffällig, teilweise in Hockstellung. Die Männer richteten sich darauf ein, das Schiff notfalls mit allen Mitteln zu verteidigen. Sie schufteten, keuchten, der Schweiß rann ihnen in Bächen über die Gesichter, und die Hitze dieser Anstrengung war es, die Hasard wenig später die leichte Abkühlung sofort bemerken ließ.
Wind trocknete die Schweißperlen in seinem Gesicht.
Es briste auf, kein Zweifel!
Auch die anderen an Deck spürten es, und für einen Moment verharrten sie reglos, mit angehaltenem Atem, während die Brise zunehmend frischer wurde.
„Mann!“ flüsterte Stenmark andächtig.
Dan O’Flynn hätte fast einen Jubelschrei ausgestoßen, aber gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, daß jubelnde spanische Wachtposten auf der „Isabella“ nicht recht ins Bild paßten. Er beschränkte sich darauf, die Nase in den Wind zu halten und mit funkelnden Augen in die unergründliche Schwärze der Wolken zu starren, die für die Seewölfe durchaus nicht bedrohlich wirkten, sondern im Gegenteil höchst verheißungsvoll.
Die Männer schufteten weiter.
Von See drückte das Wasser herein. Eine Stunde später begann der Rumpf der „Isabella“ auf dem Sand zu scheuern. Wieder unterbrachen die Seewölfe die Arbeit und hielten den Atem an.
„Ich glaube, wir haben Glück“, sagte Ben Brighton leise. „Die Flut steigt ungewöhnlich hoch.“
Stenmark spuckte abergläubisch über die Schulter. Fast hätte er den Profos getroffen, aber der drohte ausnahmsweise nicht damit, dem Schuldigen die Haut vom Hintern zu ziehen. Er war selber abergläubisch, was er damit zeigte, daß er dreimal gegen das Holz des Achterkastells klopfte.
Das Knirschen des Schiffsrumpfs schien ihm zu antworten.
Etwas wie ein leises Beben lief durch die Bordwand. Die nächste anrollende Woge rüttelte an der „Isabella“, wühlte unter dem schrägliegenden Rumpf und drückte gegen die Bordwand. Langsam, nur um eine Winzigkeit hob sich das Schiff, und diesmal begleiteten mindestens fünf, sechs Männer den Vorgang mit andächtigem Stöhnen.
Eine Stunde später hatte sich die „Isabella“ einigermaßen aufgerichtet.
Mehr allerdings tat sich nicht. Immer noch lagen sie auf der Untiefe fest. Freikommen würden sie erst, wenn am Morgen der Sturm losbrach.
Wenn er losbrach!
Hasard witterte in die kräftige Brise und starrte immer wieder zum Himmel, dessen Schwärze jetzt etwas Bedrohliches hatte. Er glaubte nicht daran, daß sie noch lange zu warten brauchten. Die einheimischen Fischer kannten das Wetter genau. Und auch sie hatten den Sturm für den frühen Morgen vorausgesagt.
„He!“ zischte Dan O’Flynn plötzlich. „Da ist jemand!“
„Wo, zum Teufel? Ich seh nichts!“
Es war Carberry, der das sagte. Er hatte nicht Dans scharfe Augen, aber es dauerte nicht lange, bis auch er und die anderen die beiden Gestalten sahen, die sich von den Felsen her näherten.
Spanier!
Zwei Männer in Uniform!
Sie marschierten zielstrebig auf die „Isabella“ zu und erweckten ganz und gar nicht den Eindruck, als ob sie nur aus Langeweile auf der Insel spazierengingen.