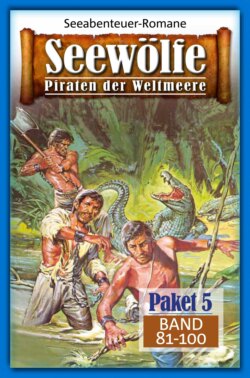Читать книгу Seewölfe Paket 5 - Roy Palmer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеDie Seewölfe brachen auf. Sie tauchten unter im Grün der Bäume und Lianen. Die üppige Vegetation verschluckte sie, als habe es sie nie gegeben. Und doch gab es Leben im Urwald. Kreischend stiegen bunte Papageienschwärme auf und zeigten die Fluchtrichtung der Ausbrecher an. Die Spanier waren schließlich nicht blind und lebten lange genug in diesem Teil der Welt, um die Zeichen der Natur richtig zu deuten.
Hasard biß die Zähne zusammen. Es mußte trotzdem klappen.
In fliegender Hast erläuterte er seinen Gefährten den Plan.
Big Old Shane und er hoben eine Fallgrube aus. Sie arbeiteten wie die Wilden. Die Messerklingen bohrten sich leicht in das lockere Erdreich. Sie gingen nicht zu sehr in die Tiefe, rammten aber in den Grund der Grube einen angespitzten Pfahl. Er würden den Spanier, der den Fehltritt tat, nicht gerade töten, ihn aber hindern, weiter den Ausbrechern nachzusetzen. Kaum war eine halbe Stunde vergangen, da gab es entlang des Pfades eine ganze Reihe teuflischer Überraschungen.
Hasard und seine Begleiter folgten in mäßigem Tempo ihren Gefährten und bauten von Zeit zu Zeit eine Falle ein. Sie legten einen Verhau von harmlos erscheinenden Lianen an, die sich wie zufällig über den Pfad ringelten, in Wirklichkeit aber über einen hohen Ast liefen und einen schweren Stein in der Höhe festhielten. Wurden sie durchgehackt, fiel der Brocken senkrecht herunter.
Sie bauten einen primitiven Bogen mit einem ansehnlichen Pfeil auf der Sehne aus einem tauähnlichen Schlinggewächs, spannten das ganze mit einer Liane und sorgten dafür, daß die Spanier den Auslöser nicht verfehlten.
Daß ihre Methode erste Erfolge brachte, erkannten die Gehetzten sehr schnell. Schreie verkündeten, daß eine der Fallen zugeschnappt war.
Das Tempo der nachrückenden Spanier wurde merklich langsamer. Vorsichtig und mißtrauisch zogen sie durch den Urwald, denn sie kämpften gegen einen unsichtbaren Feind.
Zwischendurch blieb immer wieder einer der Seewölfe zurück.
Der Mann lag, das Messer in der Faust, auf einem starken Ast oberhalb des Pfades. Er ließ die schwitzenden, fluchenden Spanier unter sich hindurchziehen. Mit Vergnügen beobachtete er, wie die Verfolger immer neue Fallen witterten, sich weigerten, an der Spitze zu marschieren und das Tempo verschleppten. Sie wären am liebsten umgekehrt, hätte die Radschloßpistole ihres Offiziers sie nicht vorangezwungen.
Wenn dann ein Nachzügler auftauchte, ließ der Seewolf sich einfach fallen, riß den Überraschten um und stach mit dem Messer zu.
Nach einer Weile hatten die Dons die Taktik des Gegners durchschaut. Catalina selbst wunderte sich, daß er plötzlich am Ende des Zuges ging.
Sie arbeiteten sich im Gänsemarsch durch das Dickicht, weil die Leute vorn genug damit zu tun hatten, einen schulterbreiten Pfad mit der Machete zu schlagen.
Catalina, völlig verunsichert, fühlte sich als letzter Mann gar nicht mehr so wohl. Ständig drehte er sich um, die Pistole schußbereit in der Faust. Vergeblich suchte sein Auge den Feind im Gewirr der Pflanzen.
Sobald der Mann, der auf Hasards Weisung an einem bestimmten Punkt zurückgeblieben war, sein blutiges Werk beendet hatte, schnappte er sich die erbeuteten Waffen, überholte den feindlichen Trupp in einem weiten Bogen und stieß wieder zu den anderen.
Das kostete eine ungeheure Kraft.
Dafür bereitete es aber doppelt Freude, wenn die Dons plötzlich aus ihren eigenen Musketen frontal angegriffen wurden und Zunder kriegten, daß sie kopfüber Schutz suchten, möglichst in Nesseln und anderen ekligen Pflanzen, die eine Berührung nicht gerade zu einem Quell der Freude werden ließen.
Einmal wurde der Feuerüberfall so gekonnt eröffnet, daß den Spaniern entweder der Pfad blieb oder ein Satz in den Morast. Zwei Soldaten, in Helm und Harnisch, versanken kläglich. Ihr Geschrei marterte noch lange die Nerven der anderen Soldaten, die von Catalina brutal weitergetrieben wurden, obgleich sie lieber ihren unglücklichen Kameraden geholfen hätten.
Aber der Capitan duldete nicht die kleinste Verzögerung. Die trat erst ein, als es Catalina selbst erwischte.
Hasard hatte kaum erkannt, daß das weitere Vordringen der Spanier allein von dem Capitan abhing, da baute er seine Falle auf.
In Windeseile kappten sie einen mittelschweren Baum neben dem Pfad so, daß er noch von zwei Lianen in seiner Stellung gehalten wurde. Hasard selbst legte sich auf die Lauer.
Genau im richtigen Augenblick zerstörte er die beiden Lianen.
Langsam kippte der Baum und neigte sich dem Pfad zu, zu einer Zeit, als die Spanier sich bereits weiter vorgearbeitet hatten und annahmen, in ihrem Rücken drohe keine Gefahr.
Der Baum rauschte durch Unterholz und warnte die Verfolger in letzter Sekunde. Aber es war bereits zu spät. Ein mörderisches Prasseln und Splittern von Ästen ertönte, dann folgte ein heller Schmerzensschrei. Catalina lag begraben unter der Krone.
Der stürzende Baum hatte ihm übel mitgespielt, aber er war nicht tot.
Seine Leute, die ihn zu befreien suchten, brüllte er an, sich zu beeilen. Er hatte große Schmerzen, wie er hinzufügte. Zum Schluß wurde er ausgesprochen umgänglich.
Seine Soldaten befreiten ihn und mußten ihn tragen. Sie traten den Rückzug an und kehrten auf demselben Weg zurück, den sie gekommen waren. Jeder andere Weg hätte neue Strapazen und einen Zeitverlust bedeutet.
Catalina schrie und jammerte. Offenbar waren seine Beine gebrochen.
Auf dem Rückmarsch nahmen die Spanier ihre Toten und Verletzten mit und leider auch die Vorräte an Pulver und Blei, die Hasard nur zu gern erbeutet hätte. Die den Spaniern geraubten Musketen wurden damit wertlos. Es lohnte sich nicht, sie mitzuschleppen.
Hasard und seine Männer zerschlugen die Schießprügel an Bäumen und zogen weiter. Die frisch abgeschlagenen Zweige und Äste, Lianen und Farne wiesen ihnen den Weg.
Die Wiedervereinigung fand eine knappe Meile weiter statt.
Die Tatsache, daß sie blindlings in den Urwald gestürmt waren und nicht mehr ein noch aus wußten, dämpfte die Freude über das gelungene Rückzugsgefecht.
Der Trupp, der den Spaniern das Fürchten beigebracht hatte, war am meisten geschlaucht. Es dauerte lange Zeit, bis sich Hasard und seine Männer so weit erholt hatten, daß sie Bericht erstatten konnten.
Sie fanden nur wenige Zuhörer.
Die meisten Seewölfe lagen wie tot auf dem feuchten Urwaldboden, ungeachtet der giftigen Spinnen und Schlangen. Sie hatten nur den einen Wunsch: sich auszuruhen, Atem zu schöpfen und endlich einmal wieder Kräfte sammeln zu können.
Die Spanier hatten sich wohl aus dem unheimlichen und ihnen so gefährlichen Urwald zurückgezogen. Aber das bedeutete nicht viel. Vielleicht hofften sie, Hunger und Durst werde die Flüchtlinge an den Strand zurücktreiben, und sie brauchten die englischen Freibeuter nur wieder einzusammeln.
„Was sollen wir tun?“ fragte denn auch Old O‘Flynn.
Der Einbeinige sah zum Fürchten aus. Bisweilen hatten seine unermüdlichen Helfer ihn im Geschwindschritt und ziemlich rücksichtslos hinter sich hergeschleift, besonders wenn ihnen die Spanier zu dicht auf den Fersen gesessen hatten und der geringe Vorsprung beängstigend zusammengeschmolzen war. Jetzt war sein Körper von den Folgen solcher Brachialgewalt gezeichnet.
„Zunächst einmal werden wir unsere Ketten ablegen“, erwiderte Hasard gelassen. Die gewonnenen Scharmützel hatten sein Selbstbewußtsein verdoppelt und seine Hoffnung nicht unbeträchtlich erhöht, daß noch lange nicht alles verloren war.
„Vor allem werden wir Posten aufstellen, für den Fall, daß die Spanier immer noch nicht genug haben und einen neuen Vorstoß unternehmen“, fügte der Seewolf hinzu und teilte Wachen ein, um von den Spaniern nicht überrascht zu werden.
Danach senkte sich Stille über die Männer im Dschungel.
Der Rest des Tages und die Nacht verstrichen ohne weitere Zwischenfälle. Weder ließ sich ein Spanier blicken, noch störte sonst etwas die Nachtruhe der Erschöpften. Die Seewölfe schliefen auf dem blanken Boden, traumlos und schwer wie Tote. Da war keiner, dem nicht die Strapaze der wilden Flucht in den Knochen saß.
Bisweilen trat die Wache leise an einen Mann heran und weckte vorsichtig die Ablösung. Der Betroffene fuhr hoch und starrte verständnislos um sich. Blitzartig erinnerte er sich dann aber an alles, was er während des Schlafes für ein paar Stunden begraben hatte: sie steckten mitten im Urwald von Guayana, verloren wie ein Haufen Schiffbrüchiger, mit Ketten an den Händen, die allerdings weit genug waren, um die Bewegungen nicht allzu sehr zu behindern. Schließlich hatten sie Fronarbeit für die Spanier verrichten sollen.
Der nächste Posten zog auf, während sein Vorgänger fast fiel und auf der Stelle in einen totenähnlichen Schlaf versank.
Der Wachposten umrundete vorsichtig die Lagerstelle, eine winzige Lichtung in der grünen Hölle. Nur hier fiel ungehindert das Mondlicht ein, funkelten die Sterne.
Ein tröstlicher Anblick.
Denn nichts gab es sonst, was einem Hoffnung einflößen konnte. Die Lage war verzweifelt. Sie hatten sich weiter von der gestrandeten „Isabella“ entfernt als jemals zuvor. Die Aussichten, das Schiff wieder in Besitz zu nehmen, waren gering. Sie hatten keine Waffen.
Da blieb nur die Hoffnung auf einen Geistesblitz Hasards, der in so vielen gefährlichen Situationen bewiesen hatte, daß er nie mit seiner Weisheit am Ende war.
Der Posten, der jetzt zum ersten Male seit der Flucht den Hunger spürte, lehnte sich an einen Baumstamm. Alles hier war feucht und glitschig, ein betäubender Moschusgeruch ging von dem Holz aus.
Abstoßende Insekten schwirrten durch das Mondlicht und stießen einem ins Gesicht. Man sah keine Einzelheiten, und doch herrschte überall reges Leben. Viele Tiere im Dschungel erwachten erst jetzt und gingen auf Beute aus. Einmal erklang nahebei das heisere Fauchen eines gereizten Jaguars. Aber er folgte wohl einer anderen Spur. Vielleicht hatte er es auf einen Tapir abgesehen oder ein Pekari, eins jener gefährlichen, stets in Rudeln auftretenden Wildschweine, denen man eine ungeheure Angriffslust nachsagte.
Pete Ballie, Rudergänger der „Isabella“, bewachte den Schlaf seiner Gefährten. Aber er konnte nicht behaupten, daß er sich dabei wohl fühlte. Er vermißte die Weite des Meeres und eine frische Brise. Hier gab es nur den Geruch der Fäulnis und eine Wärme wie in einem Treibhaus, die einem die Luft abschnürte und jede Bewegung zur Qual werden ließ.
Noch einer fand keine Ruhe in jener Nacht: Smoky, der Decksälteste. Die Wunde, die er davongetragen hatte, war nicht lebensgefährlich. Auf dem Schiff, unter der Obhut des Kutschers, hätte er die Schramme leicht auskuriert. Aber hier im Dschungel stellten sich bedenkliche Folgen ein. Er kriegte Fieber.
Unruhig wälzte er sich hin und her, vorsichtig, um ja nicht an die verletzte Schulter zu stoßen. Die Wunde puckerte und arbeitete. Sie fühlte sich glühendheiß an.
Schweißnaß lag Smoky am Boden, todmüde und doch nicht in der Lage, ein Auge zu schließen.
Das Blut sang in seinen Ohren. Er richtete sich ein wenig auf. Stumm lauschte er in die Nacht.
Es waren nicht die Tierstimmen, sondern dieses dumpfe Pochen und Dröhnen, das er hörte. Merkwürdig! Als ob jemand eine Signaltrommel mit bloßen Händen bearbeitete.
Es war Smoky, als passe sich sein Herzschlag dem fremden Rhythmus an, als übernehme die Trommel die Führung. Sie bestimmte seinen Pulsschlag. Sie füllte seinen armen Kopf, der im Fieber glühte.
Fast wurde er süchtig nach diesem Klang. Er legte sich wieder zurück und nahm das Geräusch in sich auf wie eine Heilsbotschaft.
Langsam entspannte er sich.
Ferner und ferner klangen die Trommeln, die zu unbekannten Wesen sprachen, die irgendwo hier in der grünen Hölle hausten. Nicht drohend hörte sich der Ton an, sondern sanft, einschläfernd, von hypnotischem Zwang.
Smoky gelang es sogar, einzuschlafen. Sein Schlaf blieb flach und unruhig. Seine aufgewühlten Sinne tobten sich im Traum aus. Die Bilder hetzten einander. Es gab keinen Zusammenhang, keine Logik, nur Fieberphantasien.
Er sah sich selbst gefesselt in einer Pfahlbauhütte. Unter sich, durch das schadhafte Netzwerk des Schilfrohrbodens, konnte er deutlich den Fluß sehen, der stumm und kühl dahinströmte. Dabei hatte er entsetzlichen Durst. Aber er konnte nicht an das Wasser gelangen, weil etwas seine Hände zusammenschnürte.
Er kämpfte verzweifelt, denn er glaubte sich von aller Welt verlassen. Keine Menschenseele ließ sich blikken. Nur von Ferne, aus der Fieberhölle des dampfenden Dschungels, ertönte ganz leise der Wirbel einer Trommel.
Der Durst steigerte sich. Smoky glaubte zu ersticken.
Mit einem leisen Schrei fuhr er auf. Wild blickte er sich um. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte er, sein Angsttraum sei wahr geworden. Denn zuerst fiel sein Blick auf das grüne Dach der Baumkronen. Zwischen den Ästen und wild gezackten Palmblättern stahl sich bleiches Mondlicht. Ein Spinnengewebe, gegen den hellen Hintergrund, wirkte riesengroß und schien sich wie ein Fangnetz über Smoky zu legen.
„Bleib ruhig, Smoky! Es ist nichts“, flüsterte eine Stimme.
Pete Ballie beugte sich über den Decksältesten.
Smoky stöhnte, Er wischte sich den Schweiß vom Gesicht und sank ermattet zurück.
„Gib mir Wasser, Pete“, bettelte er.
„Wir haben keins.“
Smoky bäumte sich auf. Aus fieberglänzenden Augen starrte er auf seinen Gefährten.
„Hier glänzt alles vor Nässe und du sagst, wir haben nichts zu trinken, verdammt? Willst du mich verkohlen?“
„Schon gut, Smoky. Ich versuche, etwas aufzutreiben. Und bleibe ruhig, bis ich wieder da bin. Die anderen brauchen ihren Schlaf.“
Pete Ballie ging davon.
Merkwürdig, er bewegte sich völlig geräuschlos. Der weiche Waldboden schluckte jedes Geräusch. Nicht ein Ast brach unter seinem Fuß. Wie ein Wesen aus einer anderen Welt watete Ballie durch hüfthohes Farnkraut. Das Mondlicht trug nicht gerade dazu bei, die überhitzte Phantasie Smokys abzukühlen.
Er vergaß alles um sich her. Sein Blick verwirrte sich. Er führte stumme Selbstgespräche. Seine aufgesprungenen Lippen bewegten sich ständig. Die Hände zuckten durch die Luft und führten unkontrollierte Bewegungen aus.
Als Pete Ballie unvermittelt wieder im Blickfeld des Kranken auftauchte, hatte er sich erschreckend verändert. Seine Haare, hell, wirkten im direkten Licht des Mondes plötzlich wie eisgrau. Er schien um Jahre gealtert. Seine Kiefer bewegten sich knackend. Plötzlich grinste der Totenschädel. Smoky brüllte wie am Spieß.
Überall fuhren die Schläfer hoch. Wütender Protest und ungehaltenes Gemurmel ertönten.
Wer erkannte, daß es sich um Smoky handelte, der da geschrien hatte, sank sofort wieder zurück, drehte sich auf die andere Seite und wollte weiterschlafen. Hatte nicht Hasard befohlen, die Wache sei für das Wohlergehen des Verwundeten verantwortlich?
„Was hat er?“ fragte Hasard matt und rieb sich den Schlaf aus den Augen.
„Er will Wasser.“
„Wir haben keins.“
Auch Hasard begab sich wieder zur Ruhe.
Smoky hatte die vertraute Kommandostimme gehört. Dieses Urteil erschien ihm endgültig. Für ihn schien es ein Todesurteil. Er begann zu schluchzen.
„Wir werden alle in dieser grünen Hölle krepieren“, jammerte er.
Pete Ballie setzte sich neben ihn. Beruhigend legte er ihm die Hand auf die Schulter. Seine Kette klirrte leise bei dieser Bewegung.
„Bring mir doch Wasser. Ich verbrenne“, stöhnte Smoky. „Ich kann nicht mehr hoch. Manche Pflanzen saugen sich damit voll. Man muß sie nur abschlagen. Besorge mir was, Pete.“
Seufzend gab Pete Ballie nach.
Argwöhnisch beobachtete ihn Smoky. Er lag halb auf der Seite, den Oberkörper mit dem gesunden Arm abgestützt und hielt Blickverbindung. Er wollte nicht wieder den Anschluß an die Wirklichkeit verlieren. Sein Herz hämmerte wie rasend.
Pete Ballie suchte und suchte.
Plötzlich brüllte er wie am Spieß und wälzte sich am Boden.
Diesmal fuhr auch der letzte Schläfer hoch und sprang auf.
Sie stürzten zu Pete Ballie und halfen ihm, die Quälgeister loszuwerden. Pete Ballie hatte genau in das Kugelnest eines Volkes roter Feuerameisen gegriffen, als er zwischen zwei engstehenden Bäumen durchgeschlüpft war. Die Biester waren über ihn hergefallen und hatten sich mit ihren Kopfzangen überall im Fleisch festgebissen.
Für eine ganze Anzahl von Seewölfen bedeutete das ein paar Stunden Schlaf weniger. Keiner schloß sich aus. Pete Ballie war ein beliebter Mann. Jeder wollte ihm helfen.
Smoky blieb sich selbst überlassen.
Er taumelte hoch, rannte vorwärts, stolperte und blieb mit seiner Handschelle im Unterholz hängen. Dabei stieß er seine verletzte Schulter. Sein Schmerzensschrei alarmierte wiederum alle Männer.
„Himmel, Arsch und Zwirn!“ fluchte Ferris Tucker. „Kriegt man denn überhaupt keine Ruhe in diesem Tollhaus? Was denkt ihr, habe ich die vergangenen Stunden getan? In der Koje gelegen und mich verholt?“
„Du bist von der Teufelsinsel getürmt – wie wir alle“, erwiderte Dan naseweis.
„Bin ich das? Ist nichts Besonderes, wie? Habt ihr alle gemacht, oder? Mann, nachher, als ihr nur noch auf euren krummen Latschen durch den Urwald zu stolpern brauchtet, ihr Blindfische, habe ich einen Pfad durch den verdammten Dschungel geschlagen und mindestens zehn Pfund von den Rippen geschwitzt. Deshalb brauche ich jetzt Ruhe!“
Der rothaarige Riese stand wie ein wütender Büffel da, die riesige Axt in der Hand, die er gerettet hatte.
„Aber gut, wenn ihr mich nicht schlafen laßt, bin ich bereit, als aufrechter Christenmensch auch die andere Wange hinzuhalten: ich werde mich nützlich beschäftigen.“
„Indem du uns die Schädel einschlägst?“ stichelte Dan.
„Indem ich dir deine verdammten Fesseln abnehme“, brummte der Schiffszimmermann. „Besorg mir einen Stein.“
Ein paar Männer liefen los.
Sie alle waren heilfroh, endlich diese spanischen Armbänder loszuwerden, mit denen man sich zwar bewegen konnte, deren Manschetten einem aber ständig die Handgelenke aufscheuerten. Unter dem runden Eisen sammelte sich der Schweiß und reizte die Haut noch mehr.
Drei Mann schleppten einen brauchbaren Stein heran, der hart genug war, um als Unterlage zu dienen.
„Wer will noch mal, wer hat noch nicht?“ rief der Hüne und winkte einladend.
Nach und nach fand sich jeder ein und legte die gefesselten Hände auf den provisorischen Amboß.
„Wenn wir ein Feuer anzünden könnten, ginge alles viel schneller“, brummte Ferris Tucker.
Er hieb zu. Mächtig schwang er die Axt. Die Schneide zerspellte die Kette, die beide Manschetten verband. Soweit spielte jeder noch ungerührt mit. Es war keine Kunst, das Ziel zu treffen.
Aber dann folgte die Feinarbeit. Da wurde dem einen oder anderen schwummerig vor Augen. Er schloß sie lieber, als zu sehen, wie der Schiffszimmermann Maß nahm.
Der Schlag mußte genau die wie ein Lippenpaar vorspringenden Schäkel treffen, an denen die Kettenreste baumelten.
Selten genügte ein Hieb.
Sobald sich das Eisen bog, mußte der Delinquent die Hand drehen, damit Ferris Tucker es von der anderen Seite versuchen konnte. Zweimal unsanft verbogen, gaben die Eisenlamellen meist nach. Aber es gab auch hartnäckigere Fälle. Dann stoben die Funken.
Heller Hammerschlag klang durch den Urwald und vertrieb scheue Nachttiere aus der unmittelbaren Nachbarschaft des provisorischen Lagers.
Einige Langschläfer unter den Seewölfen, die es nicht besonders eilig zu haben schienen, die Ketten der Spanier loszuwerden, verzogen sich schimpfend und grummelnd ins Dikkicht.
Ferris Tucker arbeitete wie ein Berserker. Später löste ihn Big Old Shane ab.
Es dauerte Stunden, bis alle von den Handfesseln befreit waren.
Jeder spürte die Erleichterung, die Hände wieder frei bewegen zu können und die Gewichte los zu sein.
Nur an die Halseisen wagten sich Ferris Tucker und Big Old Shane nicht heran. Nicht mit einer Axt.
„Dazu brauche ich eine Zange“, sagte Big Old Shane bedauernd. „Diesen Schmuck müßt ihr noch eine Weile tragen. Es sei denn, ihr wollt beides gleichzeitig verlieren: die spanische Halskrause und euren Kopf.“
Gegen Morgen hatten sie es mit vereinten Kräften geschafft.
„Und jetzt?“ fragte Ferris Tucker, der bereits griesgrämig festgestellt hatte, daß die Schneide seiner geliebten Axt ruiniert war und Scharten aufwies, die selbst ein neuer Schliff nicht mehr völlig beseitigen würde.
„Wollen wir etwa immer weiter durch diesen lausigen Wald laufen?“ fragte Big Old Shane erbittert. „Soviel Land, wie ich in den letzten Stunden gesehen habe, möchte ich für den Rest meines Lebens nicht mehr betreten. Ich gehöre auf See.“
„Du sprichst uns aus der Seele. Wir müssen die ‚Isabella’ wiederhaben. Koste es, was es wolle“, erwiderte Hasard. „Ich habe nie geplant, ziellos durch den Urwald zu stolpern. So groß ist unsere Angst vor den Spaniern nun auch wieder nicht, oder?“
Höhnisches Gelächter wurde laut.
„Ein sauberes Schiff unter den Füßen, unsere gewohnten Waffen, und wir können uns endlich bei den Dons gebührend bedanken!“ brüllte Luke Morgan. „In Gedanken wetze ich für diesen Tag bereits das Messer. Eine Mütze voller Schlaf hat Wunder bewirkt. Ich könnte sofort losziehen, wenn ich bloß wüßte, wo der richtige Kurs liegt.“
„Das ist doch nicht schwer. Wir müssen an der Küste in südlicher Richtung marschieren“, sagte Ben Brighton.
Er hatte einen bewundernswerten Ortssinn.
„Aber so, daß uns die Spanier nicht entdecken – falls sie uns immer noch suchen“, sagte Gary Andrews.
Gary Andrews, der Fockmastgast, war sehnig und hager. Er sah aus, als habe er zeit seines Lebens bei schmaler Kost und harter Arbeit auf der Teufelsinsel verbracht, unter den Peitschen der Spanier.
Sein Aussehen täuschte. Es gab niemanden, der zäher war als er. Quer über seine Brust verlief eine Narbe, die jedem Betrachter verriet, daß dieser Bursche nicht kleinzukriegen war. Manch anderer war an weniger gestorben.
In Andrews Langschädel saßen helle Augen, die verrieten, daß sie nicht gewohnt waren, auf kurze Entfernungen zu beobachten, sondern die Weite der See vorzogen.
„Die Spanier werden auch die ‚Isabella‘ bewachen“, sagte Matt Davies und kratzte sich ausgiebig mit seiner Spezialprothese den Rücken.
Ihm hatte Tucker einen Ersatz für den verlorenen Arm geschaffen. Eine Ledermanschette lief unten in einen Metallring mit spitzgeschliffenem Haken aus.
„Das soll mich nicht kümmern“, erklärte Big Old Shane. „Zeige mir die Masten der ‚Isabella‘, und ich lege wie der Teufel los. Ich kämpfe mit Zähnen und Klauen, bis ich wieder an Deck stehe.“
„So geht es allen. Aber es ist ein beschwerlicher Marsch dorthin“, sagte Hasard. „So schnell gelangen wir nicht an Bord. Und so leicht sicher auch nicht. Gut Ding will Weile haben. Aber natürlich verlieren wir dieses Ziel nicht aus den Augen. Wann brechen wir auf, Leute?“
„Sofort!“ ertönte die Antwort.
„Ehe uns hier die Moskitos fressen, wir verhungern oder verdursten“, sagte Ferris Tucker heiser.
Wie zur Antwort ging ein heftiger Regenguß nieder. Ungeheure Wassermassen stürzten vom Himmel, der sich schnell mit dunklen Regenwolken überzogen hatte, fast nicht wahrnehmbar für jemanden, der unter dem grünen Blätterdach des Urwaldes stand.
Minuten später, nachdem die Sintflut vorbei war, schien unvermittelt wieder die Sonne und knallte erbarmungslos auf die Lichtung. Der Boden dampfte.
„Eine Sorge wären wir los“, meinte Hasard. „In den Blütenkelchen der Pflanzen hat sich genügend Regenwasser gesammelt. Vergeßt Smoky nicht. Er braucht es am dringendsten.“
Sie mußten sich beeilen, ehe die Sonne das Wasser wieder verdunstet hatte.
Aber ihre Suche wurde immer schwieriger, und sie mußten weiter ausholen, um auf natürliche Reservoirs zu stoßen. So schnell, wie der nasse Segen ihnen erteilt worden war, so schnell wurde er ihnen von der Sonne wieder genommen. Die Hitze wurde infernalisch.
Wenigstens Smoky hatte seinen Durst ausgiebig stillen können. Fast alle hatten mit ihm geteilt und ihm Händeweise das kostbare Naß gebracht. Sie waren mehrfach gelaufen, um den verwundeten Kameraden zu versorgen. Jetzt bauten sie eine Trage aus dem, was sie im Urwald vorfanden. Sie besorgten sich zwei lange Holzstangen und verbanden sie mit Lianen. Dann legten sie Smoky darauf.
„Tut mir leid, daß ich euch soviel Ärger bereite. Ich bin eben ein Pechvogel“, stöhnte der Verletzte.
„Würde ich nicht sagen“, brummte Old Shane. „Du hast ja uns. Also vergiß es. Wir lassen dich nicht in Stich.“
Hasard brauchte keine Träger einzuteilen. Es gab genügend Freiwillige. Die Ablösung würde sich auch von selbst finden. Diese Crew brauchte niemanden, der alles bis ins einzelne regelte oder befahl. Sie waren eine verschworene Gemeinschaft. Da klappte alles wie von selbst, weil nicht jeder nur an sich selbst dachte, sondern an das Ganze. Sie waren mehr denn je aufeinander angewiesen. Ein einzelner konnte im Dschungel mit seinen Gefahren nicht überleben.
Der Kutscher untersuchte eingehend Smokys Wunde. Er zeigte ein bedenkliches Gesicht.
Hasard winkte ihn beiseite. „Wie sieht es aus?“
„Schlimmer, als ich zuerst angenommen habe“, erwiderte der Kutscher. „Zuerst war ich froh, daß der Knochen nichts abbekommen hat und es nur eine Fleischwunde ist. Jetzt sehe ich, daß sich allerhand daraus entwickeln kann. Bald wird er wieder fiebern. Seine Temperatur bereitet mir am meisten Sorgen.“
„Würde es etwas bringen, wenn wir ihm zuliebe den Aufbruch verschieben?“ fragte Hasard.
Der Kutscher schüttelte ernst den Kopf. „Das kann er unterwegs ebensogut durchstehen wie hier. Fieber bleibt Fieber. Entweder der Körper packt es oder nicht. Von mir aus kann die Reise losgehen. Und Smoky wird bald nichts mehr merken, er wird alles vergessen, was um ihn ist. Ich darf ihn nicht aus den Augen lassen.“
Hasard seufzte.
„Es geht weiter, Leute!“ rief er.
Langsam setzte sich der Zug in Bewegung – ein verlorener Haufen ohne Proviant, mit einem Schwerverwundeten, in der Fieberhölle von Guayana.