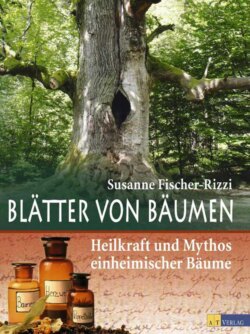Читать книгу Blätter von Bäumen - Susanne Fischer-Rizzi - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Birke
ОглавлениеBetula pendula, Hängebirke
Betula pubescens, Moorbirke
Betula alba, Weißbirke
Familie der Birkengewächse, Betulaceae
AIte Bäume sind etwas Herrliches! Mit ihrem mächtigen Stamm, den kräftigen Ästen und dem riesigen Blätterdach scheinen sie den Himmel zu tragen. Je älter ein Baum wird, umso mehr festigt sich sein ihm ganz eigener Charakter in der Baumgestalt. Er wird immer mehr zur Persönlichkeit. Die Birke macht da eine Ausnahme. Sie ist als junger Baum am schönsten. In ihrer Jugend übertrifft sie alle anderen Bäume an Schönheit und Grazie. Der weiße, schlanke Stamm wirkt elegant, das feingliedrige, zartgrüne Blattkleid anmutig. Sie ist der leibhaftige Frühling. Eine Baumnymphe, die der Birke an einem Frühlingstag entstiege, würde sicher den zarten, blumigen Frauengestalten auf den Bildern Botticellis gleichen. Haselnuss, Birke und Erle gehören alle zur Familie der Birkengewächse. Jeder dieser drei Bäume war für die Menschen das Sinnbild eines bestimmten Punktes im Kreislauf des Lebens: Die Haselnuss steht am Anfang als Baum der Kinder und der Zeugung, die Birke verkörpert die Jugend, das Wachsen und Entstehen, die Erle symbolisiert das Alter, das schon mit dem Geheimnis des Todes vertraut ist.
Die germanische Rune Berkana, die Birke, steht für Mutterschaft, Kindheit und Schutz. Unser heutiger Buchstabe B ähnelt der Berkansrune. Diese Rune symbolisiert die busenähnlichen Zwillingshügel der Kultstätten aus der Jungsteinzeit, die für die nährende Kraft, für die Mutter Erde stehen. Lange hat sich in der europäischen Tradition der Brauch gehalten, Wiegen aus Birkenholz zu fertigen, um die Kinder symbolisch in den Armen von Berkana vor der Macht des Bösen zu schützen.
Das Fest der Birke wird bei uns schon seit uralter Zeit gefeiert, denn die Heimat dieses Baumes sind die nördlichen, gemäßigten und die arktischen Gebiete. Auf Island und Grönland waren die Birken sogar einmal die einzigen Bäume. In diesen Ländern, in denen Väterchen Frost besonders arg wütet, ist die Freude über den Frühling mit den ersten, sich begrünenden Bäumen, Weide und Birke, jeweils besonders groß. Während die Weide das Absterben und die Vergänglichkeit symbolisierte, war die Birke ein Baum des Lebens und der reinen Freude. Ihr Fest war eine Freudenfeier der Wiedergeburt und der Hochzeit zwischen Himmel und Erde. Den Kelten galt die Birke als Baum des Neu anfangs. Daher setzten sie ihn an den Beginn ihres Baumalphabets.
Der bekannteste Brauch um die Birke war der des Maibaums, der noch in unserer Zeit fortlebt. Am 1. Mai holten die Bewohner des Dorfes eine große Birke aus dem Wald, schmückten sie mit bunten Bändern, Eiern, Brezeln und Kuchen. Manchmal wurde der Baum, wie es bei einem russischen Pfingstbrauch üblich war, mit Frauenkleidern behängt und so zur leibhaftigen Frühlingsgöttin gemacht. Mit dem Maibaum holten sich die Dorfbewohner einen Teil der neu erwachten Natur in ihr Dorf und stellten ihn als Pfandauf dem Dorfplatz auf, damit die Frühlingsgöttin ihre Familien segne. Auch für die einzelnen Höfe wurden am 1. Mai kleinere Bäumchen gehauen und vor die Tore und Türen gestellt. An diesem Tag zogen in vielen Gegenden Europas die Menschen singend hinaus in den Wald, um »den Mai zu suchen«.
Auch das »Pfeffern« oder »Schmackostern«, das noch im 19. Jahrhundert weit verbreitet war, hat seinen Ursprung in alten, heidnischen Maifeiern. Frische Birkenzweige wurden zur Lebensrute, mit der die jungen Männer durchs Dorf zogen und die Bevölkerung, besonders die jungen Mädchen, »pfefferten«, das heißt schlugen. Wer mit solch einer Lebensrute eins übergezogen bekam, der war für das weitere Jahr vor Krankheit geschützt.
In der Nacht zum 1. Mai stellten die jungen Männer ihrer Angebeteten ein Birkenbäumchen vors Haus, als Zeichen ihrer Liebe und als symbolischen Heiratsantrag. Dass es gerade in der Nacht zum 1. Mai Liebeserklärungen und Heiratsanträge nur so hagelte, hat seinen Ursprung in sehr alter Zeit. Das Fest der Urmutter – die damals in Form einer Birke verehrt wurde - wurde in allen Kulturen zu Jahresbeginn gefeiert und stand im Zusammenhang mit der geheimnisvollen, heiligen Hochzeit. Die Urmutter und mit ihr die ganze Erde feierte in der Zeit des Neuerwachens der Natur die Hochzeit mit dem Himmel. Beide, Himmel und Erde, müssen sich zusammentun, damit ein neuer Anfang entsteht. Ein Königs- oder Priesterpaar vollzog diese Hochzeit stellvertretend im Tempel, um die Fruchtbarkeit des Landes neu zu erwecken. In Prozessionen trug man die frohe Botschaft des Neubeginns durch das Dorf und auf die Felder hinaus. Hochzeiten, die in diesen Tagen geschlossen wurden, galten als besonders glücklich. Die ausgelassenen Feiern wurden später zu Hexennächten wie der Walpurgisnacht umgemünzt.
Wer war der Bräutigam der schönen Frühlingsgöttin? Auf der Suche nach ihm bin ich auf einen wilden Gesellen gestoßen. Es ist der Laubmann oder Pfingstbutz, der wilde Mann, der grüne Georg, der schließlich zum heiligen Georg wurde. Bei den vorchristlichen Maiumzügen wurde ein männlicher Vegetationsdämon mitgeführt. Es war entweder eine geschmückte Strohpuppe oder ein ganz in Laub und Moos gehüllter Mann. Wahrscheinlich hat er so ähnlich ausgesehen wie die »wilden Männle« aus Oberstdorf, die alle fünf Jahre ihren uralten heidnischen Tanz aufführen, oder wie die vermummten Maskenmenschen bei einer Fastnacht in Süddeutschland. Dieser Dämon war besonders für die Fruchtbarkeit der Haustiere und für das Regenmachen zuständig. Er symbolisierte jedoch auch die Notwendigkeit des Sterbens, damit wieder neues Leben entstehen kann. Deshalb wurde er am Ende der Frühjahrsfeiern in den Bach geworfen oder während eines wilden Reiterfestes besiegt.
Aus dem grünen Georg ist der heilige Georg geworden, der noch heute am Sankt-Georgs-Tag die Pferde segnet. Nach der Christianisierung haben die weltlichen und geistlichen Herren immer wieder versucht, die alten Maifeiern zu verbieten. Es sind Aufzeichnungen von strikten Verboten der Maibäume überliefert. Die adeligen und kirchlichen Waldbesitzer ärgerte es, dass alljährlich viele Birken aus ihrem Waldbesitz geschlagen wurden. Auch störte es den Absolutheitsanspruch der Kirche, dass jedes Jahr zur Maienzeit die alten heidnischen Götter zu neuem Leben erweckt wurden. Aus dem Jahr 1225 ist ein Dokument erhalten geblieben, das von einem Pfarrer Johannes berichtet, der in Aachen versucht hatte, den alten Maibrauch abzuschaffen. Er soll in seinem Eifer den mit Kränzen geschmückten Baum umgehauen haben, und das gerade zu dem Zeitpunkt, als die ganze Gemeinde fröhlich um den Baum tanzte. Die Unternehmung endete, wie es hieß, in einem Tumult, denn die Bürger wollten sich ihr Fest nicht nehmen lassen.
Die Kirchenväter haben schließlich einen Kompromiss geschlossen, und der alte Maibrauch wurde zum Fronleichnamsfest umgewandelt. Jetzt durften die Straßen wieder mit Birkenzweigen und Bäumchen geschmückt werden.
Die Birke ist ein Lichtbaum. In einem dunklen Wald kann sie nicht gedeihen. Birkenwälder sind immer licht und hell, das leichte Blätterdach lässt noch genügend Licht auf den Boden fallen. Zudem reflektiert die weiße Birkenrinde das Licht und wirkt hell und strahlend. Das Wort »Birke« leitet sich von der indogermanischen Sprachwurzel bherg ab, was leuchten, glänzen, strahlen bedeutet.
In einem Birkenwald stellt sich unter den weißen Stämmen dennoch keine reichhaltige Flora ein. Die Wurzeln der Birke holen ihre Nährstoffe nicht nur aus der Tiefe, sondern streichen auch an der Bodenoberfläche entlang und entziehen der oberen Schicht die Nährstoffe. Dadurch bleibt nicht mehr viel übrig für andere Pflanzen.
Dass die Birke auch auf dem feuchtesten Boden gedeihen kann, hat sie bereits vor Jahrtausenden bewiesen. Nachdem sich die Gletscher gegen Ende der Eiszeit zurückgezogen hatten und eine feuchte, baumlose Moorlandschaft zurückließen, gehörte die Birke zu den ersten Bäumen, die das Neuland besiedelten. Noch heute werden Birken auf Ödland, Geröllhalden und feuchten Böden zum Befestigen und zum Entwässern gepflanzt. Sie ist eine wahre Pionierin.
Kein Laubbaum ist so winterhart wie die Birke. Selbst ein eisiger Winter kann ihr nicht schaden, denn ihre luftgepolsterte Rinde ist ein guter Kälteschutz und ist außerdem besonders wasserundurchlässig. Diese Eigenschaften haben sich die Menschen nördlicher Breitengrade zu Nutzen gemacht. Sie stellten aus Birkenrinde Dachschindeln zum Abdecken der Häuser her und schufen so wasserdichte, gut isolierte Dächer. Die Indianer Nordamerikas verwendeten die Rinde zum Bau ihrer besonders leichten Kanus. Der harzige, kampferartige Inhaltsstoff Betulin macht die Rinde fast unzerstörbar. Da die Rinde junger Bäume sich wie Leder gebrauchen lässt, weich und geschmeidig ist, wurde sie früher auch für Schuhe, Schirme und Taschen verwendet; die Lappländer fertigten aus ihr sogar Umhänge und Gamaschen. Noch heute werden in Russland, Skandinavien und Nordkanada aus Birkenrinde schöne Gefäße hergestellt.
Die innere Rinde enthält viel Zucker, Öl und sogar Vitamin C. Sie war für die Indianer und so manchen Trapper oder Goldsucher in besonders strengen Wintern eine Notration, die das Leben retten konnte. Essbar ist aber nur die zarte, gelbe Innenrinde, das Kambium, das vorsichtig abgeschabt werden muss, nachdem man die äußere Rinde entfernt hat. Die Indianer zerschnitten sie in kleine Stücke, trockneten und pulverisierten sie. Aus diesem »Birkenmehl« backten die Frauen eine Art Pfannkuchen und auch Brot. Als Überlebensnahrungsmittel wurde auch in Europa die dünne Innenrindenschicht der Birke in feine Streifen geschnitten und in kochendem Wasser weich gekocht. Man erhält so eine Art Birken-Spaghetti, ein Gericht von süßlichem Geschmack und mit einem hohen Nährwert. Die feinen Schichten unter der Außenhaut von Espen, Tannen, Fichten und Weiden sind ebenfalls roh oder gekocht essbar.
Trauermantel
Ein weiteres Merkmal der Rinde ist ihr hoher Gehalt an Gerbstoff. Deshalb wurde sie auch üblicherweise zum Gerben gebraucht. Die mit Birkenrinde behandelten Felle verströmen einen intensiven, würzigen Geruch, durch den sich »Juchtenleder«, mit Birkenrinde gegerbte Felle, von den mit anderen Gerbmitteln gegerbten Fellen unterscheiden.
Birkenrinde blättert nicht in dicken Schuppen ab, sondern schält sich elegant in papierähnlichen Querbändern. Dieses »Baumpapier« war früher ein billiges Schreibmaterial. Das älteste beschriebene Birkenpapier ist ein Manuskript aus Turkestan, das aus der Zeit von 350 nach Christus stammt. Es wurde 1893 von Kapitän H. Bower entdeckt.
Die feine, dünne, papierähnliche äußere Schicht der Birkenrinde, ist zudem das beste Material in der Natur, um ein Feuer, speziell bei feuchter Witterung oder bei Regen, zu entzünden. Durch den hohen Gehalt an ätherischen Ölen brennt es selbst in frischem Zustand (siehe mein Buch »Mit der Wildnis verbunden«). Hieronymus Bock berichtet darüber in seinem Kräuterbuch aus dem 16. Jahrhundert:
»Der Birkenbaum ist vor zeitten in grosser würde gewesen / darumb das man auff die weissen Rinden des selben baums etwan geschriben / ehe dann die lumpen zum Papyr erfunden seind worden / wie ich danselbs zu Chur im Schweitzerland etlich Carmina Vergilii auff weisse Birkenrinden geschriben / gesehen und gelesen hab.«
Als Bauholz eignet sich Birkenholz nicht besonders gut, ergibt jedoch ein Furnier mit schönem seidigen Glanz. Seine Qualitäten entfaltet es aber als Kaminholz; es ergibt ein helles, strahlendes Feuer. Und es ist ein Geheimtipp für alle, die im nassen Wald ein Feuer entfachen müssen. Das Holz brennt auch in frischem und feuchtem Zustand durch den eingelagerten Birkenteer.
An Birken wächst oft deutlich sichtbar ein Baumpilz, der Birkenporling, Piptoporus betulinus. Er ist halbkreis- bis nierenförmig und besitzt einen dicken stielartigen Ansatz, mit dem er am Stamm des Baumes befestigt ist. Seine Oberseite ist kissenartig gewölbt. In der Jugend ist er hellgrau, weißlich bis bräunlich, im Alter braun und rissig. Das weiße Fleisch frischer Pilze wurde in früheren Zeiten in dicke Scheiben geschnitten und zum Schleifen für Messer und Schwertklingen verwendet.