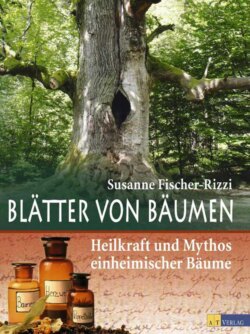Читать книгу Blätter von Bäumen - Susanne Fischer-Rizzi - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Birnbaum
ОглавлениеPyrus communis
Familie der Rosengewächse, Rosaceae
Der Birnbaum, der heute in unseren Obstgärten steht, war einmal ein kleiner, struppiger Baum mit aufrechten, dornenbesetzten Zweigen. Schon im Altertum war es den Griechen gelungen, ihn so zu veredeln, dass aus den kleinen, sauren Holzbirnen große, süße Früchte wurden. Die Römer übernahmen diese veredelte Art und kultivierten bereits im ersten Jahrhundert nach Christus über vierzig Birnenarten in ihren Gärten.
Den Wildbirnenbaum gibt es heute noch, er wächst verstreut in den Wäldern Europas. Im Frühjahr, wenn die dunklen Äste mit weißlichen Blüten übersät sind, leuchtet er zwischen den anderen Bäumen hervor. Er gehört wie unsere anderen Obstbäume auch zur Familie der Rosengewächse.
Birnbaum und Apfelbaum gelten als das »Paar« im Obstgarten. Wurde der Apfelbaum schon seit Urzeiten mit dem weiblichen Element in Zusammenhang gebracht, so symbolisierte der Birnbaum das männliche Element. So sagt auch eine alte Bauernregel: »Willst du ein Kuhkalb, so vergrabe die Nachgeburt einer Kuh unter einem Apfelbaum, wünschst du lieber beim nächsten Mal ein Stierkalb, so vergrabe die Nachgeburt unter einem Birnbaum.« Durch ihre Symbolik als Paar wurden beide, Apfel- und Birnbaum, für Liebesorakel gebraucht. Der Apfelbaum sollte die Fragen der jungen Männer beantworten, während es die Mädchen mehr zum Birnbaum hinzog. In den Rauhnächten zwischen Weihnachten und Neujahr holten sie sich Auskunft über den Ablauf des kommenden Jahres. Um Mitternacht schlichen sich die Mädchen zum alten Birnbaum hinter dem Hof. Sie schlüpften aus ihren Holzschuhen und warfen sie auf den Baum. Blieb der Schuh an einem Zweig hängen, so würde ein schöner Freier im nächsten Jahr an ihr »hängen bleiben«.
Man sprach dem Birnbaum auch die Fähigkeit zu, dem Menschen eine Krankheit abzunehmen. Eine sehr alte und merkwürdige Vorstellung, die weit zurückreicht, ist die von der Krankheitsentstehung durch Insekten und Würmer. Im Mittelalter glaubte man, dass sich in der Rinde und in den Wurzeln der Bäume diese krankheitserzeugenden Tiere aufhielten, die so klein sein sollten, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Diese Tiere, so glaubte man, könnten in den Körper des Menschen eindringen und bestimmte Krankheiten verursachen. Typische »Wurmkrankheiten« waren Schwindsucht, Kopfschmerzen, Magenkrankheiten und Zahnschmerzen. Diese Vorstellungen finden sich auch in der alten Heilkunde der Inder und Chinesen und lassen sich bis in die Zeit der Assyrer und Babylonier zurückverfolgen. Bei verschiedenen Eingeborenenstämmen Südamerikas ist es noch heute die Aufgabe des Medizinmanns, die krankheitserzeugenden Würmer aus dem Körper des Patienten zu vertreiben. Und selbst noch in unserer Zeit werden einige Krankheiten mit Namen bezeichnet, die sich aus diesen alten Vorstellungen herleiten. Das Nagelgeschwür Panaritium ist vielen nur unter dem Namen »Fingerwurm« bekannt.
War dieser Glaube vielleicht eine Ahnung der erst viel später entdeckten Bakterien und Viren? Half bei einer dieser Krankheiten kein Mittel mehr, so suchte sich der Kranke einen geeigneten Baum, den er »anklagte«. Folgender Spruch sollte beim Umschreiten eines Birnbaumes aufgesagt werden, um die Krankheit auf den Baum zu über tragen:
»Birnbaum, ich klage dir
Drei Würmer, die stechen mir.
Der eine ist grau,
der andere ist blau,
der dritte ist rot,
ich wollte wünschen, sie wären alle drei todt.«
Trotz ihres sauren Geschmacks hat man für die Holzbirnen schon immer eine Verwendung gefunden. Um einen guten Obstwein zu brauen, mischte man einige Holzbirnen unter die veredelten Birnen. Auch Marmeladen und Gelees bekommen einen würzigeren Geschmack, wenn man einige kleine Wildbirnen mitkocht.
Selbst die Birnenkerne nützte man früher noch. In Notzeiten, wenn das Speiseöl knapp war, bereitete man aus ihnen ein gutes Speiseöl. In einem Kräuterbuch aus dem Jahre 1874 fand ich eine Anleitung dafür: Aus 25 Teilen Birnenkerne erhält man 3 Teile Öl.
Was man am wilden Birnbaum am meisten schätzte, war sein Holz. Hart, fein und gleichmäßig gemasert, war es ein bevorzugtes Holz für Bildhauer und Holzschnitzer, die daraus unter anderem Formen für die Zuckerbäcker schnitzten. Noch heute schätzt man es als besonders wertvolles Holz für den Möbelbau. Das Holz des Wildbirnenbaums ist noch härter als das des veredelten Birnbaums. Um ein möglichst festes und widerstandsfähiges Holz zu erhalten, fällte man früher die Bäume nur zu ganz bestimmten Zeiten. Im Winter bei Neumond an einem Nordhang geschlagenes Holz galt als das beste. Noch im Wald wurde es gespalten und zuhause an einem luftigen Ort lange gelagert. In dieser Weise vorbereitet, ist das Holz tatsächlich viel fester und widerstandsfähiger als anderes Holz. In einer Zeit, in der es noch nicht die heutigen künstlichen (und im Übrigen stark giftigen) Imprägnierungsmittel gab, war man auf diese Erfahrungen angewiesen. In alten Holzhäusern tragen selbst jahrhundertealte Holzbalken schwere Decken, ohne von Holzschädlingen befallen zu sein.
Das Holz des Birnbaums beizte man gelegentlich mit Pflanzensäften schwarz und erhielt so ein dem Ebenholz sehr ähnliches Holz, das man besonders gern zur Herstellung von Truhen verwendete.