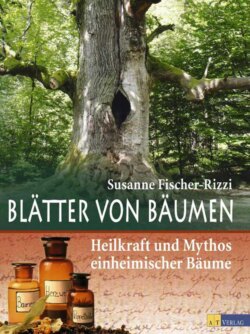Читать книгу Blätter von Bäumen - Susanne Fischer-Rizzi - Страница 57
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Buche
ОглавлениеFagus silvatica
Familie der Buchengewächse, Fagaceae
Während der Eiszeit waren große Teile Westeuropas von großen Gletschern bedeckt, die sich von Skandinavien im Norden und von den Alpen im Süden her über das Land geschoben haben. Nur ein schmaler Streifen Land blieb übrig, der eine baumlose Tundralandschaft trug. Die großen Bäume waren verschwunden; sie überlebten in wärmeren Gegenden, am Mittelmeer und im Balkangebiet. Vor rund 15 000 Jahren wurde es dann etwas wärmer, und die Bäume breiteten sich langsam von ihren südlichen Bauminseln wieder in Richtung ihrer alten Standorte aus. Nach der Mittleren Wärmezeit, nachdem die meisten größeren Bäume bei uns wieder Fuß gefasst hatten, änderte sich das Klima erneut. Es wurde kühler und feuchter. Damit herrschte ein optimales Klima für die Buchen, die zu Beginn der Bronzezeit zusammen mit den Tannen als die letzten der großen Bäume zurückgekehrt waren. Einige Baumarten blieben allerdings auf der Strecke, und wir können sie heute nicht mehr zu unseren einheimischen Bäumen zählen. Riesige Mammutbäume gehören zu den niemals zurückgekehrten Flüchtlingen.
Diese genaue Kenntnis über die Entwicklung der Vegetation unseres Landes verdanken wir den Mooren. Sie sind riesige lebendige Archive, die jede Veränderung genau registrieren. Blätter, Samen, Holzstücke aus der jeweiligen Pflanzenwelt werden im Moor chronologisch übereinandergeschichtet. Alles, was das Moor einmal geschluckt hat, konserviert es für viele tausend Jahre, und deshalb ist dieses peinlich genau geführte Archiv schon so alt. Eine Häufung von Pflanzenteilen einer bestimmten Baumart lässt darauf schließen, dass diese Baumart zu der betreffenden Zeit vorherrschend war.
Seit der letzten, oben beschriebenen Klimaveränderung, die die Buchenzeit eingeleitet hat, hielt sich das feuchtkühle Klima in unseren Breiten bis heute. Ohne Eingreifen des Menschen wäre ein großer Teil Mitteleuropas hauptsächlich von Buchenwäldern bedeckt. In den niederen Lagen würden Eichen die Buchen begleiten, Fichten ständen an ihren natürlichen Standorten – im Mittel- und Hochgebirge –, und die Flüsse wären vom schmalen Band des Auenwalds begleitet.
Die Buche hat es schon damals, bald nach ihrer Einwanderung, geschafft, die anderen Bäume zu verdrängen. In Konkurrenz mit ihr bleiben Eiche, Ahorn und Fichte zurück. Dabei wirkt die Buche gar nicht so kämpferisch. Im Gegenteil, sie steht wie eine grazile Königin mit silbrigem Rindenkleid und zartgrünem, gläsernem Blattschleier neben dem knorrigen Eichenkönig. Ihre lang gestreckten Äste verzweigen sich im feinen Filigranwerk der äußersten Zweige und enden in länglichen, rehbraunen Knospen, die Tupfer vom samtenen Silber des Stammes tragen. Im Frühjahr strecken sich diese spitzen Knospen immer mehr, bis sich endlich neue Blätter herausschieben und die Knospenhülle abstreifen. Es gibt keine zarteren Frühlingsblätter als die der Buche. Sie sind mit seidigen, glänzenden Wimpern bedeckt und scheinen in der Sonne so hellgrün, als wären sie aus venezianischem Glas.
Alle Blätter sind an den fächerartig verzweigten Ästen so dicht und exakt übereinandergestellt, dass sehr wenig Licht durch das Blätterdach auf den Boden fällt. Eine alte Buche mit rund fünfzehn Metern Kronendurchmesser hat etwa 600 000 Blätter, die zusammen eine Fläche von etwa 1200 Quadratmetern ergeben. Für die Buche ist dieser Schatten lebenswichtig. Sie umhüllt ihren Stamm nicht mit einer dicken, schützenden Rindenschicht und muss ihn deshalb auf andere Art vor Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen schützen. Auch ihre flach am Boden entlang streichenden Wurzeln brauchen Sonnenschutz. So raubt die Buche den anderen emporwachsenden Bäumen das Licht. Den jungen Buchen schadet das Dämmerlicht nicht, doch junge Eichen, Fichten oder ein kleiner Ahornbaum können sich nicht mehr durchsetzen.
Der Buchenwald hat wegen dieser besonderen Lichtverhältnisse seine eigene Flora. Die Blumen im Schatten der Buchen müssen sich mit ihrer Blüte beeilen, denn sobald die Bäume über ihnen sich anschicken, ihr Blättergewölbe zu schließen, bleibt darunter nicht mehr genügend Licht für die Entwicklung einer Blütenpracht. Deshalb ist der goldbraune Blattteppich unter den Buchen schon zeitig im Frühling mit bunten Blüten bestickt: mit den weißen Sternen des Buschwindröschens, dem leuchtenden Blau der Leberblümchen, der kühnen rotvioletten Komposition des Lungenkrauts, dem Biedermeierblau der Veilchen und den hellgelben Kelchen der Himmelsschlüssel. Diese Pflanzen lieben wie die Buchen den feuchten Kalkboden. Die schönsten geschlossenen Buchenwälder finden sich deshalb auf kalkreichen Böden wie auf der Schwäbischen Alb und im Fränkischen Jura.
Umweltverschmutzung und Klimaveränderung setzen den Bäumen stark zu. In Deutschland ist inzwischen nur noch jeder dritte Baum gesund. Zurzeit sind die Buchen am stärksten geschädigt.
Schon früh allerdings hat der Mensch begonnen, die Buchen zu dezimieren. Im Mittelalter gehörten Buchen wie Eichen zu den »fruchtbaren« Bäumen. Der botanische Name Fagus leitet sich vom griechischen Wort für Essen ab. Wahrscheinlich war damit der Gebrauch der Eckern zur Schweinemast gemeint. Der Dorfhirte trieb seine Schweineherde in den Wald und schlug die Früchte der Buchen, die Bucheckern, von den Bäumen, über die dann die Schweine schmatzend herfielen. »Die Schwein haben sonderlich lust zu diesen Buchnusslein / und wird das Fleisch wolgeschmack und lieblich darvon. Wie wol der Speck der von Buchackeren gemästeten Schweinen nicht so fein hart ist / wie der von Eicheln / sondern wenn er in dem Rauch und Schornsteinen henckt / gewaltig tropfft.« So berichtet Adamus Lonicerus in seinem 1679 erschienenen Kräuterbuch über die damalige Eckernmast. Auch das übrige Vieh wurde in den Wald getrieben: Ziegen, Schafe und Rinder taten sich besonders gern an den jungen, schmackhaften Buchentrieben gütlich.
Im Herbst zog man zur Bucheckernernte in den Wald. Aus den ölhaltigen Früchten wurde ein Speiseöl hergestellt. Die Arbeit lohnte sich, denn die Eckern enthalten bis zu vierzig Prozent Fett. Sie wurden in Ölmühlen zerkleinert und anschließend gepresst. Aus einem Kilogramm Buchekkern erhielt man immerhin einen halben Liter gutes Speiseöl. Der übrig gebliebene Ölkuchen diente als Schweinemastfutter. Der Volksmund weiß übrigens, dass reichlich Bucheckern im Herbst einen langen und harten Winter ankündigen.
Das Holz der Buche ist auch heute noch als sehr wertvolles Brennholz geschätzt. Als Bauholz eignet es sich weniger, da es leicht reißt, brüchig wird und zudem gern von Schädlingen befallen wird. Es arbeitet nach der Verarbeitung noch stark und schwindet leicht. Deshalb wird es nur zur Werkzeugherstellung sowie für Dübel und Schwellen gebraucht. Dennoch hatten die Buchen bei uns unter Raubbau zu leiden. Das Holz wurde in großen Mengen in der Köhlerei zur Holzkohleherstellung verwendet. Der Bergbau und die Hüttenbetriebe verschlangen ebenfalls Unmengen. In den Glashütten wurde die Buchenasche an Stelle des heute verwendeten Sodas gebraucht.
Die Buchenasche, die sich in den Herdstellen und Öfen ansammelte, war früher ein gebräuchliches Ausgangsmaterial zur Herstellung einer Lauge. Die Asche enthält sehr viele Kaliumverbindungen, und die daraus zubereitete Lauge schäumt und reinigt wie Seifenlauge. Dazu wurde die Buchenasche einfach mit lauwarmem Wasser übergossen und über Nacht stehen gelassen. Am nächsten Morgen seihte man die Brühe ab. Mit der aus Buchenasche hergestellten Lauge wurden Fußböden geschrubbt; und die Holzgefäße, die zur Aufbewahrung von Milch und Käse dienten, hielt man keimfrei, indem man sie öfter mit Buchenlauge reinigte. Asche, die man nicht im Haushalt zur Laugenherstellung brauchte, streute man als Dünger auf die Felder.
»Eichen sollst du weichen,
Vor Fichten sollst du flüchten,
Weiden sollst du meiden,
Buchen aber suchen.«
So lautet der Ratschlag im Volksglauben. Da der Blitz tatsächlich sehr selten in Buchen einschlägt, suchte man früher beim Aufzug eines Gewitters unter Buchen Schutz.
So manche alte Buche im Park trägt heute noch auf ihrer Rinde viele eingeritzte Zeichen. Es sind die Herzen und Namen derer, über die die Buche einmal schützend ihre weit ausladenden Äste gebreitet hat. Sie hat schon die Liebespaare unter ihrem Dach beherbergt, die heute vielleicht längst Großmütter und Großväter sind. Die Herzen haben sich mit der Zeit etwas verzogen und sind dunkler geworden, aber sie sind noch immer in dem alten Baum-Buch aufgezeichnet.
Schon oft sind mir auch die scheinbar etwas unheimlich starrenden schwarzen Augen auf ihrem Stamm aufgefallen. Zuerst dachte ich, auch sie wären eingeritzt, aber dann stellte ich fest, dass es Verwachsungen sind, die der Baum bildet, wenn ein Ast abgefallen ist.
Wie aus Buchenstäben unsere heutigen Buchstaben wurden, ist eine alte Geschichte. Dazu beigetragen hat die Buche mit ihrer besonders glatten Rinde. Vor langer Zeit waren es nicht nur Herzen, Pfeile oder Namen, die in die Buchenrinde geritzt wurden, sondern Zauberzeichen und magische Buchstaben. Es waren die Buchstaben der kultischen Schrift der Germanen, die sie runa nannten, das Geheimnis. In bestimmter Folge aneinandergereiht, hatten diese geheimen Zeichen die Kraft zu heilen, zu schützen und die Zukunft vorauszusagen.
Ursprünglich, um die Zeitenwende, enthielt das Alphabet 24 Buchstaben, die ausschließlich zu kultischen Zwecken gebraucht wurden. Vor einer wichtigen Entscheidung befragte man das Orakel aus Buchenstäben, auf die die geheimen Schriftzeichen geritzt waren. Uns ist noch eine genaue Beschreibung dieses Orakels erhalten geblieben. Tacitus, der Geschichtsschreiber der römischen Kaiserzeit, hat im ersten Jahrhundert nach der Zeitenwende in seiner Studie über die Germanen auch das Loswerfen mit Buchenstäben beschrieben: Der Priester oder die Priesterin bricht einen Buchenstab in gleich große Teile, beschriftet diese mit Runen und legt sie in eine Schale. Ein weißes Tuch wird auf die Erde gebreitet, und die Stäbe werden darauf geworfen. Nach Anrufung der Götter wird dreimal je ein Stab aufgehoben. Aus der Kombination der drei Stäbe ergibt sich der Orakelspruch. Runen oder Raunen, das ist eine geheimnisvolle Beratung mit den Göttern, die sich in den Formen der Natur offenbaren.
Die alten Runenstäbe gibt es nicht mehr, doch die lebendigen Runen schreibt die Natur noch immer in der schwungvollen Biegung eines Astes, im feinen Aderwerk eines Blattes, im Fraßbild des Baumkäfers oder in den Wolkenbildern am Himmel. Die weissagenden Nornen, die Schicksalsgöttinnen der Germanen, raunen noch immer ihre Geheimnisse dem zu, der Zeit hat, ihnen im Rauschen der Bäume, im Murmeln des Wassers oder im feinen Summen eines Käfers zu lauschen.
Die deutschen Worte Buche und Buch haben denselben etymologischen Ursprung. Buch leitet sich vom gotischen Wortstamm boka ab, was Buchstabe bedeutet. Im Jahr 1450 erfand Johannes Gutenberg die Druckerpresse. Er hatte aus Buchenholz einen Buchstaben geschnitzt und diesen in Papier eingewickelt. Der Abdruck, den er auf dem Papier hinterließ, inspirierte ihn zur Idee, Buchstaben zu drucken.
An Buchen wie auch an Birken, toten wie lebendigen, wächst ein Pilz, der früher eine große Bedeutung hatte, der Zunderschwamm, Fomes fomentarius. Sein Fruchtkörper wächst konsolförmig, seine Oberfläche ist tief konzentrisch gefurcht. Junge Pilze sind rotbraun, später werden sie haselnussbraun und im Alter sind sie grau mit dunkleren wellenförmigen Bändern. Hat der Pilz einen Winter hinter sich, bleibt seine Haut grau bis dunkelgrau. Beim Aufschneiden glänzt das Fruchtfleisch rotbraun. Der echte Zunderpilz ist leicht mit ähnlich aussehenden anderen Pilzen zu verwechseln. Absolute Sicherheit erhält man durch folgenden Test: Man gießt einige Tropfen 20%-ige Kalilauge in eine Tasse und schabt von der äußeren hellgrauen Rinde des Pilzes einige Späne in die Tasse. Färbt sich die Lauge nun rotbraun, handelt es sich um den echten Zunderpilz.
Der Zunderpilz gehörte zu den heiligen, magischen Gewächsen unserer Vorfahren. In früheren Zeiten befestigte man die Pilze an der Eingangstür als Schutz und Abwehr vor bösen Einflüssen. Noch heute kann man in entlegenen Alpentälern an alten Bauernhäusern diesen Pilz nahe dem Eingang an der Hauswand sehen. Es wird angenommen, dass der Zunderpilz, der bereits vor 120 000 Jahren an der in der eiszeitlichen Tundra wachsenden Zwergbirke vorkam, den damaligen Menschen erlaubte, Feuer zu entfachen und damit als eine Grundlage der weiteren kulturellen Entwicklung diente.
Der Ausspruch »Das brennt wie Zunder« erinnert noch an die einstige, uralte Verwendung des Pilzes. Die wildlederartige Schicht und die Borke des Fruchtkörpers wurden in früheren Zeiten entfernt und als Zunder gebraucht. Es nimmt kleinste Funken auf und hält sich als Glutherd, den man dann leicht zum Feuerentfachen verwenden kann. Bis zur Erfindung und Verbreitung der Schwefelhölzchen, der Streichhölzer, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, gab es in jedem Haushalt Zunderpilzlappen. Mit Feuereisen und Flintstein wurden darüber Funken erzeugt, die auf den Zunderlappen fielen, dort Glut bildeten und dann zum Anzünden von Zigarren oder des Herdfeuers dienten.
Zunderpilz war lange Zeit eine wichtige Handelsware. Ich nenne die Zunderpilzlappen das Goretex der Steinzeit, denn sie sind wasserabweisend, atmungsaktiv und federleicht. Im Mittelalter hat man in Mitteleuropa daraus Kappen, Gamaschen und Regenumhänge hergestellt. Zunderpilzlappen stillen auch Blutungen und wirken wundheilend und wurden deshalb in früheren Zeiten unter der Bezeichnung Fungus chirurgorum verkauft.
Als Speisepilz eignet sich der Zunderpilz nicht. Am Baum selbst verursacht er Weißfäule und gilt deshalb als Schädling von Birke und Buche.