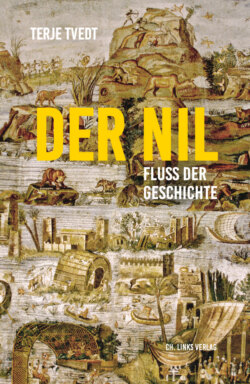Читать книгу Der Nil - Terje Tvedt - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die verschwundenen Städte und Flüsse
ОглавлениеGeht man an den Stränden von Alexandria entlang, wo die Wellen auf kilometerlange Abschnitte mit weißem Sand treffen und wo die Sonne mit all den typischen Merkmalen eines triumphierenden Sonnenuntergangs im östlichen Mittelmeer hinter der Burg heruntersinkt, wo einst der Pharos-Leuchtturm stand, kommt es einem geradezu unnatürlich vor, dass es sich bei Alexandria um eine Stadt am Nil handelt. Die fünfzehn Kilometer lange Corniche, die berühmte Strandpromenade mit der parallel dazu verlaufenden Autobahn, ist das zum Meer hin gerichtete Gesicht der Stadt. Genauso wie die Entwicklung des städtischen Raums, die Architektur der Straßen, die Ästhetik der Abwasseranlagen oder die sich verändernden Funktionen der Müllhaufen für das Verständnis der Geschichte einer Gesellschaft unabdingbar sind, sofern diese nicht völlig blutleer und letztlich unmenschlich daherkommen soll, muss auch die Geschichte über den Nil mehr enthalten als nur die Ideen und Planungen der Menschen. Eine lebendige Geschichte, die den handelnden Menschen ins Zentrum rückt, muss auch die Natur, die ökologischen Prozesse und die technologische Anpassung berücksichtigen. Sie muss, anders ausgedrückt, Strukturen analysieren, welche permanent verschiedene und sich ändernde Rahmenbedingungen für das handelnde Individuum definieren, die aber auch von diesem beeinflusst werden – sei es ein Heerführer, ein moderner Ingenieur oder ein Politiker.
An einem Julitag im Jahr 1961 begab sich ein Amateurtaucher gleich unterhalb der Promenade von Alexandria in das verunreinigte Hafenbecken. Plötzlich befand er sich in einer Welt des Altertums: Er sah eine von weißen Marmorsäulen gesäumte Treppe, eine lebensgroße römische Statue, eine Goldmünze, einen Sarkophag und, nicht weit entfernt von dem mächtigen Fort, das über Jahrhunderte die Stadt bewachte, zwei kopflose Sphinxen, Marmorsäulen sowie eine massive, in zwei Teile zerbrochene Statue. Kamel Abdul-Saadat, der sein Geld als Speerfischer verdiente, hatte die versunkene Vergangenheit Ägyptens entdeckt.
Nur einen Steinwurf von der Qāitbāy-Zitadelle entfernt, in Sichtweite der Promenade und der modernen Bibliothek, kann man heute in eine stille, versunkene Altertumswelt hinabtauchen. Seltsame Gebilde liegen auf dem Meeresboden verstreut. Die größten Schätze Alexandrias, darunter die Ruinen von Kleopatras Palast, liegen dort sechs bis acht Meter unter der Wasseroberfläche. Erblickt man durch seine Taucherbrille ein schwarzes Gesicht und starrende Augen, ist es eine Sphinx, die hier seit Tausenden von Jahren ungestört ruht.
Auf dem Meeresboden vor dem Nildelta sind bis heute 25 antike Städte entdeckt worden. Diese Städte zeugen von vielen Geschichten und zahlreichen Schicksalen, doch in erster Line verdeutlichen sie, dass der Nil als Fluss seine eigene Geschichte hat, so wie die Menschen, die an seinen Ufern leben, ihre Geschichten haben. Dank Herodot wissen wir heute, dass es zu seinen Lebzeiten drei Nebenarme des Nils gab, die fünf bis 15 Kilometer östlich von Alexandria ins Meer flossen, heute existiert nur noch einer.10 Darüber hinaus gab es vier kleinere Mündungsarme, den Saitischen Arm, den Mendesischen Arm, den Bursurischen Arm sowie den Bolbitinischen Arm, wobei die beiden Letztgenannten teilweise künstlich angelegt waren. Herodots gründliche Sachlichkeit lässt sein Buch noch heute direkt zum Leser sprechen, auch wenn manche Teile davon definitiv einem »fremden Land« mit einer Gedankenwelt angehören, die sich gänzlich von der modernen Rationalität unterscheidet.
Bei Herodot finden wir Beschreibungen des Nilsystems, die sein Buch heute relevanter und aktueller erscheinen lassen als so manche Artikel in den Zeitungen der Gegenwart. Wenn er beschreibt, wie sich der Fluss im Delta verändert hat, spricht er unmittelbar zu unserer modernen Zeit; er spricht die Sprache der Rationalität, auch wenn klar ist, dass der Fluss, den er betrachtet, in einem ganz anderen Gedankenuniversum existiert. Herodot hebt die Rolle des Nils in der Geschichte des Menschen hervor und zeigt zugleich, dass der Fluss seine eigene Geschichte hat.
Als er im Delta umherwanderte, hatte das Flusssystem seit dem 8. Jahrtausend v. Chr. bereits große Veränderungen durchgemacht. Damals war das spätere fruchtbare Nildelta noch eine Sumpflandschaft, die von einem Fluss mit undefinierten Uferlinien durchschnitten wurde; dichte Papyrus-wälder boten großartigen Lebensraum und Schutz für Flusspferde, Krokodile und Vögel. Bis etwa 3000 v. Chr. war das Mittelmeer um circa 20 Meter angestiegen. In vorhistorischer Zeit war das Delta eine gigantische Flussmündung mit vereinzelten Inseln. Im Laufe der Jahrtausende bildeten die Ablagerungen des Nils Landflächen, welche die Mündung in unzählige Verästelungen aufteilten. Der Wissenschaft wird es vermutlich nie gelingen, genau herauszufinden, was sich in diesen Jahrtausenden zutrug. Wir wissen jedoch, dass die Flüsse, welche das Delta kreuzten, ihren Lauf änderten, und dass Teile des Gebiets nach und nach im Meer versanken. Als Herodot um 400 v. Chr. seine Historien schrieb, schilderte er also die Städte im Nildelta nicht nur, als handele es sich dabei um Inseln in der Adria, die inmitten eines sumpfartigen Gebiets lagen und den natürlichen Schwankungen des Flusses angepasst waren. Er beschrieb auch Flüsse und Städte, die bis zum Jahr 1000 v. Chr. bereits verschwunden waren.
Unterwasserarchäologen haben mittlerweile rekonstruiert, wo einer der von Herodot beschriebenen Flussläufe, der Kanobische Arm, ins Meer floss. An seiner Mündung lag Herakleion, benannt nach dem griechischen Götterhelden Herakles, den schon die Griechen (einschließlich des Orakels von Delphi) als Nachkommen des viel älteren ägyptischen Herkules betrachteten. Der griechische Historiker Diodoros erzählt, wie es Herkules gelang, eine Flut einzudämmen und den Fluss in sein natürliches Bett zurückzuzwingen. Daraufhin wurde zu seinen Ehren ein Tempel erbaut und der Ort nach ihm benannt. In Herakleion gab es zudem zahlreiche Tempel zu Ehren der Nilgötter, und als religiöses Zentrum zog es Pilger aus dem gesamten Mittelmeerraum an. In alten Texten wird die Stadt als eine Art Pforte nach Ägypten beschrieben. Von hier aus konnte man den Nil hinaufsegeln und gelangte bis nach Memphis oder Theben.
Der Kanobische Arm war einer von vielen Flussläufen, die verschwanden und dabei die an ihren Ufern liegenden Städte aus der Geschichte tilgten. Schon in pharaonischer Zeit wurden Projekte begonnen, um den Fluss zu kontrollieren, und die Pyramidentexte dokumentieren, dass Kanäle für Transport und Bewässerung gegraben wurden. Diese wurden später zerstört, aber nicht nur durch die dem Fluss eigene unbarmherzige ökologische Logik, sondern weil die Pharaonen etwa 300 v. Chr. den Bolbitinischen Arm erweiterten. Da dieser nun größere Mengen Wasser führte, blieb für den Kanobischen Arm weniger Wasser übrig, was schließlich zu seinem Ende führte. Herakleion ist eine der Städte, die von Unterwasserarchäologen inzwischen entdeckt wurden. Sie wird als intakt beschrieben, wie eingefroren in der Zeit.
Herodots mehr als 2000 Jahre alte Historien haben also eine neue Aktualität gewonnen. Aufgrund seiner Aufzeichnungen über die städtischen Gesellschaften, die er sah, sowie beruhend auf seinen Beschreibungen über ihre Lage an Flussläufen, die es heute nicht mehr gibt, haben Archäologen Material in die Hände bekommen, mit dem sich weiter arbeiten lässt. Ebenso können Menschen, die glauben und fürchten, dass Teile des Deltas im Meer versinken werden, auf Herodots historische Beispiele verweisen. In einer langen ökologischen Perspektive des Nils verweisen sie auf eine möglicherweise alarmierende Zukunft, eine Zukunft, von der einige meinen, sie könnte bereits in diesem Jahrhundert Realität werden. Die uralte Vergangenheit ist dementsprechend auf eine Art und Weise gegenwärtig geworden, die sich den üblichen Methoden zur Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Gegenwart entzieht: Die Vergangenheit ist nicht länger bloß ein »fremdes Land«.