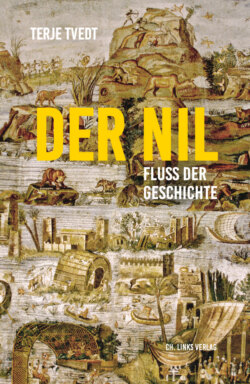Читать книгу Der Nil - Terje Tvedt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fluss der Geschichte
ОглавлениеNach Überquerung des Mittelmeeres sehe ich auf dem Flug von Rom auf kilometerlange Sandstrände hinunter; im Westen endlose braune Wüste, und unter mir ein gigantischer grüner Garten. Wie üblich mit der Stirn am Fenster klebend, fliege ich über das Nildelta und nach Ägypten hinein. Während ich den Fluss als einsame glitzernde Lebensader unter mir sehe, umkränzt von Grün, das sich als lebendiger Protest gegen die Dominanz der Wüste richtet, merke ich, wie meine nordeuropäische Blindheit für die Bedeutung des Wassers allmählich nachlässt. Ich bin nach Ägypten gekommen, um auf einer Konferenz in der Bibliothek von Alexandria den Eröffnungsvortrag über die Bedeutung der Ideengeschichte des Wassers zu halten. Obwohl ich mich schon so lange mit diesem Thema befasse, spüre ich den Druck – ich, ein Mann aus Norwegen, soll im Lande des Nils über Wasser und den Nil sprechen. Ein weiteres Mal blättere ich in einem Klassiker über die geologische Geschichte des Nils, denn obwohl der Fluss Kultur und Mythologie, Romantik und Nostalgie verkörpert, ist er in erster Linie eine physische Struktur, wie Rushdi Said in seinem Buch über den Nil unterstreicht. Die Rolle des Nils für die Gesellschaft ist nicht zu begreifen, solange man seine Hydrologie nicht in Zahlen fasst.3
Mit großen Ziffern notiere ich die wichtigsten Daten auf einem Block, der neben meinem Laptop auf dem Klapptisch liegt. Es ist eine fast rituelle Handlung, wie um mir selbst ins Gedächtnis zu rufen, dass unter der dicken Schicht aus Kultur, Religion und Politik, von der alle Blicke auf den Nil heutzutage geprägt sind, ein realer Fluss mit einem ganz bestimmten geografischen und hydrologischen Charakter fließt. Die Zahlen, die ich notiere, sind von ungewöhnlich starker gesellschaftlicher Bedeutung und heute genauso relevant wie zur Zeit der Entstehung des Mosaiks. Der Nil, wie wir ihn heute kennen, als ganzjährigen Fluss, ist das Resultat relativ neuer geologischer Prozesse. Diese vollzogen sich vor etwa 15 000 bis 25 000 Jahren, als der Wasserlauf vom Viktoriasee mit dem aus Äthiopien heranströmenden Wasserlauf dort zusammentraf, wo sich im heutigen Khartum der Weiße und der Blaue Nil zu einem Fluss vereinen. Der moderne Nil ist das Kind einer der letzten Feuchtphasen in der Geschichte des regionalen Klimas.
Ich falte die Karte über den Nil auseinander, die ich immer bei mir habe, wenn ich hierherkomme. Da ich Historiker und Staatswissenschaftler bin, der darüber hinaus auch Geografie studiert hat, ist das eine Art Reflex – denn Landkarten verdeutlichen Zusammenhänge, für die sich andere Vertreter dieser Geistes- und Sozialwissenschaften häufig nicht interessieren. Der Nil hat eine Länge von mehr als 6800 Kilometern – zöge man ihn mit allen seinen Windungen zu einer Gerade und drehte ihn ab Kairo in die entgegengesetzte Richtung, würde er durch das Mittelmeer und ganz Europa verlaufen, Norwegen der Länge nach durchqueren und Hunderte Kilometer nördlich von Spitzbergen enden. Der Wassereinzugsbereich des Flusses umfasst rund drei Millionen Quadratkilometer, das entspricht etwa einem Zehntel des gesamten afrikanischen Kontinents oder einem Areal von der sechsfachen Größe Frankreichs. Elf Staaten teilen sich den Wasserlauf, etwa 1000 verschiedene Ethnien haben hier über Generationen hinweg ihre verschiedenen Kulturen und Gesellschaften entwickelt. Aufgrund von Größe, klimatischer Variation, Topografie, Flora, Fauna und unterschiedlicher Gesellschaftsformen ist das Nilbecken im Hinblick auf Natur und soziale Verhältnisse der komplexeste und variationsreichste aller großen Wasserläufe.
Die politische Bedeutung des Nils wird von einem gnadenlosen Paradox bestimmt: Was seine Ausdehnung angeht, ist der Fluss riesig, doch führt er nur äußerst wenig Wasser. Der jährliche Durchschnitt beträgt ungefähr 84 Milliarden Kubikmeter, gemessen im ägyptischen Assuan. Dies ist nicht viel – etwa zehn Prozent der Wassermenge des Jangtsekiang, sechs Prozent des Kongo oder etwa ein Prozent dessen, was der Amazonas jährlich ins Meer befördert. Die Ursachen dafür sind in den Besonderheiten des Nils zu finden: Über lange Strecken durchfließt er ein völlig niederschlagsfreies Gebiet. Die jährliche natürliche Wassermenge lag in Oberägypten einmal bei 80 bis 90 Milliarden Kubikmetern. In den letzten Jahrzehnten hat sie sich reduziert, allerdings nicht aufgrund von Klimaänderungen, sondern weil mehr als zehn Prozent des Wassers in den künstlichen Seen der nubischen Wüste verdampfen. Auf seiner fast 2700 Kilometer langen Reise durch eines der trockensten und heißesten Gebiete der Erde wird dem Nil kein neues Wasser zugeführt. Kein anderer Fluss der Erde strömt ebenso weit durch eine Wüste, ohne dass ein anderer Wasserlauf in ihn mündet.
Die ganzjährige lange Reise des Flusses durch die Wüste ist einzigartig. Auf ihr verbinden sich zwei völlig unterschiedliche Flusssysteme mit ganz verschiedenen hydrologischen Profilen. Der Nil besitzt zwei große Quellflüsse, den Weißen Nil und den Blauen Nil, die sich nahe der sudanesischen Hauptstadt Khartum vereinen. Hier vollzieht sich ein bemerkenswerter hydrologischer Prozess, der darüber hinaus erklärt, weshalb der Weiße Nil bis 1971 für Ägypten der wichtigere Fluss war. Führt der Blaue Nil im Herbst viel Wasser, wirkt er auf den viel kleineren Weißen Nil wie ein Damm. Wenn sich die Wassermenge in diesem aus Äthiopien kommenden Fluss dann im Laufe des Frühjahrs verringert, strömt das aufgestaute Wasser des Weißen Nils nach Ägypten hinunter. Allein dieses Phänomen ermöglicht es, auch im Sommer an diesem Fluss zu wohnen und Landwirtschaft zu betreiben.
Bei Assuan im südlichen Ägypten sieht man deutlich, durch was für eine Landschaft der Nil fließt: Wüste.
Von seiner bescheidenen heiligen Quelle in der äthiopischen Hochgebirgsebene legt der Blaue Nil eine Strecke von etwa 2500 Kilometern zurück, ehe er Khartum erreicht. Aus diesem Fluss sowie aus anderen Nebenflüssen, die den Regen in Äthiopien in sich aufnehmen, wie etwa der Atbara (auch Schwarzer Nil genannt) oder der Sobat (der vor dem Zusammenfluss mit dem Pibor in Äthiopien Baro heißt), stammen fast 90 Prozent der gesamten Wassermenge des Nils. In der Flutsaison im Herbst dominiert der Blaue Nil zur Gänze. Er allein steht für rund 80 Prozent allen Wassers, das nach Ägypten hineinfließt. Die saisonbedingten Schwankungen bei diesen Flüssen sind dramatisch. Der Atbara ist im Sommer fast ausgetrocknet, und beim Blauen Nil fließen 90 Prozent der gesamten Wassermenge, die er im Laufe eines ganzen Jahres transportiert, in den drei Herbsmonaten durch sein Bett.
Der Weiße Nil ist ein gänzlich anderer Fluss. Zwischen Khartum und den südlichsten Teilen der Sümpfe – eine Distanz von 1800 Kilometern – hat der Fluss ein phänomenal geringes Gefälle von einem Meter auf 24 Kilometer, und die Wassermenge schwankt wesentlich weniger zwischen den verschiedenen Jahreszeiten. Auf dem ganzen südlichen Abschnitt bis Malakal gibt es keine Zuflüsse. Von Osten aus Äthiopien kommt schließlich der Sobat, der eine ganze Reihe kleinerer Nebenflüsse in sich aufgenommen hat. Folgt man dem Fluss weiter aufwärts, knickt dessen Verlauf scharf nach Westen ab und durchquert den Nosee, einen gigantischen Sumpfsee, der nördlich des Sudd, des weltweit größten Sumpfgebiets liegt.
Der Sudd stellt das eindrucksvollste hydrologische Phänomen am Weißen Nil dar: Etwa 50 Prozent des Wassers im Bahr al-Jabal, wie der Weiße Nil hier genannt wird, verdunsten dort. Einige Kilometer nördlich von Juba, der Hauptstadt des Südsudan, beginnen die Sümpfe. Der Bahr al-Jabal (auf Deutsch Bergfluss; er kommt von den Bergen in Zentralafrika) wandelt sich zu einem riesigen, sanft dahinfließenden See in der völlig flachen Tiefebene des Südsudan. Der See breitet sich in alle Himmelsrichtungen aus, sein Umfang variiert mit den Jahreszeiten und der Wassermenge des Nils. Andere große Flüsse im Südsudan wie etwa der Bahr al-Arab oder der Bahr al-Ghazal (oder Gazellenfluss, weil er durch riesige, parkähnliche Gebiete mit großen Gazellenkolonien fließt) versickern in den Sümpfen.
Von Juba aus muss der Weiße Nil noch 4787 Kilometer zurücklegen, ehe er das Meer erreicht. 168 Kilometer weiter stromaufwärts überquert er die Grenze zwischen Sudan und Uganda bei den Folafällen, zuvor strömt er aus dem Albertsee heraus, hat den Sumpfsee Kyoga passiert und sich bei Jinja aus dem Viktoriasee herausgewälzt, unweit der Stelle, wo Ugandas erstes Wasserkraftwerk liegt, das auch unter dem Namen »Ugandas Anfang« bekannt ist.
Diese großen Seen in Zentralafrika bilden das riesige natürliche Reservoir des Weißen Nils. Parallel zum Rückzug der Gletscher während der letzten Eiszeit begann es im Gebiet der äquatorialen Seen des heutigen Uganda zu regnen. Extreme Wetterlagen führten dazu, dass der Viktoriasee und der Albertsee überliefen; dieses Wasser begann, nach Norden abzufließen, und bildete so den modernen Nil. Die Wassermassen flossen ungehindert durch die einstmals trockene Region, die heute ein großes Sumpfgebiet ist, und erreichten Ägypten. Über einen Zeitraum von etwa 500 Jahren hinweg gab es regelmäßige und enorme Überschwemmungen, welche schließlich das Nildelta mit seinen ursprünglich vielen Flussläufen entstehen ließen.
In den letzten 10 000 Jahren ist der Wasserspiegel des Viktoriasees im Großen und Ganzen stabil geblieben; heute handelt es sich bei dem Gewässer um den weltweit drittgrößten Binnensee. Aufgrund der Verdampfung von seiner gigantischen Oberfläche verursacht er selbst enorme Niederschlagsmengen und nimmt darüber hinaus Wasser von Flüssen auf, die aus Burundi, Ruanda, Tansania, Uganda und insbesondere Kenia kommen. Immer wieder wird der Viktoriasee sowohl in Lexika als auch in Touristenbroschüren als Quelle des Nils bezeichnet, obgleich dieser doch viele Quellen hat, sowohl im Osten in Kenia als auch im Süden in Burundi sowie im Westen in Ruanda und im Kongo. Die westlichen Bergketten, wo einige der wichtigsten Zuflüsse herkommen, gehören zu den feuchtesten Gebieten der Erde, wo es an 360 Tagen im Jahr regnet und dabei durchschnittlich fünf Meter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Die Kombination dieser meteorologischen und geologischen Verhältnisse ermöglicht eine kontinuierliche Wassermenge im Nil auch in den Perioden des Jahres, wenn die aus Äthiopien kommenden Flüsse so gut wie austrocknen.
All diese Zahlen können deplatziert auf Menschen wirken, die meinen, dass die Beschäftigung mit dem Menschlichen auf das Menschliche beschränkt bleiben soll – oder anders ausgedrückt, dass eine lebendige, auf den Menschen ausgerichtete Geschichtsschreibung solche Zahlen vermeiden müsse, weil es sich dabei um naturwissenschaftliche Ablenkungen handele. Tatsächlich jedoch trifft das Gegenteil zu: Diese Zahlen fassen nicht nur auf entscheidende Weise die Rahmenbedingungen für die gesellschaftliche Entwicklung zusammen, sondern beschreiben darüber hinaus eine wichtige Achse und ein Zentrum der gesellschaftlichen Existenz. Diese messbaren geografischen Gegebenheiten verleihen dem Fluss seine besondere regionale und lokale Identität. Sie haben dazu beigetragen, an seinen Ufern verschiedenartige Gemeinschaften zu formen und verschiedene regionale Nutzungsmöglichkeiten zu erschaffen. Ebenso wenig ist es möglich, Entstehung und Untergang des europäischen Kolonialismus, Äthiopiens zentrale Rolle im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, das heutige Schicksal des Südsudan oder Ägyptens Vergangenheit und Zukunft zu verstehen, ohne die Hydrologie des Nils zu kennen.