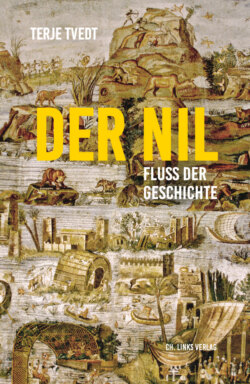Читать книгу Der Nil - Terje Tvedt - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kritik des Orientalismus
ОглавлениеIch fahre über die modernen Straßen durch das Delta, vorbei an Orten, die ich im Morgendunst, der alle Konturen in der flachen Landschaft verwischt, nur ahnen kann. Die Nacht war heiß und unbehaglich; die Klimaanlage hat nicht funktioniert, und der Ventilator ließ mich nicht schlafen, weil er sich anhörte wie ein heulender Hund. Ich lag wach und dachte an einen Roman, der fünf Jahre vor Napoleons Landung im Delta veröffentlicht wurde: Xavier de Maistres Expédition nocturne autour de ma chambre (Nächtliche Expedition um mein Zimmer).29
Der Roman fängt damit an, dass de Maistre die Tür schließt. Er hat beschlossen, eine Reise zu machen – nicht hinaus in die Welt, sondern in seinem Schlafzimmer. Das Ziel ist, sich vom Stumpfsinn der Gewohnheit zu befreien. Er macht sich für die Reise bereit, indem er seinen rosablauen Schlafanzug anzieht. Da er kein Gepäck benötigt, begibt er sich gleich auf seine Tour, zunächst zum Sofa, dem größten Möbelstück im Raum. Indem er das Zimmer bewusst mit dem frischen Blick des Reisenden betrachtet, kann er den Stumpfsinn – oder präziser: die Blindheit – der Gewohnheit abschütteln. Er sieht das Zimmer auf neue Weise, genauer gesagt, das Zimmer erscheint ihm neu, weil er es mit neuem Blick betrachtet. Er entdeckt einige Qualitäten des Sofas zum zweiten Mal – etwa dessen schöne Beine. Und befreit vom Blickwinkel der Routine, weiß er das Möbelstück auf neue Weise zu schätzen, denkt daran, wozu es benutzt worden ist und wozu es alles benutzt werden kann.
Der Roman lässt sich lesen wie ein Beitrag zu einer Diskussion über Reisen zu Bildungszwecken. Er weist die Vorstellung vom Bildungsvorteil der großen Reise zurück und betont, dass es nicht darauf ankommt, viele Orte aufzusuchen, sondern darauf, wie man mit den eigenen Erfahrungen umgeht, und vor allem, ob man seine Umgebung befreit von dem Stumpfsinn sehen kann, den Gewohnheit und Routine immer wieder erschaffen und reproduzieren. In der Weltliteratur verhält es sich mit dem Nil ähnlich wie mit de Maistres Schlafzimmer: Vieles ist bekannt, vieles ist beschrieben, denn kaum ein anderes Phänomen wurde über längere Zeit und mit größerer Systematik erörtert als die Geschichte des Nils und die zivilisationsbildende Rolle dieses Flusses. Da das Nilgebiet über so lange Zeit und in so vielen Bereichen die Grundlage für herrschende Auffassungen über die Entwicklung der Geschichte und für Stereotypen von »uns« und »den Anderen« gewesen ist. Und weil sich Deutungen leicht durch die Routine dieser Beschreibungstraditionen formen lassen, müssen wir immer wieder über unseren eigenen Standort nachdenken, um dem Stumpfsinn der Routine entgehen zu können. Als ich an diesem Morgen durch das ägyptische Delta reise, tue ich das nicht, weil ich die Reise an sich für bildend halte; de Maistres Buch erinnert mich daran, dass das Beobachten und Schreiben sowohl schwierig, anspruchsvoll als auch nur potenziell lohnend ist.
Nur wenige haben die Diskussion darüber, wie der Nahe Osten beschrieben werden kann und sollte, stärker geprägt als Edward Said, der Palästinenser, der mit seiner Familie als Kind nach Ägypten flüchtete, zum Experten für europäische Literatur des 19. Jahrhunderts wurde und gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu den einflussreichsten Intellektuellen der Welt gehörte. Said widmete sein Leben dem Studium den in der europäischen oder abendländischen intellektuellen Tradition verorteten Beschreibungen vor allem des Nahen Ostens und Ägyptens. Sein Buch Orientalismus erschien 1978 erstmals auf Englisch. Said plädierte hier für eine radikale Abkehr von der europäischen Wissenstradition über Ägypten, nicht zuletzt übte er Kritik an Napoleons wissenschaftlicher Expedition und der Lesart, die diese legitimierte.
Said beschrieb die französische Militärinvasion und das französische wissenschaftliche Projekt als zwei Seiten derselben Medaille und als Paradebeispiel für das europäische Streben, eine totale Kenntnis über »den Anderen« zu erlangen, als archetypischen Ausdruck für den Wunsch nach Kontrolle. Für ihn begingen Napoleon und dessen Kommission nichts Geringeres als die Ursünde der Zusammenführung von abendländischem Machtmissbrauch und Wissensanhäufung, deren historische Aufgabe darin bestand, den Orient zu unterdrücken. Der europäische Forscher oder »Orientalist« beschrieb den Orient von oben herab, mit dem Ziel, sich einen Überblick über das gesamte sich vor ihm entfaltende Panorama zu verschaffen – Kultur, Religion, Denkweise und Geschichte. Um das zu erreichen, musste er jedes Detail nach vereinfachten, schematischen Kategorien betrachten. Said beschäftigte sich mit den Rahmenbedingungen, unter denen in einer Gesellschaft Wissen produziert wird und welche die Ungleichheit nicht nur widerspiegeln, sondern verursachen. Aus diesem Grund wies Said die 30 von Napoleons Wissenschaftsexpedition erstellten Bände und alles, was in deren Folge veröffentlicht wurde, als Ausdruck des Machtmissbrauchs gegenüber dessen, was von der Forschung beschrieben worden war, zurück. Diese Forschung galt ihm per definitionem als unwissenschaftlich.
Said zeigt einen wichtigen und allgemeingültigen Charakterzug von Forschung auf, die ein unartikuliertes, unkritisches Verhältnis zu den Machtinstitutionen ihrer Zeit hat, und er beschreibt, wie dadurch beeinflusst wird, worüber gesprochen wird und wie darüber gesprochen wird. Diese Art der Forschung ist sich nicht darüber im Klaren, wie Machtverhältnisse beeinflussen, welche Fragen gestellt und welche Begriffe verwendet werden, welche Schlussfolgerungen akzeptabel und deshalb für den Forscher vorteilhaft sind. Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass viele Forscher, die sich mit Afrika, Asien und Lateinamerika beschäftigt haben, sich kaum für ihr Verhältnis zu und ihren Umgang mit der Macht interessierten, die ihre Forschung beeinflusste, und dass sie auch nur wenig darüber nachgedacht haben – ob sie nun als Konfliktlöser für die Kolonialverwaltung arbeiteten, als Entwicklungshelfer oder im Krieg für Kommandanten und Generäle.
Said trifft hier einen offenkundigen wunden Punkt in der westlichen Wissenschaftsgeschichte. Aber er geht zu weit, denn er präsentiert eine Karikatur der abendländischen Orientkenntnisse. Bei seinem Überblick über die entsprechende Literatur zieht er willkürlich nur jene Beispiele heran, die seine These untermauern. Das Problematischste an seiner Analyse ist jedoch, dass er im Grunde die Möglichkeit verneint, westliche Forscher könnten überhaupt Kenntnisse über den Orient oder Ägypten erlangen, da deren Arbeiten per definitionem mit Vorurteilen belastet seien. Der Orientalismus ist wirksam, ob manifest oder latent, um Saids Worte zu benutzen, und deshalb lässt sich die Welt nicht beschreiben. Westliche Forschung über den Orient erstelle ihre Berichte oder Darstellungen nicht aufgrund von Tatsachen, sondern sei weiterhin geprägt vom institutionalisierten Machtstreben.
Saids Kritik der abendländischen Forschung des 19. Jahrhunderts über den Nahen Osten zeigt und entlarvt, wie etliche Autoren ein Ägypten beschrieben, das gar nicht existierte, es sei denn als Bühne, auf die Europäer ihre kulturellen Vorurteile und bisweilen ihre sexuellen Fantasien projizieren konnten. Aber Saids Analyse ist zu einseitig und willkürlich, um als belastbare empirische Analyse von europäischen Deutungen »des Orients« durchgehen zu können. Sie weist ein komplettes Wissenssystem zurück, und ihre totalisierenden Ambitionen entlarven den Kritiker ebenso sehr wie den Gegenstand seiner Kritik. Saids Buch ist ein doppelter Spiegel: Es zeigt nicht nur sprachliche Fallstricke in der Deutung des Nahen Ostens auf, sondern auch die Konsequenzen von Saids Projekt. Statt offen vorzuschlagen, diese Darstellungen zusammen mit dem Dargestellten aus der Geschichte zu tilgen, erreicht Said mit einem subtileren Handgriff die gleiche Wirkung: Er suggeriert, dass die orientalistischen Analysen eine »Sünde« beinhalten, da sie an sich bereits eine Unterdrückung »des Anderen« darstellten.
In diesem Zusammenhang und dieser Perspektive muss Napoleons Commission des sciences et des arts rehabilitiert werden. Said sagt zweifellos zu Recht, dass deren Werke geprägt sind von den Vorurteilen ihrer Zeit und von französischen Selbstbildern und Weltanschauungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zugleich aber vermittelten diese Werke neues Wissen über eine unbekannte Weltgegend für ein Europa, das aus unterschiedlichen historischen Gründen zu diesem Zeitpunkt eine technologisch überlegene, aufsteigende Weltmacht war. Die Werke vermittelten auch ein Wissen über Ägypten und dessen Geschichte, das die Ägypter selbst nicht besaßen und für dessen Untersuchung ihnen damals eine wissenschaftliche Tradition fehlte.
Einer der Gründe, aus denen es möglich ist, eine Biografie des Nils zu schreiben, liegt nicht zuletzt in der Existenz einiger der Forschungen, die von Said abgelehnt wurden.