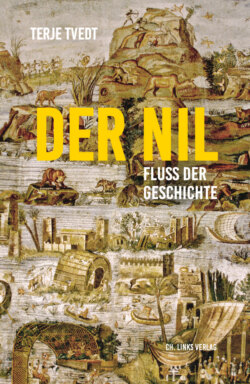Читать книгу Der Nil - Terje Tvedt - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Fluss als Zuckerbrot und Peitsche
ОглавлениеMitten im Ersten Weltkrieg, 1916, wurde Ägypten zum britischen Protektorat ernannt. Während die Versailler Verträge in Europa die politische Stabilität untergruben, lösten sie im Niltal wie auch in China unmittelbar Revolutionen aus. Die ägyptische Revolution von 1919 wurde durch die in den Versailler Verhandlungen vorgebrachten Bekenntnisse zum Selbstbestimmungsrecht der Völker befeuert, zusätzlich entfaltete der Zusammenbruch des Osmanischen Reichs eine Sprengkraft, auf die die Briten nicht vorbereitet gewesen waren. Die weiteren Entwicklungen zwangen die Briten 1922 schließlich, die Unabhängigkeit Ägyptens offiziell anzuerkennen. London behielt jedoch die Macht über die Außenpolitik des Landes, sicherte sich das Recht, bei Suez einen riesigen Militärstützpunkt anzulegen, und behielt die Verantwortung für den Kanal. Nicht zuletzt unterstand alles, was mit dem Nil zu tun hatte, weiterhin der britischen Entscheidungshoheit.
Vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in die späten 1920er Jahre verfolgten die Briten eine zweigleisige Politik. Einerseits trieben sie die Entwicklung des künstlichen Bewässerungssystems in Ägypten voran, andererseits setzten sie die Kontrolle des Flusses weiter stromauf als Peitsche gegen den ägyptischen Nationalismus ein. Mit Unterstütztung der englischen Industrie, so verkündete die britische Regierung, wolle sie im Sudan eine gigantische Anbaufläche für Baumwolle anlegen, die mit Wasser aus dem Nil versorgt werden sollte. Dieses Projekt war sowohl für die sudanesische Wirtschaft wie für die englische Baumwollindustrie wichtig, hatte aber auch einen eher geheimen Aspekt. Es wurde zu einer Karte im Spiel um den Nil, bei dem es darum ging, die ägyptischen Nationalisten zur Zusammenarbeit zu zwingen. Die Briten hofften, die ägyptischen Bauern würden die Nationalisten verfluchen, wenn sie weniger Wasser für ihre verletzlichen kleinen Feldstücke bekämen, und sich dann gegen die eigene Oberklasse wenden anstatt gegen London. Doch diese Rechnung ging nicht auf.
Wie zu erwarten, verurteilten die ägyptischen Nationalisten das Projekt aufs Schärfste und beschuldigten die Briten, sie wollten ihrem Land »den Hahn zudrehen«. Sie verlangten eine größere Unabhängigkeit von London, und 1924 fiel Sir Lee Stack, der britische Generalgouverneur im Sudan, einem nationalistischen Attentat zum Opfer. Als Reaktion drohten die Briten in Ägypten und im Sudan mit dem Einsatz der Waffe, die sie als die effektivste in ihrem Arsenal ansahen – dem Nil. Hinter dieser Art von Wasser- oder Hydrodiplomatie stand die Annahme, dass keine andere Maßnahme so schmerzhaft sein würde. Im sogenannten Allenby-Ultimatum von 1924 beschlossen Generalgouverneur Lord Allenby und die Regierung in London, frühere Vereinbarungen zu brechen, die mit Ägypten darüber getroffen worden waren, wie viel Nilwasser der Sudan abzweigen durfte. Dies hatte jedoch nicht die erwartete Schockwirkung auf die Massen, es stachelte deren nationale Erregung vielmehr weiter an. Die Nationalisten nutzten das Ultimatum nach Kräften aus. Es entlarve die wirklichen Absichten der Briten; nach außen hin gäben sie sich als Ägyptens Bürgen für das Wasser, in Wirklichkeit aber seien sie bereit, es als Waffe gegen die Ägypter einzusetzen, wenn sie ihre Interessen gefährdet sähen.
Gegen Ende der 1920er Jahre änderten die Briten Ägypten gegenüber die Strategie ihrer Nildiplomatie. Um die ägyptische Öffentlichkeit und die Elite des Landes für sich einzunehmen, wurde nun eher auf das Zuckerbrot als auf die Peitsche gesetzt. 1929 traf London im Namen seiner ostafrikanischen Kolonien ein Abkommen mit Ägypten, das bis heute von großer Bedeutung ist. Das Abkommen erkannte einerseits an, dass der Sudan etwas mehr Wasser für seine Entwicklung benötigte, und andererseits, dass Ägypten historische Rechte an den Nilwassern hatte. London versicherte dabei, die stromauf gelegenen Länder hätten so gut wie kein Interesse an einer Nutzung des Nils, da es dort ohnehin so viel regne. Was aber noch wichtiger war: Die Ägypter erhielten das Vetorecht gegen stromauf geplante Wasserprojekte: Sie durften gegen jede Planung Einspruch erheben, die ihre Wasserzufuhr reduzierte. Mit diesem diplomatischen Schachzug versuchten die Briten, die Ägypter davon zu überzeugen, dass ein gutes und freundschaftliches Verhältnis zu Großbritannien in Kairos eigenem Interesse läge – wenn sie eine Garantie auf das Wasser haben wollten, von dem für sie alles abhing.
Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass dieses Abkommen für den Rest der britischen Zeit den grundlegenden Rahmen für die wirtschaftliche Entwicklung im gesamten Nilbereich bildete. Das Abkommen von 1929 hat zudem mehr als irgendein anderer diplomatischer Faktor auch die postkoloniale Ära am gesamten Nilverlauf bestimmt. Wir werden deshalb immer wieder darauf zurückkommen.