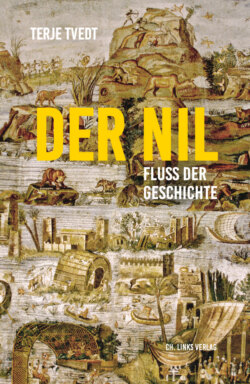Читать книгу Der Nil - Terje Tvedt - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWie alle anderen großen militärischen Expeditionen und Eroberungsversuche war auch Napoleons Feldzug von Gegensätzen, Paradoxien und Widersprüchen geprägt. Um die Vorzüge der europäischen Zivilisation gegenüber der islamischen Welt hervorzuheben – welche die Druckkunst noch immer nicht anerkannt hatte –, wurden mythische Erzählungen über einen Napoleon kreiert, der an der Spitze seines Heeres das Delta hinaufritt und dabei ein gedrucktes Buch las. Jede Seite, die er gelesen hatte, riss er heraus und warf sie weg; die Seiten wurden hinter ihm vom Boden aufgelesen, denn seine Soldaten nahmen die Gelehrsamkeit und die Früchte der Zivilisation in sich auf, während sie den Orient eroberten. Solche Erzählungen spiegeln die idealisierten Bilder der Franzosen über einen Feldherrn wider, der sich selbst als Repräsentant der Neuen Zeit und als Vorkämpfer von Rationalität und Wissen im zurückgebliebenen Orient inszenierte.
Der Feldzug durch das Delta, von Alexandria nach Kairo, wurde in mehrfacher Hinsicht zu einer militärischen Katastrophe. Angesichts einer Tagesration von vier Scheiben Zwieback und einer Flasche Wasser verhungerten und verdursteten viele der Soldaten; außerdem trugen sie zu schweres Gepäck und waren mit viel zu dicken und warmen Uniformen bekleidet. Sie waren auch nicht auf die besonderen ökologischen Bedingungen dieses Kriegsschauplatzes vorbereitet,25 und die Beduinen vergifteten alle Brunnen zwischen dem Nil und Alexandria oder füllten sie mit Sand auf.26
Außerhalb von Kairo stießen Napoleons Truppen mit den Mameluken zusammen, die auf beiden Ufern des Nils standen. Mit großem Sinn für die wachsende Popularität und die metaphorische Macht des alten Ägypten in einem Europa, das sich plötzlich und mit großer Neugier für alles Altorientalische interessierte, bezeichnete Napoleon die Begegnung später als die »Schlacht bei den Pyramiden«. Um seine Soldaten anzufeuern, rief er ihnen zu: »Soldaten! Vier Jahrtausende blicken auf euch herab!« Nach zwei Stunden hatten die französischen Truppen die Mameluken vernichtet. 300 Franzosen und 6000 Ägypter wurden getötet. Die Schlacht war der Anfang vom Ende der Mameluken-Herrschaft in Ägypten.27 Sie ergaben sich, indem sie Napoleon symbolisch die Schlüssel Kairos überreichten. Als eine der ersten Maßnahmen ließ Napoleon in Kairo eine Pontonbrücke über den Nil errichten und eine Windmühle bauen. Die wenigen Windmühlen, die sich in diesem Land betreiben ließen, wurden bis weit in das 19. Jahrhundert »Napoleons Mühlen« genannt.
»Die Schlacht um die Pyramiden« nannte Napoleon den französischen Ägyptenfeldzug 1798. Dieser Feldzug sollte mit einer militärischen Niederlage der Franzosen enden, hatte aber tief greifende kulturelle und politische Konsequenzen bis in die heutige Zeit. Gemälde von Jean-Léon Gérôme (1824–1904).
Wie Menes, der mythenumwobene frühe Pharao und Reichseiniger der ersten Dynastie, und Cäsar vor ihm sowie der britische Generalkonsul in Kairo, Lord Cromer, und Präsident Nasser nach ihm, wusste Bonaparte gleichwohl, dass die Legitimität eines jeden Staatsführers in Ägypten davon abhing, genügend Wasser für die Äcker zu sichern und die Dörfer gegen zu große Fluten zu beschützen. Denn dies war die Voraussetzung für die Ökonomie des ägyptischen Reichs und für die Steuereinnahmen. Napoleon war nun Herrscher über eine gewissermaßen hydraulische Gesellschaft, in der der Nil jedes Jahr ab dem 17. Juni täglich beobachtet wurde und der Munadee El Nil, der »Ausrufer des Nils«, den Anrainern jederzeit Bescheid geben konnte, wie es um die Lebensader stand. Aus diesem Grund erklärte sich Napoleon nach seinem Sieg zum Leiter der jährlichen Festivals zu Ehren des Nil.
Fath al-Khalij oder »Das Festival zur Eröffnung des Kanals« war über viele Jahrhunderte hinweg der große ägyptische Fest- und Feiertag. In der Sommersaison war der Khalij-Kanal von einem Erdwall blockiert. Er wurde geöffnet, wenn der Wasserstand im Nil einen bestimmten Pegel erreicht hatte. Dann floss das Wasser aus dem Fluss in den Kanal, und das Leben kehrte nach Monaten der Dürre buchstäblich auf die ausgetrockneten Ackerflächen zurück. Wie unzählige ägyptische Herrscher vor ihm, inspizierte Napoleon nun den Nilometer auf der Insel Roda in Kairo. Der Wasserstand an diesem Messpunkt bestimmte, wann das Fest beginnen sollte.
Am Morgen des Festtages, die Ägypter waren aufgefordert worden zu feiern, als habe sich die Situation im Land bereits völlig normalisiert, gab Napoleon den Befehl, das Flussboot Aqaba zu schmücken. Er ermunterte die Menschen, am Nil entlangzuspazieren, um den Eindruck zu untermauern, dass mit ihm Stabilität, Gesetz und Ordnung eingekehrt seien. In dem Augenblick, als Bonaparte die Öffnung des Damms anordnete, der den Kanal blockierte, warfen die Menschen alle möglichen Opfergaben in den Nil, auf dass Allah die Frauen und die Böden fruchtbar werden lasse. Ein französischer Beobachter schrieb: »Eine Gruppe Tänzerinnen bewegte sich am Kanal entlang und begeisterte das Publikum mit ihren wollüstigen Tänzen.« Arbeiter warfen eine Lehmstatue, die »Verlobte« genannt, in den Kanal. Die Franzosen interpretierten das als Relikt der pharaonischen Praxis, eine Jungfrau in den Nil zu werfen und auf diese Weise zu opfern. Für Bonaparte bot die ganze Veranstaltung eine gute Gelegenheit, sich genügend religiöses und symbolisches Charisma anzueignen, um als der Große Sultan anerkannt zu werden.
Allerdings zeigte sich, dass es nicht ausreichte, sich mittels ritueller Zeremonien als Wächter und Garant des Nils zu inszenieren. Bereits drei Monate nach dem französischen Einmarsch gab es Aufruhr und Krawalle. Aufständische töteten mehrere französische Soldaten und wurden daraufhin geköpft. Ihre Häupter steckte man in Säcke und warf sie danach auf einen der zentralen Plätze in Kairo. Im Juni 1800 wurde dann Jean-Baptiste Kléber, dem Napoleon im August 1799 das Kommando überlassen hatte, in seinem Hauptquartier von einem jungen Religionsstudenten ermordet. Die Franzosen beschlossen, den Mörder nach orientalischer Sitte zu pfählen. Zuvor musste er zusehen, wie drei angebliche Anstifter geköpft wurden, dann wurde die Hand, mit der er Kléber getötet hatte, bis zum Ellbogen verbrannt, bevor er schließlich mehrere Stunden auf dem Pfahl litt. Der Kampf für die Verbreitung der Ideale der Revolution, so sahen es die Franzosen, verlangte drastische Mittel, gleichwohl waren ihre Tage als Besatzungsmacht bereits gezählt.
Nach der Ermordung Klébers wurde das französische Expeditionskorps von General Abdullah Jacques-François Menou angeführt, einem Franzosen, der zum Islam konvertiert war. Die Besatzung wurde schließlich von einer anglo-osmanischen Invasionstruppe beendet; die französischen Truppen in Kairo ergaben sich am 18. Juni 1801, und Menou kapitulierte am 3. September in Alexandria. Nach rund drei Jahren mussten sich die Franzosen aus Ägypten und dem Nildelta zurückziehen. Mehr noch als am Widerstand der Ägypter selbst, waren sie an der Allianz des Osmanischen Reichs mit Großbritannien gescheitert; nicht zuletzt hatte die Blockade durch die britische Flotte das Eintreffen von Verstärkungen aus Paris sowie überhaupt den regelmäßigen Kontakt des französischen Expeditionskorps mit der Hauptstadt verhindert.
Ungeachtet dessen hatte Napoleons Feldzug langfristige Auswirkungen. Erstens blieben Frankreich und französische Experten eng mit Ägypten verbunden, was in den folgenden Jahrzehnten dazu führte, eine neue Kanalverbindung zwischen dem Mittelmeer und dem Indischen Ozean sowie Dammbauten im Nildelta zu planen. Und zweitens sollte die Forschung, die von Napoleon angestoßen wurde, das Bild des Orients im Westen und die Vorstellungen des Orients von Europa bis heute prägen.
Als Fürsprecher von wissenschaftlichem Optimismus und Rationalität, als der er sich selbst betrachtete, hatte Napoleon eine Gruppe aus 167 Wissenschaftlern und technischen Experten mit nach Ägypten genommen, die Commission des sciences et des arts (Kommission der Wissenschaft und Künste). Von Beginn an legte er also großes Gewicht auf die wissenschaftliche Zielsetzung der Expedition.28 Er verbrachte viele Tage und Nächte mit Wissenschaftlern, um über ihre Arbeit in Ägypten zu sprechen. Nach Beendigung des Feldzugs und Frankreichs Niederlage auf dem Schlachtfeld publizierten die Franzosen eine monumentale Beschreibung der Altertümer Ägyptens in 30 Bänden und mit mehr als 3000 Illustrationen. Pharaonische Stätten, die völlig vergessen waren, wurden wieder ausgegraben. Vor dem Einmarsch der Franzosen war die große Sphinx von Gizeh bis zum Hals im Sand verborgen gewesen. Vivant Denon, der Direktor des Pariser Louvre, war Leiter der wissenschaftlichen Expedition und der Erste, der die Tempel von Karnak und Luxor zeichnete. Denon verfasste seine eigenen Reisebeschreibungen, die 1802 unter dem Titel Voyages dans la Basse et la Haute Égypte erschienen (»Reisen durch Ober- und Unterägypten«) und fast unmittelbar ins Deutsche und Englische übersetzt wurden; das Buch war eine Sensation. Die Kulturschätze des Nils wurden der Welt wieder zugänglich gemacht.
Napoleons kurzes Abenteuer als Herrscher über das Nildelta endete als militärische Katastrophe, lebte aber als kultureller und intellektueller Erfolg weiter – so wurde der Feldzug überwiegend gedeutet. Im Westen wurde unter Intellektuellen eine neue Form der Reise populär; das Ziel war nun die Enthüllung der Geheimnisse der bis dahin unbekannten altägyptischen und der als überwiegend verschlossen wahrgenommenen arabisch-muslimischen Welt. Die Geschichten über Napoleons Heer in Ägypten heizten die Fantasie vieler Abenteurer an und ließen die Herzen zukünftiger Entdeckungsreisender höher schlagen. Letztlich trug dies auch dazu bei, die Grundlage für den Orientalismus als kulturelle Bewegung in Europa zu schaffen, in dessen Kielwasser sogar eine Art »Ägyptomanie« zutage trat. Wie Victor Hugo einige Jahrzehnte später im Vorwort zu seiner 1829 publizierten Gedichtsammlung Les Orientales zusammenfasste: »Zu Zeiten Ludwigs XIV. waren alle Hellenisten. Heute sind alle Orientalisten.«
Ägypten wurde in der Welt bekannt, und die Ägypter wurden mit der Welt bekannt. In einer anderen und immer zentraler werdenden Perspektive ist der Feldzug indes als Katastrophe aufgefasst worden, gerade aufgrund des damit verbundenen kulturellen Einflusses. In der muslimischen und postkolonialen Interpretation wurden Napoleon und sein wissenschaftlicher Säkularismus als Übergriff auf die ägyptische Kultur und als teuflischer Angriff auf den Islam wahrgenommen.