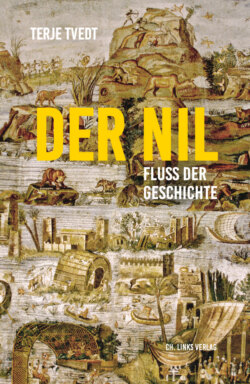Читать книгу Der Nil - Terje Tvedt - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Napoleon im Anmarsch
ОглавлениеAm 1. Juli 1798 gab es ein Erdbeben in der Geschichte Ägyptens und des Niltals. Die technologische Rückständigkeit des Landes wurde offensichtlich, nicht nur gegenüber der Außenwelt, sondern insbesondere im Land selbst.
An diesem Tag ging die französische Expeditionstruppe, L’Armée d’Orient, unter Führung des 28-jährigen Napoleon Bonaparte nahe der Nilmündung an Land. Dass fremde Soldaten nach Ägypten kamen, um das Delta zu besetzen und seine Fruchtbarkeit auszubeuten, war in den letzten 2000 Jahren eher die Regel als eine Ausnahme gewesen. Dass aber der wichtigste und mächtigste muslimische Staat von einem kleinen militärischen Kontingent aus einem Land erobert wurde, das im damaligen Verständnis des Nahen Ostens als barbarische Randregion der Welt aufgefasst wurde, kam einer Demütigung gleich. Diese militärische und kulturelle Konfrontation im unteren Niltal sollte den Blick der arabischen und islamischen Welt auf den Westen und auf sich selbst nachhaltig prägen.
Das Ägypten, in das Napoleon eindrang, war ein Land, das zwar immer wieder von neuen Herrschern unterworfen worden war, dessen technologische Entwicklung zur Nutzung des Nils sich aber seit der Zeit Cäsars kaum verändert hatte. Die ägyptische Elite bestand im 18. Jahrhundert aus Mameluken, eine Herrscherkaste aus ehemaligen Soldatensklaven, die etwa 1000 Jahre zuvor zum ersten Mal die Macht ergriffen hatten. Bei den Mameluken handelte es sich um nicht-arabische, eurasische männliche Sklaven, die von ihren meist nomadischen Eltern verkauft, oder auch Christen, die im Krieg – meist in türkischen Gebieten und mitunter im Balkan – gefangen genommen worden waren. Sie hatten eine militärische Ausbildung erhalten und waren als Muslime erzogen worden. Die erste formelle Mameluken-Dynastie wurde Bahri genannt, was See oder Fluss bedeutet und sich auf ihr Hauptquartier auf der Insel Roda inmitten von Kairo bezog. 1517 wurde Ägypten von Truppen des Osmanischen Reichs erobert, und das Land wurde zu einer Art Juniorpartner der Herrscher in Konstantinopel. Im Laufe des 18. Jahrhunderts erhielt Ägypten immer mehr Freiheiten; dies gab den Mameluken die Gelegenheit, ihre Position als Ägyptens Führungselite, wenn auch formal unter Kontrolle der Osmanen, zurückzuerobern.
Der Ackerbau war weiterhin produktiv, doch noch immer dominierten die aus der Zeit der Pharaonen stammenden Bewässerungsmethoden. Die Menschen lebten im Grunde genommen im gleichen Rhythmus wie ihre Vorfahren Tausende Jahre zuvor. Wenn die Nilschwemme kam, wurden Dämme aus Lehm und Erde errichtet, um das Wasser länger auf den Feldern zu halten. Danach wurde das Wasser zurück in den Nil geleitet. Der Boden war genügend gewässert, neuer, fruchtbarer Schlamm hatte sich abgelagert, und der Aussaat stand nichts mehr im Weg. Zwar wurden umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an Kanälen und Erddämmen vorgenommen, doch es gab keine technische Weiterentwicklung. Die Bevölkerung Ägyptens und ihre Herrscher waren weiterhin den Launen des Nils unterworfen. Deutlich wurde dies insbesondere durch Hungersnöte und Epidemien gegen Ende des 18. Jahrhunderts, welche die Herrschaft der Mameluken schwächten.
Es war völlig üblich, diese Rückständigkeit – oder den technologischen »Stillstand« – mit Religion und Kultur, mit einer Mischung aus »ägyptischem Fatalismus«, »islamischem Konservatismus« und Illusionen hinsichtlich kultureller Überlegenheit zu erklären. Doch die wichtigste Ursache dafür, dass man zu Zeiten Napoleons in vielen ägyptischen Dörfern noch immer so lebte wie in der Antike, kann nicht allein mit religiös-kulturellen Faktoren erklärt werden. Die christlichen Kopten etwa teilten viele Ideen und Werte der Muslime. Der Brite Edward William Lane schrieb in einer berühmten Studie aus dem 19. Jahrhundert, dass in Ägypten auch christliche Frauen einen Schleier trugen, und das sogar im Haus, sobald sich ein Mann näherte. Der Schleier war so verbreitet, dass er eingesetzt wurde, um Klassenunterschiede zu markieren; weiße Schleier wurden von jungen oder armen Frauen benutzt, schwarze hingegen von eher wohlhabenden.23
Die Erklärung für die technologische Stagnation lautet eher, dass sich die Technologie, die den Zyklus für Getreideanbau sowie die Organisation der Arbeit bestimmte, nicht ändern ließ, solange sich nicht auch die natürlichen Grundlagen änderten, auf denen die Landwirtschaft beruhte. Es war schlichtweg unmöglich, eine andere Anbauweise einzuführen, da man den Ackerbau nicht von der Macht und dem saisonalen Rhythmus des Nils abkoppeln konnte. Die topologischen und hydrologischen Verhältnisse jener Zeit verhinderten es, den Wasserlauf des Nils auf derart neue und radikale Weise zu kontrollieren, dass es vernünftig gewesen wäre, die in der Landwirtschaft angewandte Technologie zu ändern.
In den Jahren vor Napoleons Einmarsch war das Regime aufgrund von schlechten Ernten zusätzlich geschwächt. Im August 1791 hatte sich die Flut zu schnell zurückgezogen: »Das Volk war aufgewühlt; Erträge wurden [vom Markt] zurückgehalten, und die Preise stiegen.«24 Die allgemeine Situation verschlechterte sich im Laufe des Sommers 1792 weiter. In Jahren, in denen die Nilschwemme länger als gewöhnlich andauerte oder weniger Wasser als erforderlich mit sich führte, sanken die Einkünfte der Bauern und infolgedessen auch die Steuereinnahmen. Um den Verlust auszugleichen, versuchten die Staatsführer, sich auf andere Art an den Bauern schadlos zu halten, oftmals in Form schlichter, mit Waffengewalt durchgeführter Diebstähle. Das verstärkte wiederum den Gegensatz zwischen den Herrschenden und den Beherrschten und schwächte die Position der Mameluken.
Napoleons Feldzug durch das Nildelta ist aus verschiedenen Gründen äußerst interessant. Die Idee, dass Frankreich sich Ägypten aneignen sollte, war bereits 1672 von Johann Gottfried Leibniz entwickelt worden. Der damals 26-jährige Gelehrte hatte gehofft, das ägyptische Abenteuer würde den Sonnenkönig Ludwig XIV. davon abhalten, sein Reich in östlicher Richtung zum Rhein auszudehnen. Ende des 18. Jahrhunderts war das geopolitische Spiel ein anderes. Die Pariser Strategen wollten Ägypten kontrollieren, um Englands Verbindung mit Indien zu schwächen und somit dessen Rolle als Weltmacht zu unterminieren. Die Invasion wurde darüber hinaus mit dem Wunsch begründet, die Ideale der Französischen Revolution nicht nur wo immer möglich, sondern besonders am Geburtsort der Zivilisation zu verbreiten.
Paradoxerweise wollte Napoleon den Widerstand gegen den Einmarsch der französischen Truppen mit politischen Initiativen schwächen, die dem erklärten Ziel zuwiderliefen, die Ideen der Französischen Revolution zu exportieren. Der Erbe der Französischen Revolution erließ an den Ufern des Nils ein Dekret, in dem er den Koran als den einzigen Weg zum menschlichen Glück beschrieb, und versprach, ein auf den Prinzipien des Koran beruhendes Regime zu errichten. Im August 1798 erklärte er öffentlich: »Ich hoffe, … dass es mir gelingen möge, alle klugen, weisen und gebildeten Männer des Landes zu versammeln und ein Regime zu etablieren, das auf den Prinzipien des Koran beruht, welche einzig und allein die Wahrheit verkörpern und den einzigen Weg zum menschlichem Glück darstellen.« Er bestand auch darauf, dass die muslimischen Führer das Volk anhalten sollten, »mehr als zwanzig Verse des Koran, des Heiligen Buches, zu lesen«, schließlich habe dieses seinen Einzug in Kairo vorhergesehen und beschrieben! Auch versuchte er, sich als Muslim darzustellen, und nahm an muslimischen Gebeten und Riten teil. Viele seiner Offiziere und engsten Berater reagierten besorgt auf diese Taktik. Auf kurze Sicht könne man damit vielleicht den Widerstand abmildern, meinten sie, langfristig aber nur umso mehr Probleme verursachen.