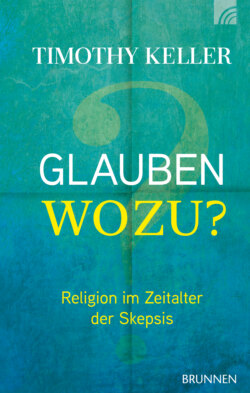Читать книгу Glauben wozu? - Timothy Keller - Страница 13
Atheismus mit einem wilden Gott
ОглавлениеWährend Clark und Havel ihre Begegnungen mit der Fülle religiös interpretiert haben, gibt es andere, die dabei bleiben, nicht an Gott zu glauben, obwohl sie ihre Erfahrung nicht rational erfassen können.42 Im Paris Review schreibt Kristin Dombek: „Ich bin nun seit mehr als 15 Jahren Atheistin und habe mir fast alles über den Glauben erklären können, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber ich habe mir nicht erklären können, wie Gott manchmal so real erfahren wird, dass er unaufgefordert im Leben von Menschen erscheint, sie mit Freude erfüllt und großzügig macht … Es ist, als ob man das beste Geheimnis der Welt erhascht: Liebe muss nicht knapp sein.“43
Die Atheistin Barbara Ehrenreich, am besten bekannt für ihr bahnbrechendes Werk Nickel and Dimed, schrieb ihre Erfahrung in Living With a Wild God nieder, das von einer lebensverändernden mystischen Erfahrung handelt, die sie im Mai 1959 als Siebzehnjährige machte. Seit ihrem dreizehnten Lebensjahr war sie auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was der Sinn unseres kurzen Lebens ist und wozu wir hier auf der Erde sind.44 Ihre Eltern waren Atheisten gewesen und ihre Anstrengungen bei dieser Suche liefen auf streng rationalistischer Basis ab, was sie nach eigenen Worten in den „Morast des Solipsismus“ führte [nur das eigene Ich existiert]. Sie spürte, dass es keinen Weg gab, richtig von falsch zu unterscheiden oder wahr von unwahr.45 Doch als sie siebzehn war, fand sie auf einer leeren Straße im Morgengrauen „alles, wonach ich gesucht hatte, seit ich meine Suche artikuliert hatte“. Wie andere auch konnte sie diese Erfahrung nicht beschreiben: „Hier verlassen wir den Bereich der Sprache und es bleibt nur ein vages Gurgeln der Kapitulation, das sich in Worten wie ‚unaussprechlich‘ und ‚transzendent‘ ausdrückt.“46
Es gab keine Visionen, keine prophetischen Stimmen oder Besuche von Totemtieren, nur überall dieses Lodern. Etwas strömte in mich hinein und ich floss in dieses Etwas. Das war nicht die passive, glückselige Verschmelzung mit dem „All-Einen“, wie es die östlichen Mystiker versprechen, sondern eine rasende Begegnung mit einem lebenden Wesen … „Ekstase“ wäre das richtige Wort, aber nur, wenn man beachtet, dass es nicht das gleiche Spektrum wie „Glück“ oder „Euphorie“ abdeckt, sondern einem Ausbruch von Gewalt gleichen kann.47
Da sie nun jeden Beleg dafür hatte, dass es zumindest „die Möglichkeit eines nichtmenschlichen Akteurs gab, etwas mysteriöses Anderes, … konnte ich mich immer noch als Atheistin bezeichnen?“48 Sie beschloss, dass sie es konnte, weil ihre Erfahrung ihrer Meinung nach keine Ähnlichkeit mit der „religiösen Ikonografie“ hatte, mit der sie aufgewachsen war.49 Erstens schien sich diese „Gegenwart“ nicht um die Menschen zu kümmern. „Die am meisten gepriesene Eigenschaft des christlichen Gottes ist, dass er ‚gut‘ ist.“ Doch ihre Erfahrung hatte sie mit etwas „Wildem“ verbunden, ungestüm, sogar gefährlich und gewaltsam; nichts, was sie als gut oder freundlich ansehen konnte. Zweitens brachte ihre Erfahrung keine „ethischen Anweisungen“ mit sich. Sie hörte keine Stimmen. „Was ich auch gesehen hatte, es war, was es war, ohne Bezug zu menschlichen Anliegen.“ Dennoch führte dies unmittelbar dazu, dass sie aus ihrem klaustrophobischen Rätselraten gerissen und in das „große Feld der Geschichte geschwemmt wurde – die Unterdrückten gegen die Unterdrücker, die Besetzten gegen die Besatzer. Ich wurde mitgerissen in diesen Kampf.“50 So wurde sie zur sozialen Aktivistin und ist es heute noch.
Doch im Gegensatz zu ihrer Deutung passt ihre Erfahrung zu vielem in der christlichen und biblischen Theologie über Gott. Sie sagt, dass es etwas „wildes, amoralisches Anderes“ war, kein Wesen, das „Ethik durchsetzte“, doch im Buch Hiob kann man nachlesen, dass Menschen ihn als beides erlebt haben.51 In biblischen Berichten von Begegnungen mit dem Göttlichen (z. B. 2. Mose 3 und 33 und Jesaja 6) fühlten sich die menschlichen Empfänger völlig bedeutungslos. Diese Texte zeigen auch einen Gott, dessen Gegenwart heftig traumatisch und tödlich ist und dennoch gleichzeitig attraktiv und anziehend. Augustinus beschreibt in seinen Bekenntnissen (Confessiones) eine Erfahrung mit Gott vor seiner Bekehrung, die er nur als „Blitz eines zitternden Blickes“ beschreiben konnte, der ihm einen überwältigenden, aber bedrohlichen Einblick in etwas völlig anderes gab. Nachdem er dann Gott durch Christus begegnet war, wurden seine Kontakte mit dem Göttlichen geprägt von „der Einheit von Liebe und Schrecken“.52 Der Oxforder Historiker Henry Cladwick erklärt dazu in seinem Buch über Augustinus’ Theologie: „Der Schrecken wurde ausgelöst durch die Kontemplation des unnahbar Anderen, der so fern und so anders war, die Liebe durch das Bewusstsein des Anderen, der so ähnlich und nah ist.“53
Selbst Ehrenreichs aus dem Ärmel geschüttelter Kommentar es war, was es war klingt wie Gottes Wort an Mose: „Ich bin, der ich bin“ (2. Mose 3,14). Das „Wilde“, das Ehrenreich beschreibt, passt perfekt zu vielen Beschreibungen von Gott in der Bibel.54 Gott erscheint als ein Sturm (Hiob 38,1), als loderndes Feuer (2. Mose 3,2) oder als rauchender Ofen und brennende Fackel (1. Mose 15,17).55 Ehrenreichs Erfahrung klingt unheimlich ähnlich wie Rudolf Ottos berühmte Beschreibung des „Heiligen“: „ein überhaupt ‚Ganz anderes‘ …[,] das in Art und Wesen mir in keinster Weise ähnelt, weshalb ich vor ihm in starrem Erstaunen zurückpralle“56.
Trotz alledem bleibt sie Atheistin. Dennoch kann man sagen, dass ihr streng säkularer Rahmen nicht mehr vollständig oder geschlossen ist. Sie schreibt, dass sie „nicht länger die Art von höhnischen, dogmatischen Atheisten“ ist, „wie meine Eltern es waren“. Als sie in einer Fernsehsendung nach ihrem Atheismus gefragt wurde,
sagte ich nur, dass ich nicht „an Gott glaubte“, was so weit stimmte. Selbstverständlich hätte ich nicht damit fortfahren können, dass ich „nicht an Gott glauben muss, weil ich ihn kenne, zumindest irgendeine Art von Gott.“ Ich klang wohl nicht überzeugend, denn ich bekam einen Anruf von meiner klugen, heroischen Atheistentante Marcia, die mir sagte, dass sie die Sendung gesehen und ein leichtes Zittern und Ausweichen in meiner Antwort bemerkt hätte.57
Charles Taylor sagt, dass „Fülle“ streng genommen weder ein Glaube noch eine reine Erfahrung ist, sondern die Wahrnehmung, dass das Leben mehr ist, als naturalistische Erklärungen erfassen können. Dies sei die verbreitete, tatsächlich gelebte Verfasstheit der meisten Menschen ungeachtet ihrer Weltanschauung.58 Die Herausforderung für Gläubige wie Nichtgläubige liegt darin, wie sie diese gelebte Situation innerhalb ihrer Grundüberzeugungen verstehen. Wenn dieses Leben alles ist, warum sehnen wir uns dann so tief nach etwas, das es nicht gibt und nie gegeben hat? Warum gibt es so viele Erlebnisse, die über das Weltbild des Säkularismus hinausweisen, selbst bei denen, die solche Erfahrungen nicht begrüßen? Und wenn dieses Leben alles ist, was machen Sie dann mit diesem Verlangen, das im geschlossenen säkularen Rahmen keine Erfüllung finden kann?