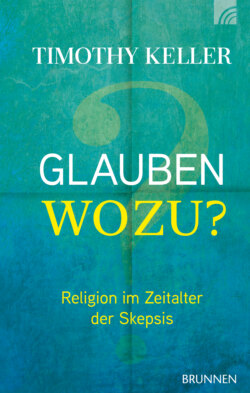Читать книгу Glauben wozu? - Timothy Keller - Страница 18
Exklusive Rationalität
ОглавлениеDie erste Reihe von Überzeugungen, die viele säkulare Menschen übernehmen, ist das, was ich „exklusive Rationalität“ nennen will – der Glaube, dass Wissenschaft der einzige Schiedsrichter darüber ist, was real und faktisch ist, und dass wir nichts glauben sollten, bevor wir es nicht mit empirischer Beobachtung definitiv beweisen können. Nur was beweisbar ist, ist es wert, als wahr bezeichnet zu werden; alles andere liegt im Reich unzuverlässiger menschlicher Empfindung und Meinung. Diese Sicht der Vernunft ist fundamental für die säkulare Behauptung, dass Religion ihre Annahmen über Gott und einen übernatürlichen Bereich einfach nicht beweisen kann.
In unserer Gesellschaft klingt das nach einem völlig nüchternen Standpunkt. Doch viele, die ihn zu Ende gedacht haben, sehen seine tiefe Problematik. Ich kannte einen begeisterten Philosophiestudenten. Wie sein Held René Descartes setzte er bei der einzigen Gewissheit an, dass es ihn gibt und dass er denken kann. Von hier aus wollte er eine Sicht des Lebens aufbauen, die in jedem Punkt absolut rational und bewiesen war. Zu seiner Bestürzung musste er feststellen, dass er fast nirgendwo hinkam. Er konnte nicht beweisen, dass das Universum nicht nur eine optische Illusion war – irgendein dämonischer Trick. Genauso wenig konnte er beweisen, nach welchem Maßstab etwas tatsächlich „bewiesen“ war. So verfiel er in eine Art intensiven, radikalen Agnostizismus, der sich nicht in der Lage sieht, irgendetwas außerhalb seines eigenen Bewusstseins wirklich zu wissen.
In ihrer spirituellen Biografie bezeugt Barbara Ehrenreich, dass sie als Teenager an dem gleichen Punkt angekommen war: „Das ganze logische Unterfangen geriet aus den Fugen, was es wohl auch muss, wenn man einzig und allein das Ich als gegeben ansieht.“ Als ein befreundeter Christ sie dafür schalt, dass sie nicht an Gott glaubte, antwortete sie, dass es schwer genug sei, an sich selbst zu glauben: „An mich oder sogar meine Familienmitglieder als eigenständige Personen zu glauben kostete mich alle Mühe.“7 Sie setzte wie der Philosophiestudent auf „exklusive Rationalität“ – den Glauben, dass man nur das wissen kann, was man empirisch beweisen kann – und kam zu dem Schluss, dass sie eigentlich so gut wie gar nichts wissen konnte. Wir sollten diese Fälle nicht als exzentrische Sonderfälle betrachten, denn sie spiegeln viel von der Entwicklung des philosophischen Denkens im letzten Jahrhundert wider.
Der britische Mathematiker und Philosoph William Kingdon Clifford beschrieb exklusive Rationalität in seinem berühmten Essay „The Ethics of Belief“ (1877, „Die Ethik des Glaubens“): „Es ist immer, überall und für jeden falsch, an irgendetwas zu glauben ohne ausreichende Beweise“, und mit „ausreichenden Beweisen“ meinte er empirische Verifikation, die jeden vernünftigen Menschen überzeugt, der in der Lage ist, sie nachzuvollziehen.8 Heute haben die wenigsten je von Clifford gehört, dennoch arbeiten die meisten säkularen Menschen genau mit diesem Prinzip, um religiöse Überzeugungen zurückzuweisen.9 Im Internet finden sich unzählige Aufrufe von Atheisten, die religiöse Menschen auffordern: „Wenn du willst, dass ich an Gott glaube, dann musst du seine Existenz beweisen.“
Doch inzwischen hat man erkannt, dass dieser Ansatz unüberwindbare Probleme mit sich bringt. Zum einen kann Clifford seinen eigenen Maßstab nicht halten. Nach seiner These dürfen wir nichts glauben, was sich empirisch nicht beweisen lässt – aber wo ist der empirische Beweis für diese Behauptung?
Ein anderes Problem ist, dass die wenigsten unserer Überzeugungen über die Wahrheit wissenschaftlich beweisbar sind. Wir können jedem vernünftigen Menschen demonstrieren und damit beweisen, dass eine Substanz X bei der Temperatur Y siedet, aber wir können nicht gleichermaßen beweisen, was wir über Gerechtigkeit und Menschenrechte glauben, dass alle Menschen gleich an Wert und Würde sind oder was wir für gut und böse halten. Wenn wir den gleichen Beweisstandard an unsere anderen Überzeugungen anlegen, mit denen viele Menschen den Glauben an Gott ablehnen, könnte man kaum etwas davon rechtfertigen. Die einzig „ethisch“ vertretbaren Glaubensüberzeugungen wären solche, die sich im Labor beweisen lassen.10 Der Philosoph Peter van Imwagen weist darauf hin, dass der Aufsatz von Clifford oft in Religionskursen behandelt wird, aber nie in Kursen zur Erkenntnistheorie. Denn nach Van Imwagen glaubt kaum noch ein Philosophielehrer im Westen an Cliffords Sicht von der Vernunft.11
Ein zusätzliches Problem liegt darin, dass selbst die Kriterien, wann etwas als bewiesen gilt, heftig umstritten sind. Selbst agnostische Aussagen können Glaubensüberzeugungen über Rationalität enthalten. Eine Sache für nicht bewiesen zu halten akzeptiert einen Beweismaßstab, den nicht jeder akzeptieren muss.12 Man kann keinen Maßstab für einen rationalen Beweis beweisen, ohne dafür eben diesen Maßstab zu verwenden. So kann die Vernunft ihre These, dass sie der Weg zur Wahrheit ist, nur aufstellen, indem sie auf sich selbst zurückgeht. Wie ein Philosoph schreibt: „Das erscheint manchen wie ein Autoverkäufer, der seine Vertrauenswürdigkeit damit unter Beweis stellt, dass er schwört, dass er immer die Wahrheit sagt.“13
Das ist nicht ganz fair. Vernunft ist entscheidend und unersetzbar, um gegensätzliche Überzeugungen zu bewerten. Aber man kann unmöglich behaupten, dass man nur das glauben sollte, was bewiesen ist, und Religion ablehnen sollte, weil sie sich nicht beweisen lässt. Für jeden von uns gibt es Dinge, an die er glaubt und für die er sogar sterben würde, die sich aber nicht beweisen lassen. Wir glauben an sie aus einer Verbindung von Verstand, Erfahrung und sozialen Gründen. Aber sollten wir diese Dinge aufgeben, nur weil wir sie nicht beweisen können und deshalb nicht wissen können, ob sie wahr sind? Deshalb sollten wir die Forderung fallen lassen, dass Glaube an Gott einem Maßstab universell anerkannter Beweisbarkeit genügen müsse, den wir in anderen wichtigen Lebensbereichen auch nicht anlegen.