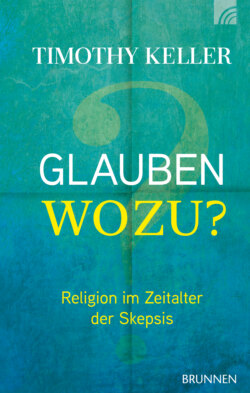Читать книгу Glauben wozu? - Timothy Keller - Страница 6
Vorwort Was säkular Denkende glauben
ОглавлениеSeit fast dreißig Jahren arbeite ich nun schon in Manhattan. Die meisten Menschen in dieser Stadt, die zu meinem Zuhause geworden ist, sind nicht gläubig oder religiös. Sie sind auch keine Namenschristen, die nur an Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen. Die meisten würden sich als „säkular“ ansehen – „keine religiöse Zugehörigkeit“.
Neulich brachte die New York Times einen Bericht über eine wöchentliche Diskussionsrunde, die unsere Gemeinde für Menschen veranstaltet, die skeptisch gegenüber Gott und jeglicher übernatürlicher Realität sind. In dieser Gruppe wird keine Wahrheit einer Religion oder des Säkularismus vorausgesetzt, sondern es werden verschiedene Quellen konsultiert – persönliche Erfahrung, Philosophie, Geschichte und Soziologie genauso wie religiöse Texte. Glaubenssysteme werden verglichen und es wird abgewogen, wie sinnvoll sie jeweils sind. Die meisten Teilnehmer kommen sicherlich mit einem eigenen Standpunkt und werden hoffen, dass ihre eigene Weltanschauung in dieser Bestandsaufnahme besser dastehen wird. Doch jeder ist gezwungen, sich der Kritik zu stellen und Schwächen und Probleme seiner Sichtweise einzugestehen.1
Nachdem der Artikel erschienen war, wurde er in verschiedenen Internetforen diskutiert. Viele hatten nur Spott und Hohn übrig. Ein Kommentator sagte, dass Christsein „keinerlei Sinn ergibt in der realen, natürlichen Welt, in der wir leben“ und daher „keinerlei [rationalen] Wert hat“. Viele widersprachen der Ansicht, dass auch der Säkularismus ein Glaubenssystem ist, das sich mit anderen Systemen vergleichen lässt. Sie sahen in ihm lediglich eine vernünftige Einschätzung der Welt, die sich auf rein rationale Bewertungen stützt. Religiöse Menschen würden versuchen, ihren Glauben anderen aufzudrücken, aber säkulare Menschen würden reine Fakten einbringen, vor denen diejenigen, die nicht mit ihnen übereinstimmten, die Augen verschließen würden. Ein anderer schrieb, dass man nur Christ sein könne, wenn man die Märchen der Bibel für wahr hielte und jegliche Vernunft und Beweislage ausblende.
In einem anderen Forum konnten die Teilnehmer nicht verstehen, warum Skeptiker je zu einer solchen Diskussionsgruppe gehen sollten. Ein Mann fragte sich, ob wir etwa meinten, dass Menschen ohne religiöse Bindung nie vom christlichen Glauben gehört hätten. „Denken sie, dass säkulare Menschen da hinkommen, zuhören und sagen: ‚Hey, warum hat mir niemand davon erzählt?`“ Ein anderer schrieb: „Menschen sind nicht säkular, weil sie sich nicht mit Religion auskennen – sie sind es, weil sie Bescheid wissen.“2
Doch ich bin im Laufe der Jahre in so vielen solcher Diskussionsgruppen gewesen, dass ich weiß, dass diese Einschätzung der Kritiker des Glaubens weitgehend nicht zutrifft. Gläubige wie ungläubige Menschen gelangen zu ihren Überzeugungen durch eine Kombination aus Erfahrung, Glaube, Denken und Intuition. Und in diesen Foren sagen mir regelmäßig Skeptiker, dass sie sich gewünscht hätten, früher von dieser Art der Verbindung von Glauben und Denken zu wissen. Sie werden nicht alle zwangsläufig gläubig, aber sie sagen, dass sie noch nie vorher so viel Futter zum Nachdenken über diese Themen bekommen haben.
Dieses Buch soll den Lesern das gleiche Denkfutter anbieten – besonders den ganz skeptischen, die vielleicht meinen, dass die „gute Nachricht“ jeder kulturellen Relevanz entbehrt. Wir werden die Überzeugungen und Grundsätze des christlichen Glaubens mit der säkularen Weltanschauung vergleichen und danach fragen, welcher Ansatz unserer menschlichen Erfahrung einer komplexen Welt besser gerecht wird.
Bevor wir loslegen, sollten wir allerdings einen Moment darüber nachdenken, wie wir das Wort „säkular“ verwenden wollen, das heutzutage auf mindestens drei verschiedene Weisen benutzt wird:
1.sozio-politisch: Eine säkulare Gesellschaft macht eine scharfe Trennung zwischen Staat und Religion. Keine Glaubensrichtung wird von Regierung und kulturellen Institutionen bevorzugt;
2.individuell: Mit dem Begriff werden auch einzelne Personen beschrieben. Ein säkularer Mensch ist jemand, der nicht weiß, ob es einen Gott oder einen übernatürlichen Bereich gibt. Für ihn hat alles eine (natur-)wissenschaftliche Erklärung;
3.kulturell: Das Wort beschreibt auch eine bestimmte Kultur mit ihren Themen und Grunderzählungen (Narrativen). In einem säkularen Zeitalter liegt alles Gewicht auf dem saeculum, auf dem Hier und Jetzt, ohne jede Vorstellung von etwas Ewigem. Glück und Sinn des Lebens sucht man in Wohlstand, materiellen Annehmlichkeiten und emotionaler Erfüllung.
Es ist hilfreich, diese drei Aspekte zu unterscheiden. Eine Gesellschaft kann einen säkularen Staat haben, obwohl es im Land wenig säkulare Menschen gibt. Eine andere Differenzierung begegnet uns auf Schritt und Tritt: Menschen können bekennen, dass sie nicht säkular sind, sondern religiös. Doch auf praktischer Ebene wirkt sich die Existenz Gottes nicht merklich auf ihre Entscheidungen und Verhaltensweisen aus. Denn in einem säkularen Zeitalter neigen selbst gläubige Menschen dazu, Partner, Beruf, Freundschaften und finanzielle Optionen nach keinem höheren Ziel auszusuchen als ihrem jetzigen persönlichen Glück. Es ist selten geworden, seinen persönlichen Frieden und Überfluss für etwas zu opfern, selbst für Menschen, die von sich sagen, dass sie an absolute Werte und die Ewigkeit glauben. Auch wenn Sie kein säkularer Mensch sind, kann das säkulare Zeitalter Ihren Glauben „ausdünnen“ und kann ihn säkularisieren, bis er nur noch eine weitere Lebensentscheidung neben Job, Hobbys oder Politik darstellt – und nicht mehr der umfassende Rahmen ist, der alle Lebensentscheidungen bestimmt.3
In diesem Buch werde ich das Wort „säkular“ im zweiten und dritten Sinne verwenden und diese Positionen oft scharf kritisieren. Dagegen bin ich ein großer Verfechter des ersten Aspektes. Ich möchte nicht, dass die Kirche oder irgendeine religiöse Institution den Staat kontrolliert oder umgekehrt. Gesellschaften, in denen der Staat einen bestimmten, für wahr gehaltenen Glauben übernommen und gefördert hat, sind oft repressiv gewesen. Regierungen haben die Autorität der „einen wahren Religion“ als Gewähr für Gewalt und Imperialismus genommen. Doch ironischerweise endet die Hochzeit zwischen Staat und Kirche darin, dass die bevorzugte Religion geschwächt und keineswegs gestärkt wird: Wenn eine Religion den Menschen durch sozialen Druck aufgezwungen wird und sie sich nicht aus freien Stücken dafür entscheiden können, nehmen sie diese oft nur halbherzig oder sogar heuchlerisch an. Das Beste ist eine Regierung, die weder einen bestimmten Glauben fördert noch eine doktrinäre Form des Säkularismus, in der Religion abwertet und ausgrenzt.
Ein wahrhaft säkularer Staat wird eine wirklich pluralistische Gesellschaft schaffen; einen „Marktplatz der Ideen“, auf dem sich Menschen jeglicher Glaubensrichtung, einschließlich säkularer Ansätze, einfinden, um in Freiheit, gegenseitigem Respekt und Frieden ihre Gedanken beizutragen und miteinander zu reden, zu leben und zu arbeiten. Solch einen Ort gibt es noch nicht, wo Menschen, die zutiefst anders denken, dennoch lange und aufmerksam zuhören, bevor sie reden. Wo man Schattengefechte vermeidet und den Einwänden und Zweifeln der anderen ernsthaft und respektvoll begegnet. Wo man sich so sehr danach ausstreckt, die andere Seite zu verstehen, dass die Gegner sagen können: „Du stellst meine Position besser und überzeugender dar, als ich es selbst kann.“ Ich gebe zu, dass es solch einen Ort noch nicht gibt, aber ich hoffe, dass dieses Buch ein kleiner, unperfekter Beitrag zu seiner Entstehung sein kann.
Vor ein paar Jahren schrieb ich ein Buch mit dem Titel Warum Gott?, das ein Bündel an Argumenten für den christlichen Glauben an Gott liefert. Für viele war es hilfreich, doch für andere ging es nicht weit genug zurück. Manche werden diese Entdeckungsreise gar nicht erst antreten, weil christlicher Glaube ihnen einfach nicht relevant genug erscheint, als dass sie der Mühe wert wäre. „Erfordert Religion nicht blinde Glaubenssprünge in einem Zeitalter von Wissenschaft, Vernunft und Technik? Es werden gewiss immer weniger Menschen sein, die das Bedürfnis nach Religion verspüren, und sie wird aussterben.“
Dieser Band beginnt mit diesen Einwänden. In den ersten zwei Kapiteln hinterfrage ich die Annahmen, dass die Welt immer säkularer wird und dass säkulare, nichtreligiöse Menschen ihre Sicht vom Leben vor allem aus der Vernunft ableiten. Die Realität ist, dass jeder Mensch seine Weltanschauung auf eine Vielzahl rationaler, emotionaler, kultureller und sozialer Faktoren stützt.
Im zweiten Teil des Buchs werde ich vergleichen, wie christlicher Glaube und Säkularismus (mit gelegentlichen Bezügen zu anderen Religionen) versuchen, den Menschen Sinn, Zufriedenheit, Freiheit, Identität, ethische Moral und Hoffnung zu verschaffen – die wesentlichen Dinge, ohne die wir nicht leben können. Ich werde aufzeigen, dass der christliche Glaube emotional wie kulturell am meisten Sinn ergibt, dass er diese großen Lebensthemen am treffendsten erklärt und dass er unübertroffene Ressourcen bietet, um diesen unweigerlichen menschlichen Bedürfnissen zu begegnen.
Warum Gott? thematisiert außerdem nicht die vielen unterschwelligen Überzeugungen, die unsere Kultur uns über den christlichen Glauben aufdrückt und ihn so wenig plausibel erscheinen lassen. Diese Annahmen werden uns nicht ausdrücklich in einer Argumentation präsentiert, sondern begegnen uns verpackt in den Geschichten und Themen in Unterhaltung und Social Media, einfach als „die Dinge, wie sie sind“.4 Diese Annahmen sind so stark, dass selbst bei vielen Christen – vielleicht zunächst im Verborgenen – der Glauben in ihren Köpfen und Herzen immer mehr an Kraft verliert. Das meiste auf dieser Ebene ist für uns nicht als Glaubenssatz erkennbar:
»„Man muss nicht an Gott glauben, um ein erfülltes Leben voller Bedeutung, Hoffnung und Zufriedenheit zu haben“ (Kapitel 3, 4 und 8).
»„Man sollte frei sein, so zu leben, wie man es für richtig hält, solange man niemandem schadet“ (Kapitel 5).
»„Du wirst, wer du wirklich bist, wenn du deinen tiefsten Wünschen und Träumen treu bleibst“ (Kapitel 6 und 7).
»„Man muss nicht an Gott glauben, um eine Grundlage für ethisch-moralische Werte und Menschenrechte zu haben“ (Kapitel 9 und 10).
»„Es gibt wenig bis keine Anzeichen dafür, dass es Gott wirklich gibt oder der christliche Glaube wahr ist“ (Kapitel 11 und 12).
Wenn Sie meinen, dass christlicher Glaube kaum darauf hoffen kann, einem denkenden Menschen einzuleuchten, dann ist dieses Buch für Sie geschrieben. Wenn Sie Freunde oder Familienmitglieder haben, die so denken (und wer in unserer Gesellschaft hat das nicht?), dann könnte Sie dieses Buch ebenso interessieren.
Nach einer solchen „Skeptiker willkommen!“-Diskussionsrunde in unserer Gemeinde kam ein älterer Herr auf mich zu, der schon oft dabei gewesen war, und sagte zu mir: „Mir ist jetzt bewusst geworden, dass ich weder in meiner Jugend, als ich noch zur Kirche ging, noch später, als ich als Atheist lebte, meine Grundlagen so genau angeschaut habe. Ich stand zu sehr unter dem Einfluss meines Umfeldes und habe Dinge nicht für mich selbst durchdacht. Danke für diese Gelegenheit!“
Meine Hoffnung für dieses Buch ist, dass es Lesern innerhalb wie außerhalb religiöser Systeme dazu verhilft, das Gleiche zu tun.