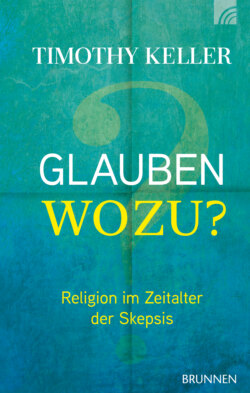Читать книгу Glauben wozu? - Timothy Keller - Страница 20
Grundüberzeugungen
ОглавлениеMichael Polanyi hat herausgearbeitet, dass jeder individuelle menschliche Erkenntnisakt auf zwei Ebenen stattfindet: Auf „fokaler“ Ebene (focal awareness, „fokal“ = Brennpunkt) widmet der Betrachter seine Aufmerksamkeit direkt seinem Objekt, während er „subsidiär“ („ergänzend“, subsidiary awareness) jede Menge unausgesprochener Annahmen mitbringt.20 Polanyi zeigt, dass jeder Mensch unzählige Annahmen über die Realität und ihre Bedeutung hat, die entweder durch leibhaftige Erfahrungen erworben wurden oder durch Autoritäten, denen wir vertrauen, und Gemeinschaften, denen wir angehören. Sie dringen in uns ein und wir behalten sie bei als unausgesprochene Erkenntnis, kaum bewusste Überzeugungen und „Paradigmen“ der Wirklichkeit.21 Deswegen treten wir an einen neuen Gegenstand immer mit einem Vorverständnis heran – Grundüberzeugungen, Erwartungen und Werte, die steuern, was wir sehen und was uns plausibel erscheint.22
Diese unausgesprochene Erkenntnis, derer wir uns selten bewusst sind, prägt unser bewusstes Denken mehr, als wir meinen. Oft fühlen wir uns von bestimmten Argumenten angesprochen, weil sie zu diesen Grundannahmen passen. Wenn sich diese Grundannahmen verschieben, liegt es selten an logischen Argumenten, sondern meistens an Erfahrungen und Intuition, dass die alten Gewissheiten auf einmal schwächer werden.
Das Problem des Bösen ist ein gutes Beispiel für den Einfluss dieser Grundüberzeugungen auf unser angeblich so streng rationales Denken. James Wood und Barbara Ehrenreich haben geschildert, wie entscheidend in ihrer Jugend das Problem von Leid und Bösem in der Welt für sie war, nicht an Gott zu glauben. Wood, der aus einem christlichen Elternhaus kam, sagt, dass die Gewalt und das Böse im wirklichen Leben für ihn das Leben sinnlos machten, selbst wenn es Gott gäbe.23
Wood bezeichnet diesen Einwand gegen die Existenz Gottes als „so offensichtlich und so alt“, doch das stimmt so nicht ganz. Das Buch Hiob stellt das Ungeheuerliche an unverdientem Leid dar wie jeder andere antike Text, doch es sieht darin keinerlei Einwand gegen Gottes Existenz. Menschen im Altertum waren vermutlich mit Gewalt, Verlust und Bösem noch viel vertrauter als wir. Ihre Literatur ist voller Klage über unerklärliches Leid. Doch kein einziger antiker Schreiber kam auf die Idee, dass es deshalb keinen Gott geben könne. Warum wirkt dieses Argument heutzutage so rational und überzeugend?
Charles Taylor erklärt, warum Menschen in der Moderne angesichts von Leid sehr viel eher ihren Glauben verlieren als in früheren Zeiten: In unserer Kultur hat sich unser Vertrauen in unsere intellektuellen Fähigkeiten enorm verändert. Menschen im Altertum gingen nicht davon aus, dass der menschliche Verstand weise genug wäre, um darüber zu richten, wie ein unendlicher Gott die Dinge regelte. Erst in modernen Zeiten meinen wir, „die Sicherheit zu haben, dass wir alles berücksichtigt haben, um über Gott richten zu können“24. Erst als diese Grundüberzeugung über die Fähigkeiten unseres Verstandes entstand, wurde aus der Existenz des Bösen ein Argument gegen die Existenz Gottes.
Die modernen Argumente gegen Gott, die auf der Existenz des Bösen aufbauen, haben also einen bedeutsamen „Glaubens“-Hintergrund. Es kann keinen Gott jenseits unserer Vernunft geben – deshalb gibt es ihn nicht. Das geht natürlich an der eigentlichen Frage vorbei: Unsere Grundüberzeugungen bestimmen, dass unser bewusstes Denken die nötigen Beweise für Gott liefern soll, was es dann nicht schafft. Deswegen fanden Wood und Ehrenreich in ihrer Jugend, die beide damals schon brillante Denker waren, die These eines „monotheistischen Gottes“ abwegig. Aber es ist nicht wahr, dass ihr Denken ihren Glauben untergraben hatte. Eine neue Art Glauben hatte ihren alten, bescheideneren Glauben ersetzt: der Glaube an die Macht des menschlichen Verstandes und seine Fähigkeit, Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen.