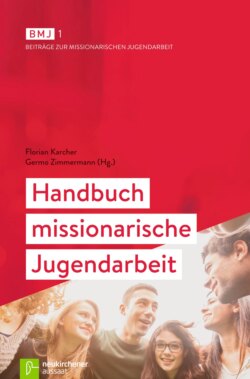Читать книгу Handbuch missionarische Jugendarbeit - Группа авторов - Страница 28
1. Erträge der Missionstheologie
ОглавлениеHenning Wrogemann hat „Missionstheologien der Gegenwart“ in einem umfassenden Lehrbuch dargestellt (Wrogemann 2013). Das Werk trägt der Einsicht Rechnung, dass „Mission“ in jüngerer Zeit vor allem in ökumenischem und interkulturellem Kontext thematisiert wird. Wrogemann spricht von „Missionstheologien“ programmatisch im Plural, da von der Missionstheologie gegenwärtig nicht mehr die Rede sein könne. Gleichwohl lassen sich in der Geschichte der Disziplin wesentliche Stationen und Meilensteine identifizieren, von denen einige im Folgenden kurz skizziert werden:
1 a) Nachdem im angelsächsischen Raum bereits Mitte des 19. Jahrhunderts „Missionstheologie“ betrieben wurde (z. B. bei der „Union Missionary Convention in New York 1854), gilt in Deutschland Gustav Warneck (1834–1910) als Vater der Missionswissenschaft im Sinne einer eigenen theologischen Disziplin. Seiner Zeit entsprechend verstand er unter „Mission“ schwerpunktmäßig die weltweite Bekehrung von Nichtchristen. „Mission“ definiert er wie folgt: „Unter christlicher Mission verstehen wir die gesamte auf die Pflanzung und Organisation der christlichen Kirche unter Nichtchristen gerichtete Thätigkeit der Christenheit“ (Warneck 1892: VIII). Obwohl Warneck Mission in diesem Sinne asymmetrisch als Verkündigung des Evangeliums an „die Heidenvölker“ versteht, enthält seine Missionstheologie bereits dialogische Elemente: „Der Missionar muss die Heiden verstehen, bevor sie ihn verstehen“ (Warneck 1892: 120). Dabei habe er an „die Funken des Lichts und der Wahrheit“ anzuknüpfen (Warneck 1892: 124), die er in der fremden Religiosität vorfinde. Auch soziale Missstände wie Sklaverei und Unterdrückung von Frauen seien im Kontext der Mission anzuprangern. Vor allem diese letzteren Aspekte – das dialogische und das soziale Anliegen – haben für das Missionsverständnis bleibende Bedeutung.
2 b) Als Pendant zu diesem Verständnis von „Äußerer Mission“ entstand ebenfalls im 19. Jahrhundert der Begriff der „Inneren Mission“, den insbesondere Johann Hinrich Wichern (ebenfalls nach angelsächsischen Vorbildern) entwickelt und in diakonische Praxis umgesetzt hat. Dabei halfen christlich motivierte Fürsorge und Liebestätigkeit, soziale Probleme der durch die Industrialisierung verarmten Bevölkerung zu bekämpfen. Zugleich sollte den entkirchlichten Menschen in ganzheitlicher Weise das Evangelium vermittelt werden. Auch dieses Anliegen aus der Entstehungsgeschichte der Diakonie in Deutschland hat bis heute nichts von seiner Relevanz verloren, nötigt es doch zu bedenken, dass Mission nicht nur durch Worte, sondern ebenso durch Taten und Strukturen geschieht und dass sich die missionarische Aufgabe auch in einem Land mit hohem christlichen Bevölkerungsanteil bzw. in einem volkskirchlichen Kontext stellt.
3 c) Nachdem – spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg – die problematische Verquickung von Mission mit Kolonialismus und Imperialismus ins allgemeine Bewusstsein getreten war, rückten die dialogischen Elemente ins Zentrum der missionstheologischen Reflexion. Insbesondere der Ökumenischen Bewegung war an einer Öffnung der Mission zum Dialog gelegen, zu einer Form der Kommunikation also, die auf gegenseitige Verständigung zielt. Dieser Ansatz wurde unter anderem von dem Heidelberger Religions- und Missionswissenschaftler Theo Sundermeier weiterentwickelt. Für ihn ist der Respekt gegenüber allem Fremden die Voraussetzung für Mission. Daraus leitet er sein Konzept der Konvivenz ab: „Unsere gemeinsame Geschöpflichkeit, unser aller Gegründetsein im Schöpferwillen Gottes, ist die Basis für die Suche nach der Konvivenz, die sich als Bereitschaft zur wechselseitigen Hilfe konkretisiert“ (Sundermeier 1999: 22). Die ideale Gelegenheit zur Begegnung sei dementsprechend das gemeinsame Feiern (vgl. Sundermeier 1999: 24).
4 d) Seit der Weltmissionskonferenz in Willingen 1952 vorherrschend ist das Verständnis von Mission als „Missio Dei“: Nicht die Kirche ist das Subjekt der Mission, sondern Gott selbst. Wie Gott der Vater Jesus Christus in die Welt sendet, so sendet dieser seine Jüngerinnen und Jünger zum Zeugnis und Dienst am Nächsten. Dementsprechend ist auch das Wesen der Mission aus dem Wesen Gottes und seiner liebevollen Selbsthingabe für andere abzuleiten. Daraus folgt „dienende Mission“, wie John Stott, einer der bekannten Theologen der Lausanner Bewegung, dies nennt, also die Verbindung von Evangelisation als Ausbreitung der Botschaft von Jesus Christus, mit dem Einsatz für Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Der Missionsauftrag sei, so Stott, „eine neue und dringliche Dimension“ des Liebesgebots (Stott 1974: 64). Um sich diesem Missionsverständnis explizit anzuschließen und es von dem in der Öffentlichkeit weitgehend negativ konnotierten Begriff „missionarisch“ abzugrenzen, verwenden seit den 1990er-Jahren nicht wenige Missionswissenschaftler und Praktiker, die der Lausanner Bewegung nahestehen, stattdessen das Adjektiv „missional“. In jüngerer Zeit hat vor allem David J. Bosch dieses Missionsverständnis aufgenommen und weitergeführt. Er beschreibt Mission als Teilhabe von Christen an der Sendung Jesu Christi und Fortsetzung der Inkarnation im Zeugnis der Gemeinde. Sie umfasse Diakonie ebenso wie Evangelisation (Bosch 2012).
5 e) „Das Thema Mission wird en vogue“ (Wrogemann 2013: 383) – so überschreibt Wrogemann in seiner Überblicksdarstellung der missionsgeschichtlichen Entwicklung in Deutschland die Epoche seit 1999 – ausgelöst durch jene EKD-Synode, bei der Eberhard Jüngel die Mission als „Herzschlag und Atem der Kirche“ bezeichnet hat (Jüngel 1999: 15). Dass „Mission“ seitdem in aller Munde ist, ändert freilich nichts daran, dass Stellenwert und Bedeutung von Mission theologisch kontrovers diskutiert werden. Als exemplarisch kann hier eine Debatte in den Jahrgängen 2002/03 der Zeitschrift „Pastoraltheologie“ gelten, die Eberhard Hauschildt in seinem Grundsatzbeitrag „Praktische Theologie und Mission“ dokumentiert hat (Hauschildt 2007: 499–502). Auslöser war ein Aufsatz von Hans-Jürgen Abromeit (2002: 126–136), in dem er die These vertrat, die Themen Mission, Evangelisation und Gemeindeaufbau sollten in der theologischen Ausbildung stärkere Berücksichtigung finden. Dem widersprachen im Folgenden mehrere Praktische Theologen, vor allem, indem sie dem Begriff „Mission“ die Begriffe „Kommunikation“ und „Wahrnehmung“ gegenüberstellten: So sei die missionarische Kompetenz der kommunikativen Kompetenz unterzuordnen (vgl. Kähler 2002: 144). Weiterhin wird „statt Mission und Evangelisation die genaue empirische Wahrnehmung von Religion und Kirche in der Moderne“ (Kretzschmar 2002: 328) gefordert. Reiner Knieling hat in dieser Kontroverse zu Recht vor den falschen Alternativen gewarnt (vgl. Knieling 2003: 287–299): Genaue Wahrnehmung gehe allen missionarischen Aktivitäten voraus. Und ebenso gelte: Mission ist ihrem Wesen nach (wechselseitige) Kommunikation.
6 f) Henning Wrogemann selbst entwirft in Band 2 des „Lehrbuchs Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft“ nach seiner gründlichen Darstellung zahlreicher „Missionstheologien“ sein eigenes Verständnis von Mission als „oikomenischer Doxologie“. Dabei geht es ihm um „geistliche Grundlagen christlicher Mission“ (Wrogemann 2013: 405): Das Lob Gottes soll als Kraftquelle der Mission wiederentdeckt werden. Mission sei dann „das Geschehen der Verherrlichung Gottes durch das Lebenszeugnis der von Gott versöhnten, erlösten und befreiten Kreaturen“ (Wrogemann 2013: 424). Dass nicht zuletzt Martin Reppenhagen – bis vor Kurzem Stellvertreter von Michael Herbst am Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung der Universität Greifswald (IEEG) – sich dieses Verständnis zu eigen macht (vgl. Reppenhagen 2015: 49), mag als Beleg für dessen integrative Kraft gelten.
7 g) Die gegenwärtige missionstheologische Debatte ist insgesamt von der Überwindung früherer Konfliktlinien gekennzeichnet. Dazu haben nicht zuletzt Wolfgang Huber und Heinrich Bedford-Strohm als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland beigetragen. Beide haben wiederholt für Mission als unverzichtbare Dimension von Kirche plädiert. Mission, so Bedford-Strohm jüngst in einer Predigt über Mt. 28,16-20, bedeute schlicht, von Gott „zu erzählen, in der Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen zu leben, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Und deswegen ist Mission eine völlig unverzichtbare Dimension der Kirche und des Christseins“ (Bedford-Strohm 2015: 3). Dies wird auch in offiziellen Verlautbarungen der Evangelischen Kirche in Deutschland immer wieder bekräftigt, zuletzt im Grundlagentext des Rates der EKD mit dem Titel „Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangelischer Perspektive“. Mission, so heißt es hier, sei der „Ausdruck dafür, dass sich die Christenheit nicht selbst genügt, sondern ihrem Gott entspricht, indem sie sich den Menschen zuwendet […]. Ob Mission gelingt, entscheidet sich nicht allein am guten Willen derer, die sich für sie in besonderer Weise berufen fühlen. Sie ist Sache der ganzen Kirche“ (EKD 2015: 54).
8 h) Bei allen Bemühungen um einen missionstheologischen Konsens sollte jedoch nicht verschleiert werden, dass es nach wie vor unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, welches Ziel Mission in volkskirchlichem Kontext hat. Thies Gundlach, Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD, betont in seiner Interpretation der V. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU V) unter dem Titel „Mission für die Vielen“: „Eine evangelische Volkskirche muss […] in ihrer missionarischen Ausrichtung auch und gerade die Menschen in ihrer Halbdistanz, ihrer Unbestimmtheit, in ihrer Institutionsskepsis ansprechen und stabilisieren können“ (Gundlach 2015: 4). Bei Michael Herbst heißt es hingegen: „Wir sollten uns […] endlich von der Illusion verabschieden, Kirchenmitgliedschaft in freundlicher Distanz sei auf Dauer eine tragfähige, gleichberechtigte christliche Existenzweise. […] Ziel von Mission ist Konversion. Anders gesagt: Es ist unser Ziel, dass Menschen das Evangelium als ‚Lebensmacht‘ (Max Weber) ergreifen und sich der Gemeinschaft der Christen verbindlich anschließen“ (Herbst 2006: 181). Was gilt nun? Sollen die (Halb-)Distanzierten in ihrer Distanz stabilisiert oder durch Konversion aus ihr herausgelockt werden? Sollen distanzierte Kirchenmitglieder so bleiben, wie sie sind – oder sollen sie sich verändern? Tobias Faix entscheidet sich in dieser Frage von seinem transformatorischen Ansatz her so, dass er sagt: Beide müssen sich verändern und ihre Distanz verlassen – die Person, die das Evangelium hört, in all ihren Bezügen, aber auch die Verkündigenden, die Gemeinde vor Ort und die Kirche, indem sie zur „missionalen Kirche“ oder zur „Emerging church“ wird (Faix 2014: 445 f.).
9 i) Unter dem Titel „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ haben im Jahr 2011 der Ökumenische Rat der Kirchen, der Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dialog und die weltweite Evangelische Allianz ein missionstheologisches Grundsatzpapier verabschiedet, das einen weitgehenden ökumenischen Konsens formuliert. In der Präambel heißt es: „Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Darum ist es für jeden Christen und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu verkünden und seinen/ihren Glauben in der Welt zu bezeugen. Es ist jedoch wichtig, dass dies im Einklang mit den Prinzipien des Evangeliums geschieht, in uneingeschränktem Respekt vor und Liebe zu allen Menschen“ (Mission:Respekt 2011: 1). Diese Prinzipien werden im Folgenden näher bestimmt: Es geht u. a. um das Handeln in Gottes Liebe, um Taten des Dienens und der Gerechtigkeit, Ablehnung von Gewalt, um den Schutz von positiver und negativer Religionsfreiheit und um gegenseitigen Respekt und Solidarität (vgl. Mission:Respekt 2011: 2–4). Dieser Konsens bildet eine solide Grundlage für ein – auch ökumenisch belastbares – Missionsverständnis. Schließlich:
10 k) eine terminologische Beobachtung: In einigen neueren missionstheologischen Veröffentlichungen ist der Begriff „Mission“ durch den biblischen Begriff der „Sendung“ ersetzt worden. Der Sendungsbegriff eignet sich zumindest als Ergänzung zum Missionsbegriff. Er ist zum einen unbelasteter, zum anderen kann er sowohl einen Vorgang bezeichnen, durch den jemand einen Auftrag erfüllt, als auch den Inhalt des Auftrags bzw. der Botschaft. In diesem Zusammenhang wird auch in säkularen, etwa wirtschaftlichen Zusammenhängen zunehmend von „Sendung“ (und dann sogar wiederum von „Mission“) gesprochen, die jemand als Individuum oder Körperschaft bzw. Unternehmen hat.