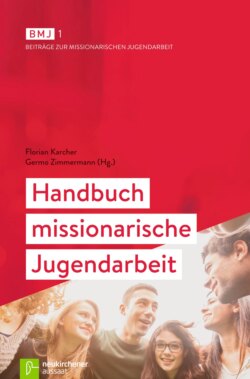Читать книгу Handbuch missionarische Jugendarbeit - Группа авторов - Страница 37
2.2 Matthäus (Mt 28,18-20)
ОглавлениеEine neutestamentliche Textstelle, die im Zusammenhang mit dem Thema „Mission“ besonders gern zitiert wird, findet sich in Mt 28,18-20. Diese Passage ist später als sog. „Missionsbefehl“ bekannt geworden. Der Abschnitt bildet den Schluss des Matthäusevangeliums und trägt mehrere Züge, die für diese Schrift typisch sind. In der Rahmenhandlung erzählt der Evangelist Matthäus, der seinen Text in den 80er–Jahren des 1. Jahrhunderts verfasst (ähnlich auch Schnelle 2007: 265), wie der auferstandene Jesus den elf Jüngern erscheint – also dem Zwölferkreis minus Judas, da dieser Jesus zuvor verraten hat (V. 16). Als sie ihn erkennen, fallen die Elf vor Jesus zu Boden, um ihn zu verehren (V. 17). Danach ergreift Jesus das Wort. Seine kurze Rede beginnt mit dem Hinweis auf seine Vollmacht und endet mit der Zusage seines Beistands; gerahmt zwischen diesen beiden ermutigenden Aussagen steht der eigentliche Auftrag, den der Auferstandene den Jüngern erteilt.
Zu Beginn der kurzen wörtlichen Rede betont Jesus hier also seine „Vollmacht“ (gr. exousía), die sich über Himmel und Erde erstreckt (V. 18; vgl. Schneider 1982: 85). Schon die Bemerkung, dass sie ihm „gegeben“ wurde, sagt etwas über die Beschaffenheit dieser Vollmacht aus. „Vollmacht“ ist etwas, das Jesus nicht aus sich selbst heraus besitzt. Es handelt sich vielmehr um eine verliehene Macht. Als Geber dieser Vollmacht kommt nur Gott infrage, auch wenn er hier nicht ausdrücklich genannt wird. Wer das Matthäusevangelium bis hierher gelesen hat, weiß bereits, dass Gott es ist, der Jesus bevollmächtigt und also mit Macht ausgestattet hat (vgl. Mt 21,23-27). Jesus ist bei Matthäus daher, wie auch in den anderen neutestamentlichen Evangelien, der von Gott legitimierte Sohn, durch den sich die himmlische Welt Gottes zu den Menschen hin öffnet (vgl. Baumbach 1967: 890). Als Auferstandener besitzt Jesus Vollmacht nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel (28,18).
Was das Matthäusevangelium von den anderen Evangelien unterscheidet, ist die besonders starke Betonung der Lehrtätigkeit Jesu. Zwar verknüpft auch das Markusevangelium bereits das Motiv von Jesu Vollmacht sowohl mit seiner Wundertätigkeit (Mk 11,27-33 par. Mt 21,23-27) als auch mit seiner Lehrtätigkeit (Mk 1,22 par. Mt 7,29). Jedoch platziert Matthäus die Bemerkung über Jesu Lehre in Vollmacht an einer Schlüsselstelle, nämlich am Ende der sog. „Bergpredigt“, die es so nur im Matthäusevangelium gibt (Mt 5-7). Diese Textpassage gibt auch Aufschluss über die Lieblingsthemen der Lehre Jesu bei Matthäus: Jesus spricht hier besonders gern über Fragen der Lebensführung, also der Ethik: Da geht es um Töten (7,21), Ehebruch (7,28), Schwören (7,33) u. v. m. Dem entspricht es, dass die Anhänger Jesu „Jünger“ (gr. mathêtaí) heißen (z. B. Mt 5,1; 28,16 u. ö.). Der griechische Begriff, dessen Wiedergabe als „Jünger“ sich im christlichen Jargon eingebürgert hat, könnte sehr treffend auch mit „Schüler“ übersetzt werden. Dies gilt besonders im Matthäusevangelium: Als Schüler werden die Jünger von ihrem Lehrer Jesus darüber unterwiesen, wie ein gelingendes Leben sich gestalten lässt.
Nach seiner Auferstehung nun beauftragt der Lehrer Jesus seine Schüler dazu, die Lehre zu bewahren und auszubreiten. Damit geht eine Wandlung in der Rolle der Jünger einher: Was sie zuvor von Jesus empfangen haben, sollen sie nun an andere weitergeben (28,19). An dem Imperativ „Geht und macht alle Völker zu Jüngern“ ist dreierlei bemerkenswert. Zuerst macht die Anweisung es für die Jünger erforderlich, sich in Bewegung zu setzen. Dass die Völker von sich aus auf die Jünger zukommen sollten, um gelehrt zu werden, ist unwahrscheinlich. Deswegen müssen die Verkündiger sich auf den Weg begeben. Als zweites geht es eben darum, die Völker zu „schulen“ oder „zu Jüngern zu machen“ (gr. mathêteúô). So wie das Verhältnis zwischen Jesus und den Jüngern dadurch geprägt war, dass einer lehrte und die anderen lernten, soll es nun auch im Verhältnis zwischen den von Jesus gesandten Jüngern und den Völkern zugehen (vgl. Baumbach 1967: 890–891). Der dritte wichtige Punkt: Wie bei Paulus werden auch in Mt 28 die „Völker“ (éthnê) als Empfänger der missionarischen Bemühungen genannt. Auch die Schüler Jesu bei Matthäus können sich folglich nicht auf die faule Haut legen. Ihre Sendung beschränkt sich nicht auf Israel, sondern sie beauftragt sie auch zur Verkündigung an den Nicht-Juden (vgl. Frankemölle 1982: 100; Hahn 1965: 109; Stuhlmacher 1981: 112) und nötigt sie somit, sich auf Menschen einzulassen und einzustellen, die einer für sie fremden kulturellen Gruppe angehören. Aus diesem Grund sind die Gesandten zuvor ja auch ausdrücklich zum „Gehen“ aufgefordert worden.
Wie genau funktioniert das aber, Menschen aus allen Völkern zu Jüngern zu machen? Dies erläutert der matthäische Jesus in den folgenden Worten: Menschen werden dadurch zu Schülern, dass man sie tauft (V. 19) und lehrt (V. 20). Die Grammatik des Satzes lässt daran keinen Zweifel, dass die Tätigkeitsworte „taufen“ und „lehren“ als Entfaltung des voranstehenden „zu Jüngern machen“ verstanden werden wollen (vgl. Baumbach 1967: 890–891; Schneider 1982: 87), denn auf den Imperativ „macht zu Jüngern“ folgen im griechischen Text sodann zwei Partizipien, die sich wörtlich mit „taufend“ und „lehrend“ übersetzen ließen. Indem sie Taufe und Lehre empfangen, werden die Völker zu Jüngern. Dass Jesus die Taufe hier vor der Lehre nennt, könnte dafür sprechen, dass Matthäus die Eingliederung in die christliche Gemeinschaft, die sich in der Taufe vollzieht, als Vorbedingung für die Lehre versteht (so Baumbach 1967: 893; vgl. Hahn 1965: 104–105; dagegen Bieder 1964: 12). Aber auch wenn man hier keine zeitliche Abfolge, sondern eher ein sachliches Nebeneinander erkennen möchte, bleiben doch beide Aspekte wichtig: Durch die Aufnahme in die Gemeinde und durch die Unterweisung in der Lehre Jesu können Menschen zu Jüngern werden. Auf Matthäus geht die trinitarisache Taufformel „in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes“ zurück (V. 19), die bis heute weit verbreitet ist. Und die folgende Anweisung, die Völker zu lehren (V. 20), weist auch wiederum den bereits angesprochenen ethischen Schwerpunkt auf, denn in dieser Lehre geht es um das Tun, um das „Einhalten“ dessen, was Jesus geboten hat (vgl. Kasting 1969: 36–37). Letztlich geht also auch die durch seine Gesandten vermittelte Lehre wiederum auf den Lehrer Jesus zurück.
Der Schlusssatz verheißt bei all dem die Nähe Jesu. „Siehe, ich bin unter euch an allen Tagen bis zum Ende der Weltzeit“ (V. 20). Indem er seine Schrift genau mit dieser Aussage enden lässt, rahmt der Evangelist Matthäus seine Darstellung durch das Motiv des Beistands Gottes bzw. Christi. Denn ganz ähnlich hat das Matthäusevangelium auch bereits angefangen. Der Engel, der Josef die Geburt des Kindes ankündigt (Mt 1,23), zitiert an dieser Stelle das Wort aus Jes 7,14: „Sie werden ihn Immanuel nennen.“ Die Ankündigung bezieht der Engel unmissverständlich auf den noch ungeborenen Jesus, und er übersetzt den Namen „Immanuel“ zutreffend aus dem Hebräischen mit „Mit uns ist Gott“. Dass Gott den Menschen in Jesus nahekommt, ist bei Matthäus also ein charakteristischer Zug im Nachdenken über die Bedeutung Jesu. In der Bibelwissenschaft wird deswegen diesbezüglich oft von der „Immanuel-Christologie“ des Matthäusevangeliums gesprochen. Und genau dieser Gedanke schließt nun auch den Text ab: Nicht nur während seines irdischen Wirkens, sondern auch darüber hinaus versichert der auferstandene Jesus seinen Schülern, dass seine Nähe, die ja die Nähe Gottes ist, ihnen erhalten bleibt (vgl. Frankemölle 1982: 129).