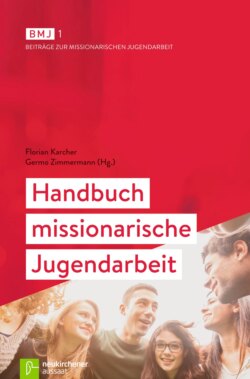Читать книгу Handbuch missionarische Jugendarbeit - Группа авторов - Страница 39
2.4 Johannes (Joh 20,19-23)
ОглавлениеWie bei Matthäus und Lukas findet sich auch im Johannesevangelium eine explizite Beauftragung der Jünger durch den auferstandenen Christus. Durch mehrere eigene Schwerpunkte hebt sich aber die johanneische Darstellung von den bisher behandelten ab. Das Johannesevangelium entsteht vermutlich im letzten Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts (vgl. Stuhlmacher 1981: 128; etwas später Schnelle 2007: 511) und damit als letztes der vier neutestamentlichen Evangelien. Der Autor des Johannesevangeliums geht davon aus, dass seine Leserschaft eines oder vielleicht sogar mehrere der anderen Evangelien kennt. Deren Inhalt setzt er voraus und erzählt besonders das ganz ausführlich, was er an den anderen Evangelien als ergänzungsbedürftig ansieht. Aus diesem Grund sind auch die eigenen Akzente von hoher Relevanz, die der Text in Joh 20,19-23 setzt.
Zunächst fällt der zweifache Friedensgruß ins Auge, den Jesus an die Gruppe der Jünger richtet (VV. 19.21). Der Wunsch „Friede mit euch“ könnte als Übersetzung des hebräischen Grußes shalom zwar als schlichte Begrüßungs-Floskel verstanden werden. Jedoch zeigt sich an der Wiederholung der Wendung, dass ihr hier auch inhaltliche Bedeutung zukommt (vgl. Bieder 1964: 47–48). Das Wort „Frieden“ verwendet der Johannes-Evangelist nur an wenigen Stellen, aber schon diese machen deutlich, dass das Motiv jeweils mit einem bestimmten gedanklichen Rahmen verknüpft ist. Neben den grußartigen Belegen in Joh 20 (20,19.21.26) kommt das Stichwort „Friede“ noch in Joh 14,27 und 16,33 vor, und zwar auch wiederum im Munde Jesu. Beide Stellen gehen davon aus, dass der Abschied von Jesus die Jünger in eine Situation der Orientierungslosigkeit stürzen wird. Hinzu kommen sich anbahnende Konflikte, in die die Glaubenden aufgrund ihrer Überzeugung hineingeraten (vgl. Burchard 1978: 330–331). Weil die Jünger sich vor Auseinandersetzungen fürchten, haben sie die Türen des Hauses verschlossen, in dem sie sich aufhalten (V. 19). Und weil sie zweifeln, muss Jesus ihnen nach dem Gruß zuerst seine Wundmale als Belege seiner Auferstehung vorweisen (V. 20). Angesichts dieses emotionalen Cocktails aus Verwirrung, Furcht und Traurigkeit, den der johanneische Jesus bei seinen Jüngern vorhersieht, ist es angebracht, ihnen den „Frieden“ zuzusagen. Dieser Friede impliziert damit innere Ruhe, Orientierung und Trost. Es ist nicht irgendein Friede, sondern Joh 14,27 und 16,33 binden den Frieden ausdrücklich an die Person Jesu zurück. Der Friede Jesu gibt den Jüngern Halt, auch dann, wenn sie durch die Kreuzigung und die darauf folgenden Ereignisse körperlich von Jesus getrennt werden. In diesem Sinn ist auch der Friedensgruß in Joh 20,19.21 zu verstehen.
Passend dazu kommt hier dann auch der Heilige Geist ins Spiel (V. 22). Anders als andere neutestamentliche Autoren nennt der Johannes-Evangelist den Heiligen Geist häufig den „Parakleten“ (gr. paráklêtos), d. h. „Tröster“ (Joh 14,16.26; 15,26; 16,7). Die beschriebene Verunsicherung der Jünger angesichts des Fortgangs Jesu macht diesen Sprachgebrauch plausibel. Jesus rechnet damit, dass seine Jünger die Orientierung verlieren könnten, sobald er nicht mehr körperlich bei ihnen ist. Allen menschlichen Befürchtungen, dass die empfundene Abwesenheit Jesu es seinen Nachfolgern schwer machen könnte, weiterhin an ihn zu glauben, steuert das Johannesevangelium durch die Verheißung des „Trösters“ entgegen. Während Jesus den Heiligen Geist im bisherigen Verlauf des Texts stets angekündigt hat (v. a. Joh 14-16), gibt er ihn nun aktiv an die Jünger weiter. Dies wird durch die Geste des Anhauchens gesagt (20,22). Dabei handelt es sich einerseits um ein Gedankenspiel, denn das griechische Wort pneúma („Geist“) kann auch soviel wie „Lufthauch“ bedeuten (vgl. Joh 3,8). Andererseits spielt das Johannesevangelium hier aber auch auf die Erzählung von der Schöpfung des Menschen an, dem Gott das Leben verleiht, indem er ihn anhaucht (Gen 2,7). So wie Gott den Menschen zu einem lebendigen Wesen erschafft, gibt Jesus seinen Jüngern Trost und Halt, indem er ihnen den Heiligen Geist verleiht.
Erst als Jesus den verzagten Jüngern die Wundmale seiner Kreuzigung zeigt, erkennen diese, mit wem sie es gerade zu tun haben. Dass Jesus es schafft, trotz der verschlossenen Türen den Raum zu betreten (V. 19), ist zwar spektakulär, weist ihn aber noch nicht eindeutig aus. An den Verletzungen seiner Hände und seiner Seite (vgl. Joh 19,34) erst identifizieren sie ihren Herrn Jesus zweifelsfrei. Hier begegnet ihnen der Gekreuzigte, allerdings quicklebendig. Wie auch in der folgenden Thomas-Episode (Joh 20,24-29) sehen die Jünger darin den eindeutigen Beleg für die Auferstehung Jesu. Sie gelangen zu einer christologischen Einsicht: Jesus ist auferstanden. Er ist der Gottessohn und „Herr“ (gr. kýrios). Aus diesem Grund beginnen die zuvor noch zweifelnden Jünger nun, sich zu freuen (V. 20).
Die Erkenntnis verpflichtet. Das Johannesevangelium wimmelt von Bemerkungen, die Jesus als den von Gott gesandten Sohn darstellen (vgl. Joh 3,17; 5,36 u. v. m.). Seine eigene Sendung durch den Vater parallelisiert Jesus nun mit der Sendung seiner Jünger (20,21; vgl. Hahn 1965: 142). Indem er zwei verschiedene griechische Vokabeln für „senden“ benutzt (apostéllô und pémpô), zeigt der Text an, dass die Sendung Jesu durch Gott nicht identisch mit der Sendung der Jünger durch Jesus ist. Aber das Zweite folgt aus dem Ersten. So wie Jesus seine Beauftragung vom Vater empfangen hat, empfangen die Jünger nun ihren Auftrag vom Auferstandenen (vgl. Bieder 1964: 40). Auch wenn hier gar nicht ausdrücklich die Rede von einer bestimmten Botschaft ist, die die Jünger predigen sollen, setzt das Johannesevangelium durch die Parallelisierung der Sendungen doch wieder einen christologischen Schwerpunkt: Jesus ist auferstanden, er ist der Sohn, der von Gott gesandt wurde. Im Lichte dieses Glaubens werden die Jünger von Jesus beauftragt.
Damit hängt auch die Sündenvergebung zusammen, zu der die Beauftragten hier explizit ermächtigt werden (V. 23). Sehr unmittelbar zieht das Johannesevangelium eine Verbindungslinie zwischen der Identität Jesu und den heilvollen Konsequenzen dieser Identität für die Glaubenden. Jesus ist „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt“ (Joh 1,29). Der Glaube an Jesus als den Sohn Gottes befreit die Menschen von ihren Sünden (vgl. 8,24; 19,9). Sachlich lässt sich daher die Sündenvergebung, wie Joh 20,23 sie beschreibt, nicht vom Christusglauben ablösen, zumal ja auch der gesamte Textabschnitt Joh 20,19-23 klar christologisch geprägt ist.