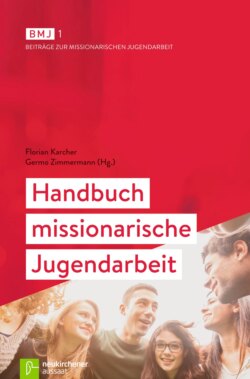Читать книгу Handbuch missionarische Jugendarbeit - Группа авторов - Страница 36
2.1 Paulus (Gal 1,11-24)
ОглавлениеDie Briefe des Paulus sind die ältesten uns erhaltenen Dokumente des frühen Christentums. In ihnen wird besonders deutlich, wie sehr frühchristliche Theologie situationsbezogen angelegt ist. Paulus sieht sich mit konkreten Problemen konfrontiert und entwickelt sein theologisches Denken in Auseinandersetzung mit genau diesen sich ihm stellenden Schwierigkeiten. Der Galaterbrief entsteht in der Mitte der 50er-Jahre n. Chr. (vgl. Schnelle 2007: 113). In diesem Schreiben schlägt Paulus einen besonders strengen Tonfall an, da er mit den Gemeinden in Galatien in eine scharfe Auseinandersetzung geraten ist. Paulus selbst hatte den Menschen in Galatien den christlichen Glauben verkündigt, und infolge dessen sind Gemeinden entstanden. Dem Text des Galaterbriefs lässt sich nun entnehmen, dass in Galatien nach der Abreise des Paulus noch andere christliche Missionare aufgetreten sind, die eine von der Theologie des Paulus teilweise abweichende Lehre vertreten (vgl. Gal 1,6; 3,1). Die Menschen in Galatien stammen größtenteils aus einer nicht jüdischen Tradition und gehören damit aus jüdischer Sicht zu den „anderen Völkern“ (gr. éthnê, „Heiden“). Paulus hat ihnen verkündigt, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus gerecht werden und damit dem Gottesvolk angehören können. Die anderen Missionare predigen nun aber, dass der einzige Weg zum Heil über das Judentum führt und man deswegen nur als Jude wirklich Christ sein könne (vgl. Schnelle 2007: 120–121). Den Glauben an Jesus Christus bejahen sie, aber sie fordern von den Galatern, dass sie sich an das jüdische Gesetz halten, um dadurch erst zu richtigen – d. h. jüdischen – Christen zu werden. Mit dieser Botschaft finden die gegnerischen Missionare in Galatien guten Anklang. Mehrere Männer sind offenbar schon im Begriff, sich beschneiden zu lassen, um damit als Christen ihre Zugehörigkeit zum Judentum zu dokumentieren. Angesichts dessen geht Paulus auf die Barrikaden (vgl. 5,12). Seiner Ansicht nach versetzt allein der Christusglaube die Menschen in ein heilvolles Verhältnis zu Gott (3,26). Wenn die von Geburt her nicht jüdischen Christen in Galatien sich nun dem jüdischen Gesetz unterwerfen, wird das Heil nach der Ansicht des Paulus dadurch an eine zusätzliche Bedingung geknüpft und die Bedeutung des Glaubens geschmälert. Das kann Paulus nicht akzeptieren.
Es ist aufschlussreich, dass Paulus gleich am Beginn des Galaterbriefs auf seine Biografie zu sprechen kommt. Angesichts der komplexen theologischen Konfliktsituation hält er es für geboten, zunächst einmal seine eigene Person zu thematisieren. Um die Legitimation seiner Botschaft abzusichern, schildert er den Galatern, wie er von Jesus Christus zu seinem Dienst beauftragt worden ist (Gal 1,11-24). Dieser Textabschnitt ist auch unter missionstheologischer Perspektive von Interesse. Zunächst einmal fällt auf, dass Paulus hier den Weg beleuchtet, auf dem er seine Botschaft empfangen hat, die die galatischen Gemeinden von ihm kennen. Eine menschliche Instanz war dabei weder als Urheber noch als Vermittler beteiligt. Vielmehr nimmt Paulus für sich in Anspruch, das Evangelium direkt von oben erhalten zu haben, nämlich als eine „Offenbarung (apokálypsis) Jesu Christi“ (V. 12). Die Formulierung lässt die Frage offen, ob Christus dabei als Ursprung oder als Inhalt der Offenbarung begriffen werden muss. Klarheit darüber, wie Paulus sich diesen Prozess vorstellt, bringt wenig später dann aber V. 16: Gott hat Paulus seinen Sohn offenbart (apokalýptô). Gott ist folglich der Offenbarer, Christus hingegen das Objekt des Offenbarungs-Vorgangs (vgl. Kasting 1969: 56). Als Inhalt der göttlichen Offenbarung ist das Evangelium (V. 11) also eine Botschaft, die Paulus nicht mit den Mitteln seines eigenen Verstandes erkennen konnte. Schon gar nicht hat er es sich selbst erdacht oder ist von einem anderen Menschen gelehrt worden (V. 12). Nein, Gott selbst hat es Paulus kundgetan. Dies ist das Wesen der Offenbarung: Gott ermöglicht dem Menschen eine Einsicht, die diesem ohne Gottes Zutun verborgen bleiben müsste.
Was besagt diese Botschaft nun? Ihr Gegenstand ist Jesus Christus (V. 12) als der Sohn Gottes (V. 16). Bevor Paulus die göttliche Offenbarung erlebt hat, hielt er den christlichen Glauben für einen gefährlichen Irrtum, den es zu bekämpfen gilt (VV. 13.23). Nun aber erkennt Paulus: Jesus ist der Christus. Das griechische Wort christós bezeichnet hier den gesalbten und durch Gottes Autorität in sein Amt eingesetzten Messias. Dieser ist Jesus, der Sohn Gottes (V. 16). Und mehr noch: Wenn Jesus ihm auf diese Weise in der Offenbarung begegnen kann, dann ist für Paulus klar: Jesus ist mit seiner Kreuzigung nicht im Tod geblieben, sondern er lebt. Er ist auferstanden. An anderer Stelle macht Paulus dies besonders deutlich, wenn er sich nämlich in 1Kor 15,3-10 in die Liste der Auferstehungs-Zeugen einreiht (vgl. Kasting 1969: 59). In der Offenbarung Gottes begegnet Paulus dem auferstandenen Jesus und erkennt in ihm den Christus.
Gleichzeitig empfängt Paulus mit der und durch die Offenbarung aber auch eine persönliche Beauftragung von Gott. Die Formulierung, mit der er diese Beauftragung beschreibt, erinnert mit Absicht an bestimmte Wendungen der Hebräischen Bibel, in denen bekannte Propheten ihre Berufung durch Gott schildern (vgl. Jes 49,1; Jer 1,5). Indem er anmerkt, Gott habe ihn „von Mutterleib an ausgesondert“ (V. 15), stellt Paulus sich selbst also in eine Reihe mit den als Autoritäten anerkannten Propheten Jesaja und Jeremia (vgl. Pesch 1982: 62; Reinbold 2000: 164–165). Mit der Berufung zur Verkündigung einer göttlichen Botschaft verbindet sich hier außerdem die Nennung einer bestimmten Zielgruppe: Zu den „Völkern“ (gr. éthnê) soll Paulus gehen (V. 16), d. h. zu solchen Menschen, die nicht bereits von Geburt an als Juden zum Volk Gottes gehören (vgl. Bieder 1964: 30–31; Kasting 1969: 57–58; Zeller 1982: 175). Für den Juden Paulus bedeutet dies, dass er soziale bzw. kulturelle Grenzen überschreiten muss, um sich auf solche Menschen einzulassen, die ein anderes Gepräge aufweisen als er selbst. Ganz wichtig ist für Paulus dabei die Unabhängigkeit von menschlichen Autoritäten. Deswegen betont er, dass er nach seiner Berufung erst einmal nicht nach Jerusalem gegangen ist (V. 16–17), denn dort sitzen die leitenden Apostel der frühen christlichen Kirche. Nicht ihnen gegenüber sieht Paulus sich in der Verantwortung, sondern er unterstellt sich einzig und allein dem Willen Gottes und der Offenbarung Jesu Christi.
Mit diesem Akzent will Paulus sich gezielt von den Ansprüchen der galatischen Gegen-Missionare distanzieren. Er erreicht dies auch, indem er für sich den Titel eines „Apostels“ in Anspruch nimmt. Über die Jerusalemer Autoritäten sagt er, dass sie bereits „vor mir Apostel [waren]“ (V. 17), und impliziert damit, dass er inzwischen aber selbst auch unter die Apostel gezählt werden will (vorsichtiger Hahn 1965: 83), obwohl er Jesus zu Lebzeiten gar nicht gekannt hat und deswegen nicht auf die gleiche Weise wie die Zwölf zum Dienst beauftragt worden ist. Dennoch sieht Paulus auch sich selbst als apóstolos, d. h. als „Gesandten“ Christi. Deutlich wird dies insbesondere auch an den Anfängen der paulinischen Briefe, wo er sich regelmäßig als „Apostel“ vorstellt (neben Gal 1,1 auch 1Kor 1,1; 2Kor 1,1; Röm 1,1).
Die Konsequenz der Berufung besteht darin, dass Paulus fortan eine Nachricht an die „Völker“ zu verkündigen hat. Der Inhalt dieser Botschaft ist der „Sohn Gottes“ (V. 16) oder auch der „Glaube“ an ihn (V. 23). Auffällig oft benutzt Paulus in diesem Zusammenhang den Begriff der „guten Botschaft“ (gr. euangélion). Das Wort ist in der antiken Welt vor allem in politischen Zusammenhängen gebräuchlich: Wo ein Herrscher sich um das Wohlergehen seines Volkes kümmert und die Kunde von den Wohltaten des Herrschers bekannt gegeben wird, handelt es sich um ein „Evangelium“. In diesem Sinne interpretiert Paulus auch Gottes Handeln an den Menschen: Als wohltätiger Herrscher handelt Gott zugunsten seines Volks. Deswegen häufen sich im Textabschnitt Gal 1,11-24 auch die Stichworte „Evangelium“ (V. 11) und „evangelisieren“ (VV. 11.16.23; vgl. Burchard 1978: 315–320).