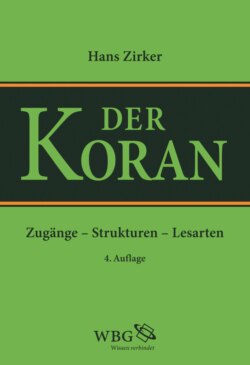Читать книгу Der Koran - Hans Zirker - Страница 10
(1) Der Anspruch des Koran
ОглавлениеSeinem ursprünglichen Charakter nach ist der Koran kein Buch zum privaten Lesen, sondern zum Hören beim öffentlichen Vortrag. Sowohl historisch wie theologisch kommt dem rezitierten Wort der Vorrang zu.6 Am Anfang des Abschnittes, den viele für den ältesten der ganzen Sammlung halten,7 steht die an Mohammed gerichtete Aufforderung:
Trag vor! (96,1.3)
Im Einklang mit dem entsprechenden arabischen Verb bedeutet der Name „Qurʾān“, ein Lehnwort aus dem Syrischen, „Vortrag“, „Rezitation“ oder – der christlich liturgischen Sprache gemäß – „Lesung“ (obgleich der Koran gottesdienstlich bis heute nicht eigentlich vorgelesen, sondern ohne Buchbenutzung rezitiert wird) und „Lektionar“, Sammlung der vorzutragenden Texte. Schon im Koran ist die Selbstbezeichnung mehrdeutig: „Qurʾān“ kann „die Schrift“, „das Buch“ meinen (das aber derart vergegenständlicht zu Mohammeds Zeit noch nicht vorlag, allenfalls intendiert war, doch in himmlischer Existenz vorausgesetzt wurde) wie besonders die zu hörende Rede.
Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und die
Rezitation – den Koran – bei Tagesanbruch! (17,788)
Das literarische Zeugnis und die kultische Aktion gehören zusammen; sie sind zwei Realisationsformen von Gottes Wort.
Das sind die Zeichen der Schrift und eines deutlichen Koran. (15,19)
Das sind die Zeichen des Koran und einer deutlichen Schrift (27,1).
So hat der Koran seinen originären Platz in der Versammlung der Gläubigen, die aufgefordert sind:
Wenn der Koran vorgetragen wird, dann hört hin und seid still!
Vielleicht findet ihr Erbarmen! (7,204)
Dann aber ist ihnen aufgegeben, dass sie ihn auch selbst wieder „recht vortragen“ (2,121). In dieser ständigen Proklamation von Gottes Wort ist der Koran der Grundtext, der allen übrigen Äußerungen islamischen Lebens vorausliegt und sie bestimmen soll. Nur so ist es verständlich, dass bei den von alters her genannten „Säulen des Islam“ – Bekenntnis, rituellem Gebet, Fasten, Sozialabgabe und Wallfahrt nach Mekka – nicht auch der Koran genannt wird. Er ist das Fundament der Gemeinschaft schlechthin, historisch mit dieser gleichursprünglich, stets vergegenwärtigt im täglichen Gottesdienst, im öffentlichen wie im privaten Raum, vor allem und unverzichtbar durch die erste Sure, „die Eröffnung“ (al-fātiḥa).10
Wie der Koran seiner eigenen Absicht gemäß recht gehört und als was er verstanden werden soll, formuliert der für das ganze Buch programmatische Anfang der zweiten Sure in erhabener Prägnanz (für Goethe der „ganze Inhalt des Korans, um mit wenigem viel zu sagen“11). Der majestätische Plural „wir“ zeichnet dabei die Gottesrede aus.
Das ist die Schrift – an ihr ist kein Zweifel –, Führung für die Gottesfürchtigen,
die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem spenden, womit wir sie versorgt haben,
die an das glauben, was zu dir und vor dir herabgesandt worden ist, und dabei vom Jenseitig-Letzten überzeugt sind.
Die sind von ihrem Herrn geführt. Denen ergeht es gut. (2,2–5)
Das Buch wird vorgetragen als Wegweisung zur Verbundenheit mit Gott und den Mitmenschen, zur Bekräftigung aller vorausgehenden Offenbarungen und in der zuversichtlichen Erwartung einer endgültig geretteten Gemeinschaft, die die Grenzen der irdischen Existenz übersteigt. Vergangenheit und Zukunft, die diesseitige und die jenseitige Welt werden hier zusammengeschlossen, damit das Leben gelinge. Muss dann nicht jede Lektüre, die sich nicht vorbehaltlos auf diesen Anspruch des Buchs einlässt, dessen Bedeutung von vornherein verfehlen, sei sie auch noch so gut gemeint?
Wenn der Koran sagt, dass er eine Schrift sei,
die nur die Gereinigten berühren, (56,79)
dann verpflichtet er seine Leser zu einer besonders geläuterten Haltung: Sie können das Wort nicht in rechter Weise aufnehmen, wenn sie nicht von allem freikommen, was ihm entgegensteht. Die im Islam traditionelle Praxis ritueller Waschungen kann dafür nur ein äußerliches Zeichen sein; denn der im hier gemeinten Sinn „reinigt“, ist Gott selbst. Von ihm muss sich läutern lassen, wer der Schrift würdig sein will.12
Der Koran vermerkt bei seinen Adressaten eine Reihe unterschiedlicher Reaktionen; aber sie stehen für ihn alle in der Alternative von Zustimmung oder Ablehnung. Dem Aufruf:
So fürchtet Gott, so viel ihr könnt, hört, gehorcht und spendet Gutes für euch selbst! (64,16),
fügen sich ganz diejenigen, die aufrichtig sagen können:
„Wir hören und gehorchen. …“ (2,28513)
Ihnen gegenüber sieht der Koran die anderen, die abweisend reagieren. Schon in früheren Zeiten
warf ein Teil derer, denen die Schrift gegeben worden war, Gottes Schrift hinter sich, als ob sie nicht Bescheid wüssten. (2,101)
Ihnen scheint die Botschaft einfach bedeutungslos zu sein. Darüber hinaus zitiert der Koran aber auch die Rede derer, die sich zwar als aufmerksam ausgeben, aber entweder einfach ihr Leben nicht danach ausrichten –
die sagen:
„Wir hören“,
und doch nicht hören (8,21)
– oder sogar die vernommene Rede ausdrücklich ablehnen:
„Wir hören, widersetzen uns aber.“ (2,93; 4,46)
Diese Menschen beharren in der entschiedensten Position des Widerspruchs. Dazwischen steht noch die Gruppe derer, die sich der Konfrontation entziehen wollen, sich aber vorwurfsvoll fragen lassen müssen:
Glaubt ihr denn einiges aus der Schrift und anderes nicht? (2,85)
Vielleicht richtete sich diese Frage ursprünglich an die Juden von Medina, die nach dem Urteil des Koran schon mit dem Wort Gottes in ihrer eigenen Bibel so verfahren; aber die Kritik muss sich nicht auf die Juden beschränken. Immer gibt es Hörer, die nach ihrem Belieben auswählen und sich nur von einem Teil betreffen lassen wollen. Damit aber verfehlen sie alle den Anspruch dessen, was ihnen hier gesagt wird.
Ist also der Koran nicht durch und durch so auf Entscheidung ausgerichtet, dass man ihn in seinem Sinn nur auf eine einzige Weise richtig aufnehmen kann: in fügsamer Anerkennung? Ist nicht jede andere Lektüre, ob sie will oder nicht, ein Ausdruck von Widerspruch und Verweigerung? Dies legt auch die Fortsetzung der zitierten Eingangsverse der zweiten Sure nahe, die keine andere Alternative zur gläubigen Annahme der Botschaft kennt als deren entschiedene Zurückweisung und zu dem harten Urteil kommt:
Denen, die ungläubig sind, ist es gleich, ob du sie warnst oder nicht. Sie glauben nicht.
Gott hat ihnen Herz und Gehör versiegelt und über ihrem Blick liegt eine Hülle. Sie bekommen mächtige Strafe.
Manche Menschen sagen:
„Wir glauben an Gott und den Jüngsten Tag.“
Sie glauben aber nicht.
Sie wollen Gott betrügen und die, die glauben, betrügen aber nur sich selbst,
ohne es zu merken.
In ihrem Herzen ist Krankheit, und Gott mehrt sie noch. Sie bekommen
schmerzhafte Strafe, weil sie stets gelogen haben. (2,6–10)