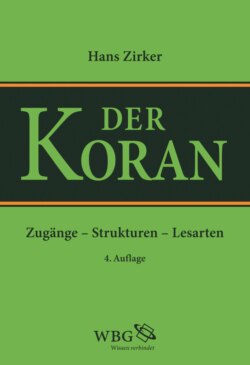Читать книгу Der Koran - Hans Zirker - Страница 19
a. Das christliche Schweigen gegenüber dem Koran
ОглавлениеWer den Koran zitiert, weiß ihn mit diesem Namen eindeutig zu benennen, ob als Muslim oder Christ. Aber während der Muslim aus seinem Glauben heraus auch leicht sagen kann, was er zur Sprache bringt, nämlich Gottes Wort, gerät der Christ an diesem Punkt in ein Dilemma. Kann er einfach sagen, dass der Koran nichts anderes sei als Mohammeds eigene Rede? Damit widerspricht er nicht nur der islamischen Überzeugung, die nun einmal nicht die seine ist, sondern auch den Aussagen und der Sprachgestalt dieses Buchs selbst, in dem formal Gott Mohammed anspricht:
Wir haben den Koran nicht auf dich hinabgesandt, damit du trostlos seist, sondern als erinnernde Mahnung für den, der sich fürchtet,
als Herabsendung von dem, der die Erde und die erhabenen Himmel erschaffen hat. (20,2–4)
Wer sich dieser Aussage und ihrer Perspektive nicht anschließen kann, steht vor der Frage, welche Rolle für ihn dann Mohammed als Verkünder dieser Texte spiele. Im Koran schon kommen an zahlreichen Stellen diejenigen vor, die sich empört abwenden:
„Wirre Träume! Aber nein, er hat es sich ausgedacht. Aber nein, er ist ein Dichter. …“ (21,571)
„Das ist nur Lüge, die er sich ausgedacht hat und bei der ihm andere geholfen haben.“ (25,472)
Dies war auch die Tonlage der alten christlichen Polemik, die in vielem nicht mehr nachvollziehbar ist. Aber welche Möglichkeiten sollte es für den geben, der das Buch respektvoller aufnehmen will – möglicherweise gar in theologischer Wertschätzung –, ohne dass er sich damit schon dem muslimischen Bekenntnis anschlösse?
Die bescheidenste und zugleich verlegenste Form des Respekts finden wir etwa in den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils: Die 1965 verabschiedete „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen (Nostra aetate)“73 beginnt ihren Abschnitt über den Islam mit den Worten: „Mit großer Hochachtung gedenken wir der Muslime“ (Artikel 3), und ist in ihren weiteren Aussagen sichtlich bemüht, diese Einstellung zu bekräftigen, bezieht sich aber nirgendwo, und sei es auch noch so zurückhaltend, auf den Koran. Welches Gewicht dieses Schweigen hat, wird deutlich, wenn wir den Konzilstext in seinem größeren Zusammenhang prüfen.
Im vorausgehenden zweiten Artikel ist von allen Religionen die Rede, die den Menschen „Wege weisen: Lehren und Lebensregeln sowie auch heilige Riten“. Ohne Zweifel muss man dabei auch an den Koran denken, gemäß seinem Anspruch und seinem Inhalt:
Das sind die Zeichen des Koran und einer deutlichen Schrift,
Führung und frohe Botschaft für die Gläubigen,
die das Gebet verrichten, die Abgabe leisten und dabei vom Jenseitig-Letzten
überzeugt sind. (27,1–3)
In allgemeiner Würdigung religiöser Lebensäußerungen erklärt das Konzil: „Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist“ (Artikel 2) und fügt in vorsichtiger Formulierung hinzu, dass „jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren … zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet“ (Artikel 2). Bei solch behutsamer Annäherung ist kein Grund absehbar, dass man diese anerkennenden Worte nicht auch auf den Koran beziehen sollte, zumal ein weiteres Moment hinzukommt, das seine Erwähnung noch dringlicher nahelegt:
Das Konzil spricht davon, dass die Muslime „den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat …“ (Artikel 3). Damit wird ihr Glaube nicht nur in einem allgemeinen Sinn als monotheistisches Bekenntnis gewürdigt, sondern im Besonderen als Antwort auf Gottes Offenbarung. Diese Äußerung des Konzils ist selbstverständlich keine distanzierte religionswissenschaftliche Feststellung; sie bedeutet vielmehr theologische Anerkennung.
Offenbarung aber hat aus christlicher wie aus muslimischer Sicht ihre geschichtlichen Orte, ihre konkreten Mittler und Adressaten. Darüber schweigt der Konzilstext an dieser Stelle. Dass Gott „zu den Menschen gesprochen hat“, bleibt auffallend beziehungslos.
Wenig später werden Namen erwähnt, die für Offenbarungsmittler hätten stehen können – zunächst nur im Nebensatz: Muslime stellen sich Gott anheim, „so wie Abraham sich Gott unterworfen hat“; dann in einer selbständigen Aussage: „Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten“. Damit erhält der muslimische Offenbarungsglaube nachträglich und beiläufig zwei geschichtliche Bezugspunkte. Aber die Namen Koran und Mohammed fehlen.
Diesen Sachverhalt zu verstehen, gibt es genau drei Möglichkeiten (auch wenn die erste so naheliegt und plausibel ist, dass die beiden anderen meistens schon gar nicht mehr beachtet werden):
Erstens könnte das Konzil den muslimischen Glauben an die Offenbarung Gottes nur insoweit anerkennen wollen, als er dem biblischen Glauben entspricht im Blick auf Abraham, Mose usw. bis hin zu Jesus – doch keinesfalls hinsichtlich der Verkündigung des Koran durch Mohammed. Dass dies im Text nicht ausgesprochen wird, wäre dann allein in der Absicht begründet, vor allem das Gemeinsame hervorzuheben. Das Schweigen wäre demnach weniger Ausdruck einer theologischen Verlegenheit als einer taktischen. Aber auch diese wäre schwerwiegend: Man wollte einerseits den muslimischen Glauben „mit Hochachtung“ würdigen und wiese anderseits doch die zweite Hälfte seines Bekenntnisses – der Schahada: „Kein Gott ist außer Gott, und Mohammed ist sein Gesandter“ – wortlos zurück.
Für Muslime könnte dies kaum mehr sein als eine oberflächliche Kaschierung der alten Kluft. Vor allem stünde so die Frage mit umso kräftigerer Unsicherheit an: Was, wenn nicht Gesandter Gottes, ist dann für Christen Mohammed und was der Koran?
Bei der zweiten Möglichkeit, den Konzilstext zu verstehen (welche Absicht die einzelnen Konzilsväter für sich auch immer gehabt haben mögen), wäre der Koran nicht aus den legitimen Offenbarungszeugnissen ausgeschlossen, könnte vielmehr grundsätzlich auch als „Gottes Wort“ gelten. Dass dies im Text nicht gesagt wird, hätte dann seinen Grund in der Schwierigkeit, dies mit der kirchlichen Lehrtradition zu vermitteln und der kirchlichen Öffentlichkeit zuzumuten. Auch in diesem Fall wäre das Schweigen also taktisch bedingt.
Drittens könnte sich das Konzil schlicht nicht in der Lage gesehen haben, überhaupt etwas über den Koran und seinen Verkünder zu sagen, sei es aus prinzipieller Unzuständigkeit oder aus einer vorläufigen, bei der man sagen könnte: „Die Zeit ist dafür noch nicht reif.“ Im einen wie im andern Fall wollte die Kirche eine Offenbarung Gottes durch den Koran auch nicht verneinen; sie hielte sich nur nicht für befähigt, darüber zu befinden.
Allein das Nebeneinander dieser drei Weisen, den Konzilstext zu lesen, von denen jede ihre eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt, unterstreicht schon, welche Irritation der Koran für die Kirche und die christliche Theologie darstellt. Aus dieser Vieldeutigkeit ergibt sich aber auch über das Konzil hinaus eine labile Situation. Zu Recht schrieb der ägyptische christliche Theologe, Islamwissenschaftler und Konzilsberater Georges C. Anawati über das Schweigen der Kirche zur Bedeutung Mohammeds: „Ist der Dialog einmal in Gang gekommen, so wird man gezwungen sein, dieses Hauptstück genauer darzustellen.“74 Wenn dann die christliche Seite die erklärte „Hochachtung“ gegenüber dem muslimischen Glauben walten lassen will (und dies nicht nur im „Dialog“, sondern auch in der eigenen Theologie), wird sie die naheliegende erste Interpretationsmöglichkeit nicht vertreten können, ohne wenigstens auch die fragwürdigen Momente dieser Position einzugestehen. Dann aber bleiben auch die beiden anderen Möglichkeiten weiter mit im Experiment der Verständigung. Dieses ist in erster Linie eine Sache der Bewusstseinsbildung, nicht der theologischen Wissenschaft, auch wenn es um Überzeugungen im Raum der Kirche geht.
Zum christlichen Schweigen gegenüber dem Koran gehört jedoch auch, dass dieses Buch in den Gemeinden durchweg nicht zur Sprache gebracht und gehört wird. Dazu besteht vordergründig auch kein Anlass, haben sich die Christen in ihren Gottesdiensten doch auf ihren eigenen Glauben zu besinnen. Doch anderseits können sie sich den religiös-pluralen Verhältnissen unserer Gesellschaft und den sich daraus ergebenden interreligiösen Aufgaben zunehmend weniger verschließen. Viel ist die Rede von den Konsequenzen, die sich aus den Nachbarschaften von Kirche und Moschee ergeben sollten. In kritischen Situationen wie etwa zur Zeit des ersten Golfkrieges oder als in unserem Land Häuser von Türken brannten, luden da und dort Muslime und Christen zu gemeinsamer Besinnung oder gar gemeinsamem Gebet ein. Dabei las man wie aus der Bibel auch aus dem Koran. Doch das allgemeine christliche Bewusstsein wurde davon wenig berührt. Die Überlegung, ob und wie auch Christen zum Glaubensbuch der Muslime einen Zugang finden können und welche Bedeutung es dabei für sie bekommen mag, wird innerkirchlich bis heute zumeist besonderen Bildungsveranstaltungen überlassen. Mit dieser Intellektualisierung aber bleibt das Problem am Rand des kirchlichen Lebens.
Vielleicht mag jemand meinen, dass man in solche Komplikationen des Koranverständnisses nur komme, wenn man diesem Buch mit Glaubensvoraussetzungen begegne und sich nicht auf nüchtern sachliche religions- und literaturwissenschaftliche Kenntnisnahme beschränke. Aber dabei übersähe man, dass die Frage, wie sich Mohammed in seinem prophetischen Anspruch begreifen lasse, immer wieder auch in die nichttheologische Islamwissenschaft einzieht und diese an die Grenzen ihrer Methoden führt, gelegentlich auch darüber hinaus.