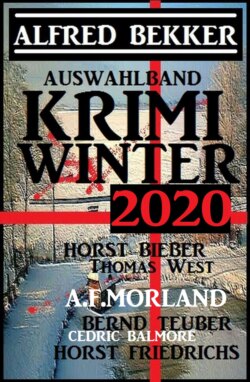Читать книгу Auswahlband Krimi Winter 2020 - A. F. Morland - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bernd Teuber: Totentanz für einen Killer
ОглавлениеRANOK 3 –
von
IMPRESSUM
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© Roman by Author/ Titelbild: Nach Motiven von Pixabay, 2018
© dieser Ausgabe 2018 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
www.AlfredBekker.de
postmaster@alfredbekker.de
Auftragskiller Ranok wird wegen mehrfachen Mordes zu drei Mal Lebenslänglich verurteilt. Doch er hat nicht vor, lange hinter Gittern zu bleiben und sich von der Brutalität der Wärter zermürben zu lassen. Systematisch plant er seinen Ausbruch.
Bernd Teuber legt hier nun den dritten Band der Saga um RANOK vor. Weitere Romane sind in Vorbereitung.
Ein greller Blitz zuckte über den Himmel. Gleich darauf grollte der Donner. Sintflutartig stürzten die Wassermassen herab. Außerhalb der Gefängnismauern der Fishkill Justizvollzugsanstalt wütete ein Sturm. Und drinnen stürmte Geflüster von Zelle zu Zelle. Die Insassen fürchteten eine andere Art von Sturm, der gerade aufzog.
Auslöser war der Gefangene mit der Nummer 26378. Steve Talbot lächelte, während er vor dem Wärter herging. Im Zellentrakt herrschte plötzlich eine ungewohnte Stille. Jedes einzelne Geräusch war weithin und überdeutlich hörbar. Die Schritte des Wärters und Talbots eigene dröhnten durch die Gänge. Sie passierten die Schleuse, die das Hauptgebäude von dem Zellentrakt trennte. Ein Mann saß in der Glaskabine.
Vor ihm befand sich ein Pult mit zahlreichen Schaltern und Knöpfen. Das Innere der Kabine lag im Dunkeln. Der Wärter war nur schemenhaft im Widerschein der Kontrolllampen zu erkennen. Plötzlich flammte ein Scheinwerfer auf. Geblendet schloss Talbot die Augen. Dann verlöschte das Licht wieder. Es war ein automatischer Scheinwerfer gewesen – eine der neuen Sicherungseinrichtungen, die jeden Versuch eines Gefangenen, sich unbemerkt der Kabine zu nähern, zum Scheitern verurteilte.
Das letzte Gittertor zwischen dem Hauptgebäude und dem Zellentrakt lag vor ihnen. Der Wärter gab dem Mann in der Kabine ein Zeichen, worauf dieser einen Knopf an seinem Pult drückte. Das Gitter glitt zur Seite. Talbot ging hindurch. Sein Begleiter folgte ihm. Nachdem sie das Tor passiert hatten, schloss es sich wieder.
Wie regungslose Statuen standen die Gefangenen im Halbdunkel ihrer Zellen und beobachteten jede Bewegung des Neuzugangs. Im Aufnahmezentrum hatte man Talbot seine wenigen Habseligkeiten abgenommen. Danach wurde er gründlich untersucht und ausgequetscht, allerdings ohne den hohntriefenden Sadismus, mit dem sich die Polizisten bei seiner Verhaftung ausgezeichnet hatten. Anschließend musste er die Gegenstände in Empfang nehmen, die ihn für den Rest seines Lebens von Zelle zu Zelle begleiten würden.
Talbot wurde im Block C untergebracht. Seine Zelle war die fünfte in einer Reihe von dreißig Zellen, deren Stahlgittertüren automatisch geöffnet und geschlossen werden konnten. Talbot musste sich die Zelle mit einem weiteren Häftling teilen. Er war ein großer, dünner Kerl, der aus dem Fenster starrte und die Gitterstäbe umklammerte. Als Talbot eintrat, wandte er den Kopf, musterte den Mann desinteressiert und widmete sich dann wieder den Blitzen, die über den Himmel zuckten.
„Was ist mit meinem Abendessen?“ wollte Talbot wissen.
„Essenszeit ist vorbei“, erklärte der Wärter barsch.
Dann verschwand er. Talbot verteilte seinen Besitz auf die dafür vorgesehenen Regale und Ablagen. An der linken Wand stand ein Etagenbett. Talbot warf das Laken über die dünne Matratze im unteren und hob deren Ecken etwas an, um die Enden darunterzustopfen. Nach dem er fertig war, ließ er sich auf das Bett fallen. Gelangweilt betrachtete er sein neues Domizil. Die Zelle war nicht gerade luxuriös eingerichtet. Die Toilette hatte nicht mal einen Deckel. Der saure Gestank von Desinfektionsmitteln verdarb Talbot den Appetit. Doch er wollte sowieso nicht allzu lange hier bleiben.
Die „Fishkill Justizvollzugsanstalt“ in Dutchess County im US-Bundesstaat New York war ein Gefängnis der mittleren Sicherheitsstufe und auf die Unterbringung von 1800 Häftlingen ausgerichtet. Bei den Insassen handelte es sich hauptsächlich um Gewaltverbrecher. Nur ein geringer Teil war wegen Straftaten in Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden.
Die Verfassung garantierte jedem Amerikaner ein schnelles Verfahren sowie das Recht, von einem Geschworenengericht gehört zu werden. Soweit die Theorie. Die Praxis sah anders aus. Die New Yorker Gerichte hatten gar nicht die Kapazitäten, um pro Jahr so viele Tausend Fälle zu verhandeln. Deshalb wurde sich meistens außergerichtlich auf einen Vergleich geeinigt.
Man bedrängte die Untersuchungshäftlinge so lange, bis sie sich schuldig bekannten. Viele Häftlinge fanden sich damit ab, ihre Zeit abzusitzen, wenn sich die Gefängnistore hinter ihnen geschlossen hatten. Doch Talbot sann vom ersten Augenblick an auf Flucht. Er hasste es, eingesperrt zu sein, und war bereit, für die Freiheit alles zu tun.
Hinzu kam, dass er nichts mehr zu verlieren hatte. Sein Urteilsspruch lautete drei Mal lebenslänglich wegen zwölffachen Mordes. Talbot hatte jahrelang als Profikiller gearbeitet. Ein Menschenleben bedeutete ihm gar nichts. Eiskalt tötete er – ohne die geringsten Gewissensbisse. Er bereute nichts von alledem – außer einem, dass man ihn erwischt hatte. Deshalb musste er einen Weg finden, um aus Fiskill herauszukommen. Sobald das Gefängnis hinter ihm lag, wollte er sich an dem Mann rächen, der ihn verraten hatte.
Er wusste allerdings, dass eine Flucht nicht so einfach sein würde, andererseits dürfte es auch keine großen Probleme geben. Im Grunde genommen verdankte er es nur einem glücklichen Umstand, dass man ihn hier eingesperrt hatte und nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ursprünglich sollte er seine Haftstrafe im Clinton Correctional Facility nahe der kanadischen Grenze verbüßen. Wegen der hohen, langen Gefängnismauer an einer der Hauptstraßen des Ortes und seiner Lage im nördlichen Teil der USA trug es den Beinamen „Little Sibiria“.
Erst im letzten Moment wurde die Entscheidung über seine Unterbringung geändert, weil es in Clinton keinen freien Platz mehr gab. Das Gefängnis war hoffnungslos überfüllt. Nur deswegen hatte man ihn nach Fishkill verlegt. Hier waren die Sicherheitsvorkehrungen nicht so hoch. Früher oder später würde er eine Schwachstelle finden, die ihm eine Flucht ermöglichte.
„Steh auf“, sagte der dünne Mann am Fenster.
Talbot antwortete nicht. Er drehte sein Gesicht zur Wand und versuchte, zu schlafen. Doch seinem Zellengenossen schien das nicht zu passen.
„Ich sagte, du sollst aufstehen.“
Seine Stimme klang müde und hatte einen leichten Akzent. Talbot blickte ihn kurz an, zuckte mit den Schultern und legte sich wieder hin. Der Mann am Fenster starrte weiterhin durch die Gitterstäbe. Die Lampe unter der Decke leuchtete auf. Erst jetzt wandte sich der Dünne gemächlich um und kam auf Talbot zu. Seine fettigen Haarsträhnen glänzten im schwachen Lampenlicht.
„He, du da unten“, sagte er. „Spiel bloß nicht den Eingebildeten, du Arschloch. Hier kann man ganz schnell unter die Räder kommen. Aber für zehn Scheine die Woche und deinen ganzen Nachtisch halte ich dich aus dem Schussfeld raus.“
Talbot reagierte nicht.
„Mein Name ist Chris Harper. Ich habe in diesem Schuppen was zu sagen“, fuhr sein Mitgefangener fort. „Also sei klug. Verhalte dich ruhig und ich beschütze dich, kapiert?“
Doch Talbot reagierte immer noch nicht.
„He, bist du tot?“ fragte Harper, während er nach Talbots linkem Handgelenk griff. „Ich schlage dir die Zähne aus der Schnauze, wenn du nicht antwortest.“
Er packte Talbots Daumen und bog ihn nach hinten. Fragend sah er ihn an. Als Talbot sich nicht rührte, bog er den Daumen noch ein Stück zurück. Die beiden Männer sahen sich in die Augen. Nach ein paar Sekunden ließ er Talbots Daumen los.
„Na, antwortest du immer noch nicht?“ wollte er wissen.
„Doch.“
Talbot sprang vom Bett, packte den Mann am Handgelenk, rammte ihm das Knie in den Magen und schlug seinen Kopf gegen die Zellenwand. Harper stieß einen lauten Schrei aus. Doch er gab nicht auf, sondern trat um sich. Talbot packte ihn an den Ohren und schmetterte seinen Kopf abermals gegen die Wand. Harper versuchte, sich mit wilden Zuckungen aus dem Griff zu befreien. Seine Augen flackerten. Speichel rann aus seinem Mund.
Talbot verpasste ihm einen gezielten Schlag an die Schläfe. Harper rutschte an der Wand nach unten. Während er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden herumwälzte, ging Talbot zum Fenster und beobachtete die Blitze, die über den Himmel zuckten.
Im Gang hallten Schritte. Talbot wandte sich kurz um und beugte sich zu dem Mann hinunter.
„Wenn du den Wärtern auch nur ein Wort erzählst, schlag ich dich tot. Kapiert?“
„Ja … ja ...“, stammelte er.
„Gut.“
Die Schritte kamen näher. Talbot setzte sich aufs Bett und machte ein unbeteiligtes Gesicht. Sekunden später wurde die Zellentür geöffnet.
„Häftling 26378! Los, rüber an die Wand!“ rief der Wärter. „Mit dem Gesicht zum Fenster!“
Talbot tat ihm den Gefallen. Der Wärter betrat in die Zelle. Sein Kollege stand in der Tür, einen Schlagstock unter den Arm geklemmt. Talbot hörte, wie man Harper herumdrehte. Der Wärter stellte ihm einige Fragen, doch anstatt zu antworten, stöhnte er nur.
„Los, umdrehen!“ befahl der Wärter.
Talbot folgte der Anweisung und sah, wie sich Harper auf dem Boden wand.
„Was ist passiert?“ wollte der Uniformierte wissen.
„Er ist hingefallen“, antwortete Talbot.
„Ich verstehe das nicht“, sagte der Wärter. Er schien mehr verwirrt, als verärgert zu sein. „Jetzt ist der Kerl schon seit zwei Wochen hier. Und er hat nie mehr Schwierigkeiten gemacht, als ein dreijähriges Waisenkind. Und zehn Minuten, nachdem Sie hier hereinspaziert sind, ist er ein Krüppel.“
Als Talbot nichts sagte, marschierte der Wärter aus der Zelle und schloss die Tür hinter sich. Sein Kollege mit dem Schlagstock blieb stehen und beobachtete Talbot mit wachsamen Augen. Nach einigen Minuten erschienen zwei Männer mit einer Bahre und brachten den stöhnenden Harper hinaus. Talbot warf sich auf das untere Bett und drehte sich auf die Seite. Durch das vergitterte Fenster drang ein undefinierbares Summen. Er versuchte, einzuschlafen, doch es gelang ihm nicht.
Die Ereignisse der vergangenen Monate drangen immer wieder in sein Bewusstsein. Und wenn es ihm doch gelang, wenigstens in eine Art Halbschlaf zu versinken, tauchten kurz darauf Polizisten vor ihm auf, um ihn mit ihren Gewehren in Stücke zu schießen.
Das Licht wurde gelöscht. In der Zelle war es nahezu dunkel. Talbot wälzte sich auf den Rücken und starrte die Gitterstäbe an, die sich schwarz gegen den sonderbar grauen Himmel abhob. Der Smog, dachte er müde. Ein Scheinwerfer nahm seine Arbeit auf und beschrieb einen langsamen Kreis. Er begann im Norden, schwenkte nach Osten und kam zum Fenster herüber.
Talbot kniff die Augen zusammen, um nicht geblendet zu werden, wenn der Lichtkegel die vergitterte Öffnung erfasste. Er wollte die Augen zusammenkneifen; aber dann ließ er es sein. Er drehte sich auf die linke Seite und betrachtete die Wand. Im Licht des Scheinwerfers konnte er einige obszöne Schmierereien erkennen. Irgendjemand hatte in zittrigen Buchstaben Fuck you daran geschrieben.
In der Nacht erwachte Talbot plötzlich.
Er hatte einen Alptraum gehabt, in dem eine Tür aufging und zuschlug. Immer und immer wieder, mit entnervender Unregelmäßigkeit. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Es war dunkel, und aus den anderen Zellen konnte er die verschiedensten Geräusche hören. Einer schnarchte. Einer schrie im Schlaf. Einer hustete.
Plötzlich vernahm er etwas, das nicht dazugehörte. Ein Geräusch, das nur entstehen konnte, wenn man wach und bei vollem Bewusstsein war. Jemand klopfte, rhythmisch, in bestimmten Abständen. Jemand sandte einen Code, verständigte sich mit jemand anderem. Einen Moment lang verwarf Talbot die Idee eines Codes wieder. Vielleicht waren die Klopfgeräusche gar nicht als Zeichen gedacht, sondern unvermeidlicher Lärm beim Durchbohren einer Mauer.
Vielleicht wurde einige Zellen weiter ein Ausbruchsversuch unternommen. Aber das wäre Irrsinn gewesen. Niemand konnte aus einem modernen Gefängnis ausbrechen, indem er einen Tunnel grub und so in die Freiheit gelangte. Auf einmal ertönten irgendwo Schritte. Die Nachtwärter machten zu zweit ihre Runde. Sofort hörte das Klopfen auf. Die Wärter schritten die Zellen ab, verließen den Gang am anderen Ende und schlossen die Tür hinter sich.
Wenig später setzten die Klopfgeräusche wieder ein. Es musste doch ein Code sein. Ein paar Mal tauchte ein Schlagmuster auf, das Talbot mit etwas Fantasie als F-L-U-C-H-T-P-L-A-N entzifferte, aber alles andere war unverständlich. Talbot schlief wieder ein.
Nach dem Wecken, als die Wärter wie jeden Morgen die Lebendkontrolle durchführten, blieb einer von ihnen vor Talbots Zelle stehen. Er war sehr groß und schlank. Sein Gesicht hatte eine rote Färbung, als ob er an zu hohem Blutdruck leiden würde. Seine Augen blickten wässrig. Vielleicht hatte er am frühen Morgen schon ein paar Bier getrunken.
„Häftling 26378?“ fragte er scharf.
„Ja“, antwortete Talbot.
„Zufrieden mit deiner neuen Behausung?“
„Ja.“
„Gut geschlafen?“
Sein siebter Sinn, der Talbot bei solchen Gelegenheiten nie zu trügen schien, signalisierte ihm plötzlich Gefahr. Er sah den Wärter an und bemerkte, dass das Gesicht des Mannes nicht den Ausdruck freundlichen Interesses zeigte, sondern kalt wirkte. Der Schlagstock wippte in der Hand auf und nieder.
„Danke, ja“, sagte Talbot.
Er hütete sich davor, sein Gegenüber zu reizen. Der Wärter sah ohnehin aus, als hätte er größte Lust, Talbot eine Abreibung zu verpassen.
„Nicht gestört worden?“
Kein Zucken verriet Talbots Überraschung. Seine Miene blieb gleichgültig wie zuvor.
„Ich habe einen guten Schlaf“, erklärte er, fügte aber dann noch hinzu: „Wenn Vollmond ist, wachsen mir Krallen und Haare. Das ist ein wenig schmerzhaft. Aber gestern war ja keiner ...“
Mit zwei Schritten war der Wärter bei ihm, stieß ihn gegen die Zellenwand und presste ihm den Schlagstock gegen die Kehle.
„Deine blöden Witze werden dir noch vergehen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich persönlich werde sie dir austreiben.“
„Dazu gehören immer zwei“, erwiderte Talbot.
Er wusste, dass es ein Fehler war, den Wärter zu reizen, aber er wollte sich auch nichts gefallen lassen. Von niemandem. Der Wärter schwieg einige Sekunden, dann versetzte er Talbot einen brutalen Schlag mit dem Knüppel in die Seite. Der Killer stürzte auf das Bett, verlor das Gleichgewicht und rutschte auf den Boden.
Der Wärter stand breitbeinig über ihm. Sein Gesicht war jetzt dunkelrot. Er schwitzte. Die Augen waren schmal geworden und hatten sich fast völlig in die Höhlen zurückgezogen. Wütend ließ er den Schlagstock in seiner Hand auf und ab wippen.
„Das dürfen Sie nicht!“ rief Talbot. Im selben Moment war ihm klar geworden, dass der Wärter krank sein musste. Der langjährige Dienst in Haftanstalten wie Fishkill hatte ihn fertiggemacht.
„Ich darf mehr, als du dir in deinen verrückten Träumen vorstellen kannst“, brüllte er.
Ein zischendes Geräusch ertönte, als er den Schlagstock durch die Luft sausen ließ. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit schoss der lange Knüppel auf Talbots Kopf zu, schien direkt aus den funkelnden Augen des Wärters zu kommen. Erst im letzten Moment konnte Talbot sich zur Seite werfen. Er hörte, wie der Schlagstock gegen das eiserne Bettgestell krachte. Wäre er nicht ausgewichen, hätte er wahrscheinlich einen Schädelbasisbruch erlitten.
Es gab ein metallisches Nachhallen, das verstärkt wurde, weil das Bett direkt an der Wand stand. Das Geräusch war sehr laut und sorgte dafür, dass der Wärter wieder zu sich fand. Jedenfalls schlug er nicht noch einmal nach Talbot. Schwer atmend schob er den Knüppel wieder in den Gürtel.
„Warum gebe ich mich eigentlich mit dir ab? Einmal kommt der Tag, da bist du sowieso dran. Polizistenmörder stehen auf meiner Liste ganz oben. Ich behalte dich im Auge. Denk dran, bevor du eine krumme Tour versuchst.“
Er stolperte aus der Zelle. Am Eingang wandte er sich kurz um.
„Noch was“, sagte er grinsend. „Hier in Fishkill herrscht Disziplin und Ordnung. Verstanden? Schlampereien werden nicht geduldet.“
Er deutete mit dem ausgestreckten Arm auf die zerwühlte Decke.
„Sehe ich noch einmal so ein unordentlich gemachtes Bett, wanderst du in Einzelhaft. Kapiert?“
Talbot nickte.
„Das will ich hoffen.“
Er wandte sich ab und ging. Talbot wusste, dass er Glück gehabt hatte. Verdammtes Glück. Aber dieser Wärter konnte ihm gefährlich werden.
Zwei Tage später wurde Chris Harper wieder in die Zelle zurückgebracht. Mit einem düsteren Blick ging er an Talbot vorbei zum Fenster. Der Killer saß erwartungsvoll auf dem unteren Bett, doch sein Mithäftling ignorierte ihn und starrte durch die Gitterstäbe.
„Wenn ich noch einmal was höre, kommt ihr beide in Einzelhaft“, drohte der Wärter, bevor er die Zellentür absperrte.
Niemand antwortete.
„Habt ihr verstanden?“ fragte er mit erhobener Stimme.
„Klar“, sagte Talbot und nickte. Besänftigt sperrte der Wärter die beiden Männer ein und ging wieder.
Ein Verband zierte Harpers Kopf und war ein deutliches Zeichen dafür, dass er eine ziemlich harte Bekanntschaft mit der Zellenwand gemacht hatte. Talbot beobachtete den Mann. Harper verließ das Fenster nur, wenn er pinkeln musste. Das geschah ziemlich häufig. Talbot fragte sich, ob er mit seinem Knie nicht vielleicht empfindlichere Teile als seinen Magen getroffen hatte.
Bevor die Lampe an der Decke aufflammte, lag am späten Nachmittag eine Zeitlang Dämmerlicht über der Zelle. Als es dunkel wurde, sah Talbot zum ersten Mal, dass Harper sich bewegte, ohne aufs Klo zu gehen. Ein Zucken lief durch seinen Körper. Er umklammerte die Gitterstäbe. Und seine rechte Hand zitterte unkontrolliert. Dann wandte er sich vom Fenster ab. Er hatte nur eine Braue, die quer über seine niedrige Stirn lief,
„Na, Arschloch!“ sagte Talbot leutselig. „Hast du noch was anderes auf Lager, als den Trick mit dem Daumen?“
Harper antwortete nicht. Doch er sah ganz so aus, als wolle er sich gleich etwas Besonderes einfallen lassen. Aber diesmal hatte Talbot nicht vor, seine sadistische Show abzuwarten. Er würde ihn rechtzeitig an einer besonders empfindlichen Stelle treffen. Während ihn abwartend ansah, sank Harper plötzlich auf die Knie. Seine Züge entgleisten und er begann, am ganzen Körper konvulsivisch zu zucken.
„Scheißkerl!“ keuchte er. „Du hast mir den Schädel gebrochen ...“
„Selbst schuld. Wer wollte denn hier unbedingt den großen Boss mimen?“
Er presste die Hände an den Kopf, spreizte die Finger, stöhnte und heulte. Talbot beachtete ihn gar nicht.
„Du wirst es noch bereuen, dass du dich mit mir angelegt hast“, sagte Harper.
„Ach ja?“
„Ja. Ich stehe unter den Schutz von Fabio Palvetti. Der wird dir dafür den Arsch aufreißen.“
„Palvetti?“ wiederholte Talbot. „Sollte mir dieser Name irgendetwas sagen?“
„Er ist der Boss hier drin. Er bestimmt die Regeln. Wer ihn zum Feind hat, der lebt nicht mehr lange.“
„Aha.“
„Du solltest mir ein wenig Respekt entgegen bringen.“
„Und wenn nicht?“
„Du scheinst mich nicht zu verstehen“ flüsterte Harper. „In diesem Knast ist es besser, sich auf eine Seite zu schlagen. Einzelgänger haben keine große Überlebenschance.“
Talbot zeigte sich nicht im Mindesten beeindruckt. In jedem Gefängnis gab es jemanden, der sich als absoluter Herrscher aufspielte. Meistens sorgten diese Kerle aber auch dafür, dass es eine gewisse Ordnung gab. Natürlich war es keine gesetzliche Ordnung. Es war die Ordnung, die ihnen in den Kram passte.
Sie machten ihre eigenen Gesetze und diktierten sie. Wer sich an diese Ordnung hielt, hatte nichts zu befürchten. Die anderen wurden systematisch fertiggemacht oder landeten irgendwann auf dem Friedhof. Diese selbsternannten Herrscher verbreiteten Terror, Angst und Schrecken. Entweder war man für sie oder man ging zugrunde.
Talbot blickte zu Harper hinüber. Sein Gesicht war schweißüberströmt. Eine seltsame Unruhe ergriff von ihm Besitz. Er schien irgendwie unter Strom zu stehen. Seine Schultern fingen an zu zittern. Warum? Was rief diese merkwürdige Unruhe in ihm hervor? Irgendetwas schien mit ihm zu passieren.
Ein lautes, gequältes Schluchzen entrang sich seiner Kehle. Er stützte sich wimmernd an die Wand und trommelte mit den Fäusten dagegen. Schließlich ging der Krampf vorüber. Er machte sich am Fußende seines Bettes zu schaffen. Dort gab es eine kleine Öffnung in der Matratze, die mit einem scharfen Gegenstand hineingeschnitten worden war.
Harper holte ein kleines Plastikröhrchen und einen Beutel mit einer weißen Substanz heraus. Talbot vermutete, dass es sich um Kokain handelte. Harper schüttete die Hälfte des Inhalts auf die Handfläche und zog ihn sich durch das Plastikröhrchen in die Nase. Aus glasigen Augen starrte er Talbot an. Das Zittern ließ nach. Er beruhigte sich allmählich. Sein Blick ging ins Nichts.
Na großartig, dachte Talbot. Jetzt haben die mich ernsthaft mit einer Koksnase in eine Zelle gesteckt.
Pünktlich um zwölf Uhr ertönte das Signal zum Mittagessen. Harper und Talbot stellten sich an der Gittertür auf und warteten, bis sie rasselnd zur Seite glitt. Mit den anderen Häftlingen gingen sie in den riesigen Speisesaal, der mit dröhnendem Lärm angefüllt war. Mit seinem Menütablett ließ sich Talbot an einem Tisch in der Mitte nieder. Er wusste, dass er demnächst jede Kraftreserve seines Körpers brauchen würde, aß doppelt so viel wie gewöhnlich, obwohl das Essen von den meisten Gefangenen als „Schweinefraß“ bezeichnet wurde.
„Schmeckt es?“, fragte sein Nachbar, der ihn von der Seite beobachtete. Er war ein schmaler Mann mit blonden Haaren und noch jugendlich weichen Gesichtszügen. Er sprach mit dem breiten Akzent des Südstaatlers. Alabama oder Georgia, vermutete Talbot.
„Es ist genießbar“, antwortete der Killer.
„Man sagt, der Koch würde regelmäßig reinspucken.“
„Aha.“
„Scheint dich nicht zu stören.“
Talbot schüttelte den Kopf.
„Andere auch nicht.“
Der junge Mann studierte die Menschenschlange, die sich an ihnen vorbei schob, fand offenbar nicht, was er suchte und drehte sich zu den langen Tischen auf der rechten Seite um.
„Da“, sagte er. „Siehst du den letzten Mann am anderen Ende des dritten Tisches?“
Talbot hob den Kopf. Der Kerl, den er meinte, war klein und dick, hatte eine Glatze und lächelte leicht. Er starrte zu den Behältern hinüber, in denen das Essen dampfte. Daneben stand eine Kiste, in die jeder Häftling das schmutzige Besteck warf, wenn er zu Ende gegessen hatte.
„Na und?“ fragte Talbot.
„Warte mal ab.“
Er aß weiter und beobachtete den Dicken. Plötzlich sprang er wie von der Tarantel gestochen auf, rannte zu einem der Behälter, tauchte die Arme bis zu den Ellbogen hinein und schlürfte den Kartoffelbrei aus den hohlen Händen.
„Scheiße!“ stöhnte Talbot.
Der Dicke schlürfte weiter, warf gehetzte Blicke auf die Wärter, bis endlich zwei angerannt kamen und ihn von dem Behälter wegzerrten.
Talbot war der Appetit vergangen. Er legte den Löffel beiseite und erhob sich, um das schmutzige Geschirr in die bereitgestellte Kiste zu legen. Genau in diesem Moment stieß er mit einem anderen Häftling zusammen. Der Mann war zwei Köpfe größer. Er hatte einen breiten Oberkörper, ein verstümmeltes Ohr, die Nase eines erfolglosen Boxers und Oberarme, die so dick waren wie ein Elefantenbein. Das Tablett mit dem Mittagessen rutschte ihm aus den Händen und landete auf dem Boden.
„Kannst du nicht besser aufpassen, blöder Wichser?“ schnauzte ihn der Muskelprotz an.
„Warum passt du nicht besser auf, wo du hingehst?“ fragte Talbot ruhig.
Jeder Mann im Speisesaal hatte inzwischen bemerkt, was vorging, und alle hielten unwillkürlich den Atem an.
„Los, heb‘s auf!“ forderte der Muskelprotz.
„Leck mich am Arsch, du fette Sau!“
„Was war das?“ fragte der Kerl verblüfft. „Hast du mich gerade eine fette Sau genannt?“
„Allerdings. Und du bist ein solcher Idiot, dass dein Gehirn bequem in einer Blattlaus Platz hätte. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es nicht hüpfen kann.“
Talbot wusste genau, was auf diese Worte folgen musste, und dass es verdammt hart werden würde. Aber nur so konnte er sich gegenüber den anderen Gefangenen ein für alle Mal Respekt verschaffen. Man musste schon verrückt oder lebensmüde sein, wenn man es wagte, solch einen Kerl dermaßen zu beleidigen.
Der Riese brauchte einige Zeit, bist er Talbots Worte verstanden hatte. Seine Augen blickten angestrengt und konzentriert. Dann wurden sie plötzlich leer und ein tierischer Schrei löste sich aus seiner Kehle. Talbot wusste, dass er dem Mann an Körperkraft unterlegen war. Allerdings hatte er auch nicht vor, sich auf einen fairen Kampf einzulassen. Er konnte es sich nicht leisten, von diesem Kerl zusammenschlagen zu werden.
Mit der Wucht eines olympiareifen Hammerwurfs kam die Faust des Mannes auf Talbots Gesicht zugeschossen. Der Killer trat einen Schritt zurück und wich durch eine leichte Drehung nach links aus. Von der Wucht seines Schlages nach vorn gerissen, geriet der Muskelprotz ins Taumeln und rannte in Talbots hochgerissenes Knie.
Aber der Kerl schien einen Unterleib aus Eisen zu haben. Jeden anderen Mann hätte der Stoß auf der Stelle umgehauen, jedoch nicht diesen Gegner. Er packte den Killer und schleuderte ihn durch den Raum. Als Talbot auf den Betonboden krachte, glaubte er, einen Augenblick die Besinnung zu verlieren. Halb im Unterbewusstsein hörte er die anderen Häftlinge johlen. Sie hatten einen Kreis gebildet, der es den Wärtern zunächst unmöglich machte, zum Kampfplatz vorzudringen.
Der Muskelprotz stand breitbeinig über ihm und grinste. Talbot kam mühsam wieder auf die Füße. Seit dem Wortwechsel waren nur wenige Sekunden vergangen, doch bis jetzt hatte noch keiner der Wärter in die Auseinandersetzung eingegriffen. Aus dem Stand hechtete Talbot vor und verkrallte sich mit beiden Händen in der Häftlingsjacke des Gegners. Scharf hörte er den Stoff zerreißen.
Erneut stieß er sein Knie hoch, prallte aber gegen die Kniescheibe des anderen. Ein heftiger Schmerz zuckte durch sein Bein bis hinauf in die Leistengegend. Mit beiden Fäusten bearbeitete er Hals und Brust des Mannes. Dann spürte er, wie der Muskelprotz sein Bein hinter Talbots Kniekehlen hakte und ihn langsam aber sicher nach hinten drückte. Er verlor das Gleichgewicht.
Der Gegner fiel auf ihn und erdrückte ihn fast, während seine Hände nach oben wanderten und sich um seinen Hals schlossen. Talbot schlug zu. Mit beiden Händen traf er die Ohren des Muskelprotzes. Der Mann bäumte sich auf und schrie. Gleichzeitig lockerte er den Griff um Talbots Hals. Der Killer wollte aufstehen, doch plötzlich tauchten drei Paar Stiefel auf, und der Mann wurde von ihm heruntergerissen.
Die Wärter hatten sich einen Weg durch den Kreis der Zuschauer gebahnt und schlugen mit ihren Stöcken auf den Muskelberg ein. Talbots Kopf fiel zurück, als sich die Hände von seinem Hals lösten. Zu den Stiefeln gesellten sich andere, und jetzt wimmelte es von Wärtern, die den Muskelprotz festhielten, ihn hochrissen und immer wieder auf ihn einschlugen. Die anderen Häftlinge standen unbeteiligt dabei.
„Dieser Scheißkerl muss wahnsinnig geworden sein“, keuchte der große Mann. „Ohne Grund ist er plötzlich aufgesprungen und hat auf mich eingeschlagen.“
„Na klar, Coley“, entgegnete einer der Wärter. „Den Blödsinn kannst du deiner Großmutter erzählen.“
Talbot wollte aufstehen, doch er wurde mit einem schmerzhaften Griff in die Knie gezwungen und festgehalten. Ein Wärter packte seine Haare.
„Häftling 26378“, brüllte er schwer atmend. „Wenn du den Ehrgeiz hast, hier für Ärger zu sorgen, sag es lieber gleich, damit wir Bescheid wissen. Dann lassen wir dich die nächsten Jahre auf Knien durch die Zelle kriechen.“
Talbot und Coley wurden von den Wärtern aus dem Speisesaal gezerrt.
„Ihr seit in ernsthaften Schwierigkeiten“, sagte einer der Männer. „Die Sache nimmt jetzt den Dienstweg. Für euch wird es richtig hart. Ihr kommt zum Direktor. Ich kann mir denken, dass er sich liebend gern mit euch unterhalten wird.“
Er wandte sich an seinen Kollegen. „Ist schon jemand zum Boss unterwegs?“
„Ja, Lewis macht Meldung“, antwortete der Angesprochene.
„Okay, dann bin ich mal gespannt, was Anderson dazu sagen wird.“
Talbot stellte fest, dass er eine Kopfwunde hatte und blutete. Er wusste, dass er einen Fehler gemacht hatte. Wenn es in Gegenwart von Wärtern zu Unruhen kam, konnte sich das für die Karriere der entsprechenden Männer ausgesprochen nachteilig auswirken. Talbot würde dafür büßen müssen. Vier Wärter brachten ihn in den Krankenbereich. Er bekam eine Spritze, seine Wunde wurde mit Jod behandelt und anschließend verbunden. Nach der Behandlung wurde er zum Büro des Direktors gebracht.
Talbot musste mehr als zehn Minuten warten, bis sich die Tür öffnete und er in das geräumige Zimmer eintreten durfte. Greg Anderson thronte hinter einem massiven Schreibtisch aus Eichenholz. Er war mittelgroß und wirkte durchtrainiert. Sein Gesicht besaß ein scharfes Profil mit einer schmalen Nase und einem markanten Kinn.
Sein blondes Haar war kurz geschnitten. Anderson trug einen hellen Anzug, ein weißes Hemd und eine korrekt gebundene, dunkelblaue Krawatte. Seine Kleidung war keine billige Konfektionsware, sondern maßgeschneidert. Das sah man auf den ersten Blick.
Sein Grinsen zeigte deutlich, wie er die Situation genoss. Er lehnte sich nach vorn und griff mit den Händen quer über den Schreibtisch, als wollte er sich an der Vorderkante festhalten. Seine Augen leuchteten voller Triumph und Schadenfreude, und er fuhr sich mit der Zunge ein paar Mal über die Lippen. Er hatte ein puterrotes Gesicht vor lauter Vorfreude auf das, was jetzt kam, und der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Man sah ihm richtig an, wie er in Fahrt kam und Talbot verkrampfte unwillkürlich die Muskeln.
„Wie lange sind Sie jetzt bei uns?“ fragte Anderson.
„Drei Tage, 14 Stunden und 35 Minuten.“
Der Direktor lächelte jovial. „Sehr genau. Äußerst akkurat. Eigenschaften, die ich sehr schätze. Anders erreicht man nichts im Leben. Und wie gefällt es Ihnen bei uns?“
„Als wäre ich hier zu Hause“, antwortete Talbot.
Binnen weniger Sekunden hatte er sich ein genaues Bild von Anderson gemacht. Er war ein karrieresüchtiger, ehrgeiziger Mann, mit dem man gut auskam, wenn man rangmäßig eine Stufe über ihm stand. Den Gefangenen gegenüber spielte er sich gerne als großer Bruder auf.
„Ich bewundere Ihren Humor“, meinte er. „Galgenhumor, würde ich sagen. Warum haben Sie die Schlägerei angefangen?“
„Ich habe mich nur verteidigt.“
Anderson sprang auf, aber er war längst nicht so wütend, wie er es eigentlich hätte sein müssen. Er ging zu dem großen vergitterten Fenster, das ihm einen Ausblick auf den Innenhof gestattete. Mit dem Rücken zu Talbot stieß er einen leisen Seufzer aus.
„Der Bau dieser Vollzugsanstalt hat fast 20 Millionen Dollar gekostet“, sagte er nach einer Weile. „Diese Summe können Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich kann es auch nicht. Aber diese 20 Millionen wurden vom Staat ausgegeben, um die Öffentlichkeit, die normalen, ehrbaren Bürger vor Männern wie Ihnen zu beschützen. Vor 1800 straffällig gewordenen Kerlen, vor Mördern, politischen Wirrköpfen oder professionellen Killern. Und ich habe vom Staat den Auftrag, dafür zu sorgen, dass diese 20 Millionen nicht umsonst ausgegeben worden sind, etwa dadurch, dass plötzlich einige Gefangene das Weite suchen. Ich nehme an, Sie verstehen mich.“
„Sollte ich?“ erwiderte Talbot.
„Im allgemeinen Interesse bin ich gezwungen, eine strikte Disziplin durchzuführen und keinerlei Ungehorsam zu dulden. Nachlässigkeiten werden als Vergehen betrachtet. Jeder Ausbruchsversuch hat ernsthafte Konsequenzen. Diejenigen, die sich an die Regeln halten, werden von mir nichts zu befürchten haben und ebenso wenig von den Wärtern.“
Er wandte sich um und musterte Talbot eingehend.
„Die Disziplin muss aufrecht erhalten bleiben. Wenn sich gewisse Leute vorgenommen haben, ihren Kopf durchzusetzen, werde ich nicht zögern, von meinem Recht Gebrauch zu machen, diese Männer in Einzelhaft zu stecken.“
Mehrmals erhob er beim Sprechen die Stimme, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen oder um sich in einen überreizten Zustand zu versetzen und sich die Wut zu erhalten, die er offenbar für unentbehrlich hielt. Er wirkte grotesk. Sein Kopf bewegte sich hin und her wie bei einem Hampelmann.
Obwohl dieser Redeschwall schmerzhaft an seinen Nerven zerrte, hörte Talbot ungerührt zu. Gleichzeitig suchte er nach Motiven für diese rechthaberische Vermessenheit. Schließlich kam er zu der Überzeugung, dass Andersons Ansprache viele grundsätzliche Bestandteile einer universellen Geisteshaltung entlehnte.
Sie beinhaltete den mystischen Autoritätsglauben und die Angst, nicht ernst genommen zu werden. Daher rührte auch der bizarre Komplex, der ihn veranlasste, einen argwöhnischen und unruhigen Blick auf Talbots Gesicht zu werfen, so als fürchte er, dort ein Lächeln zu sehen. Er wusste natürlich, dass er es hier mit einem Mann zu tun hatte, dem ein Menschenleben nichts bedeutete. Er würde ihn bei der ersten Gelegenheit umbringen. Vielleicht war das der Grund für sein Verhalten.
Talbot hatte, als er ihn von Disziplin sprechen hörte, eine seltsame Verwirrung empfunden; als er ihn aber wie einen Hampelmann herumzappeln sah, war er beruhigt zu der Schlussfolgerung gekommen, dass dieser Mann mehr Angst hatte, als er sich anmerken ließ.
Wann würde Anderson die Maske fallen lassen und auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen kommen?
„Durch Ihr Verhalten haben Sie mir die Möglichkeit gegeben, Ihnen sämtliche Vergünstigungen zu streichen und Sie zusätzlich noch in Einzelhaft zu stecken“, fuhr Anderson fort. Sein Ton wurde ruhiger, fast feierlich, und einen Augenblick lang hoffte Talbot, vernünftige Worte zu hören.
„Ich habe aber auch die Möglichkeit, die ganze Sache zu vergessen. Mir persönlich wäre diese Lösung lieber. Dafür brauche ich aber ein paar Informationen, verstehen Sie?“
Talbot antwortete nicht.
Mit einer lässigen Handbewegung entfernte Anderson ein unsichtbares Staubkorn, von seinem Aufschlag, während ein unverbindliches Lächeln seine Lippen umspielte. Er neigte fast anmutig den Kopf zur Seite und musterte Talbot amüsiert.
„Ich weiß, dass ein Ausbruchsversuch geplant ist. Finden Sie heraus, wann er stattfinden soll und ich vergesse Ihre Verstöße gegen die Hausordnung.“
Talbot überlegte einen Moment. Anderson hegte lediglich einen Verdacht, aber er hatte keinen einzigen Beweis. Und Talbot dachte gar nicht daran, ihn zu unterstützen. Warum sollte er das tun? Er hatte dabei nichts zu gewinnen, oder zu verlieren. Für Anderson ging es um weit aus mehr. Er brauchte Erfolge. Wenn es ihm gelang, einen großangelegten Ausbruch zu vereiteln, würde das für seine Karriere äußerst förderlich sein.
Talbot schüttelte den Kopf. „Tut mir leid. Ich weiß nichts von einem geplanten Ausbruch. Wenn Sie einen Spitzel suchen, müssen Sie sich nach jemand anderem umsehen.“
Der Direktor blickte ihn durchdringend an. Offenbar hatte er sich viel von Talbots Mitarbeit versprochen.
„Ist das Ihr letztes Wort?“
„Ja.“
„Schade“, sagte er kopfschüttelnd. „Das ist wirklich sehr schade.“
Talbot bemerkte das leichte Flattern seiner Augenlider und den angestrengten Zug, der sich in seine Mundwinkel grub.
„Ich wollte Ihnen eine Chance geben. Aber offenbar legen Sie darauf keinen Wert.“
„Warum sollte ich?“ fragte Talbot. „Ich habe lebenslänglich.“
„Ich weiß.“ Anderson behielt den Tonfall eines Staubsaugervertreters bei, als er weitersprach. „Aber es liegt an Ihnen und Ihrem Verhalten, ob diese Zeit für Sie angenehm wird oder nicht.“
„Ich verstehe.“
„Tun Sie das wirklich?“
Talbot wurde in Einzelhaft gesperrt. Es war die schärfste Bestrafung für schlechte Führung. Es bedeutete völlige Isolation, absolutes Alleinsein. Man war von allem ausgeschlossen, so, als existiere man überhaupt nicht mehr. Talbot hatte zwei Wochen Zeit zum Nachdenken. Eine Zeit, die ihm doppelt so lange erschien. Nur der Gedanke an eine mögliche Flucht hielt ihn aufrecht.
Er warf sich auf die Matratze und starrte zu dem schwachen Lichtschein an der Decke empor. Nach einer Weile begann er sich zu ärgern, weil er nichts zu lesen hatte. Aber das wäre wohl zu viel verlangt gewesen. Irgendwo draußen ging ein heiseres animalisches Gebrüll los, dann hörte er hastige Schritte, einen hitzigen Wortwechsel. Das Geschrei wurde erstickt, und noch lange hallte klagendes Heulen durch den Gang.
Zwei Wochen wusste Talbot nicht, welches Wetter draußen herrschte. Zwei Wochen lang hörte er kaum ein Geräusch, außer, wenn ihm das knapp bemessene Essen gebracht wurde. In Kopfhöhe befand sich ein Spion. Mehrmals hatte Talbot den Eindruck, als würde er durch das kleine, mit einer Linse verschlossene Loch intensiv gemustert. Aber er wusste es nicht genau. In seiner Zelle gab es weder einen Tisch, noch einen Stuhl, sondern nur eine schmale Matratze, auf der er sich ausstrecken konnte, sobald er vom Stehen ermüdet war.
Während der ganzen Zeit sah er nur die Gesichter der Wärter, die ihm die Mahlzeiten brachten. Er zwang sich, einige Mundvoll zu essen und schüttete dann mit einem einzigen Schluck seine Wasserration herunter. Anschließend legte er sich auf die Matratze, wo er versuchte, über seine Lage mit Geringschätzung hinwegzukommen.
Als die zwei Wochen um waren, brachte ihn ein Wärter zurück in seine Zelle. Er fand alles so, wie er es verlassen hatte. Harper stand am Fenster, ohne ihn zu beachten. Talbot ließ sich auf sein Bett fallen und schwor sich, den Wärtern nie wieder einen Anlass zu bieten, ihn in Einzelhaft zu stecken. Er blieb auf dem Bett liegen, bis er mit den anderen Häftlingen zum Mittagessen gehen musste – vier Stunden lang.
Nach dem Essen tauchte ein Wärter an der Zelle auf.
„He, Häftling 26378. Mitkommen. Da hat jemand Sehnsucht nach dir.“
„Nach mir?“ fragte Talbot, während er sich vom Bett erhob.
„Ja.“
„Ich erwarte keinen Besuch.“
„Das interessiert mich nicht. Also los, beweg dich!“
Die Zellentür glitt zur Seite. Talbot trat nach draußen und folgte dem Wärter. Gleichzeitig hatte er ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube. Alles sagte ihm, dass dieser Tag nicht zu Ende gehen würde, ohne dass Blut geflossen war. Der Geruch nach Unheil lag fast körperlich spürbar in der Luft und trieb ihm den Schweiß auf die Stirn. Der Wärter blieb stehen und deutete nach vorn.
„Da lang“, befahl er.
Talbot folgte der Anweisung und erreichte die Schleuse, die zum D-Block führte. Der Wärter in dem gläsernen Kasten ließ ihn einfach passieren. Er zuckte nicht einmal mit der Wimper, obwohl er genau wusste, dass sich der Gefangene überhaupt nicht hier aufhalten durfte. Trotzdem ließ er Talbot durch. Der Wärter stank nach Bestechlichkeit.
Doch Talbot verschwendete keinen Gedanken an diesen Umstand. Er hatte auch keine Gelegenheit dazu, denn sein Instinkt sagte ihm, dass etwas nicht stimmte. Der Instinkt des Jägers, der Instinkt des Gejagten. Er spürte fast physisch einen eisigen Hauch von Gefahr. Der Wärter, der ihn begleitet hatte, war verschwunden und plötzlich sah er die drei Männer. Sie lehnten in entspannter Haltung an der Wand und schienen ihm keinerlei Aufmerksamkeit zu schenken.
Alle drei wiesen die Merkmale von Mördern auf – kalte Augen und entblößte Zähne. In Talbots Gesichts spiegelte sich nichts, weder ein Aufflackern noch eine Muskelanspannung. Er hätte umkehren können, doch das wollte er nicht. Sie hätten es als Feigheit angesehen. Wenn sie auf ihn warteten, sollten sie ihn auch bekommen. Und dass sie ihn erwarteten, daran konnte kein Zweifel bestehen. Er ging gelassen weiter.
Aber jeder Muskel in seinem sehnigen Körper war angespannt. Der leicht schlaksige Gang, der viele Menschen dazu verleitete, seine Kraft zu unterschätzen, war von Talbot abgefallen und hatte sich in den straffen, vorsichtigen Gang eines Raubtiers verwandelt. Eines 1,89 Meter großen und 82 Kilo schweren, schwarzhaarigen Raubtiers.
Jetzt blickten ihm die Männer unverhüllt entgegen. Sie sahen wie ein Rudel Straßenköter aus, die einem Rassehund auflauerten. Genau wie Talbot trugen sie Gefängniskleidung. Nur noch wenige Meter trennten ihn von der Gruppe. Der Anführer, ein blonder, junger Kerl, stieß einen leisen, aber deutlich hörbaren Ruf aus.
„He!“
Talbot blieb stehen und deutete mit dem Zeigefinger auf sich selbst.
„Ja, du bist gemeint. Hast du mal ‘ne Sekunde für ein paar Kumpels Zeit?“
Talbot schlenderte auf die Männer zu. Er hatte die Hände in den Taschen seiner Hose geschoben und dort zu Fäusten geballt. Es trennten ihn nur noch wenige Schritte, als der Blonde vorsprang, Talbot am Hemd packte und ihn das letzte Stück vorwärts riss.
„Wir haben mit dir zu reden“, sagte ein anderer, während Talbot herumgeschleudert und mit dem Rücken gegen die Wand gedrückt wurde. Ein scharfer Schmerz durchzuckte ihn.
„Das sieht nach einer sehr fruchtbaren Diskussion aus“, entgegnete Talbot ruhig, aber einer der Männer schnitt ihm das Wort ab, indem er ihm einen harten Faustschlag versetzte. Er spürte, wie seine Knie nachgaben, aber die Hände des Blonden hielten ihn unerbittlich aufrecht.
„Hoffentlich erkennst du unsere Argumente an“, sagte er zynisch.
„Scheiß auf eure Argumente“, stöhnte Talbot.
Die Männer rissen ihn vorwärts und er glaubte, jetzt noch einmal gegen die Wand geschmettert zu werden, aber stattdessen zerrte man ihn in die kleine Nische. Der Blonde ließ sein Hemd los und packte seinen linken Arm. Ein anderer Mann griff nach dem rechten. Sie pressten seine Handgelenke gegen die Wand. Der blonde Häftling rammte Talbot mit aller Kraft seine Faust in den Bauch. Er unterdrückte den aufsteigenden Brechreiz, damit die Kerle nicht die Genugtuung hatten, ihn beim Kotzen zu beobachten.
Er war hart genug, das zu schaffen, und er war hart genug, nicht das Bewusstsein zu verlieren. Er ging ein bisschen in die Knie, aber die beiden Männer, die seine Handgelenke festhielten, sorgten dafür, dass er nicht zu Boden fiel. Für einen Moment hatte er die Augen geschlossen, und als er sie unter großer Anstrengung wieder öffnete, sah er ein unruhiges Funkeln in einer Entfernung von wenigen Millimetern.
Lichtreflexe wanderten an der Waffe auf und ab. Talbot zuckte zusammen. Gleichzeitig wunderte es ihn, dass es in einer so scharf kontrollierten Anstalt wie Fishkill möglich war, Waffen zu organisieren und erfolgreich zu verbergen.
Eine Messerklinge.
Wahrscheinlich so scharf wie das Blatt eines Rasierers. Das Messer näherte sich langsam seinem Gesicht, sank dann ein wenig herab und drückte an seine Kehle.
„Die Spielerei ist jetzt zu Ende, Arschloch“, gab der Blonde bekannt. „Du brauchst nur noch einen Moment zuzuhören. Willst du das?“
Talbot nickte. Gleichzeitig wartete er auf eine günstige Gelegenheit, bei der es diesen Kerlen heimzahlen konnte. Ein winziger Augenblick der Unachtsamkeit reichte aus.
„Weißt du, was wir von dir wollen?“
Der Atem des Mannes roch penetrant nach zwei nicht verdauten Gängen Gefängnisfraß. Abermals nickte Talbot.
„Sehr gut“, sagte der Blonde. „Aber damit du es nicht vergisst, will ich es dir noch einmal langsam und in Klartext wiederholen. Wir haben es nicht gern, wenn du eine unserer Pussys verprügelst. Kapiert? Harper ist eine unserer Lieblingspussys. Sein Arsch gehört uns. Verstanden?“
Zum dritten Mal nickte Talbot.
„Sehr schön.“
Die Männer ließen ihn los. Talbot ging an ihnen vorbei.
„He, wohin willst du, Mann?“ fragte der Blonde. „Das hier ist ein Privatclub.“
„Ich habe eine Verabredung. Also verpisst euch endlich.“
„Riskier hier bloß keine Lippe, du dämliches Schwein.“
Langsam ging er hinter Talbot her und hob das Messer.
„Weißt du, was wir mit Schweinen machen?“
Talbot explodierte förmlich. Auch auf die Gefahr hin, dass man ihn wieder in Einzelhaft steckten würde. Er schlug dem Mann das Messer aus der Hand und traf mit der Faust den Kopf des Blonden. Der Mann schrie laut auf und fiel zu Boden. Talbot sprang nach vorn und widmete sich dem zweiten Angreifer. Er versuchte auszuweichen, aber seine Reaktion kam zu spät. Die Faust krachte mitten in sein Gesicht. Sein Schrei klang wie der eines Tieres. Er griff mit den Händen in die Luft, aber da war nichts, an dem er sich festhalten konnte. Stöhnend brach er in die Knie.
Talbot wirbelte herum, um auch den Dritten zu erledigen. Doch der glatzköpfige Mann war auf Distanz gegangen. Er stand mindestens fünf Schritte von Talbot entfernt und hielt eine Eisenstange in der Hand.
„Drei gegen einen“, höhnte er. „Wann geht das schon einmal gut?“
Dann begann er, mit der Eisenstange auf seinen Gegner einzuschlagen. Talbot blockte jeden Treffer ab. Keuchend drehten sich die beiden Männer langsam im Kreis. Der Glatzköpfige war stark wie ein Bulle, aber ein blutiger Anfänger. Talbot parierte die meisten seiner Schläge, während er mit der Faust auf den Gegner eindrosch. Ein solider Treffer an die Schläfe beförderte den Glatzköpfigen schließlich zu Boden. Er wollte sich noch einmal erheben, doch es gelang ihm nicht.
„Hat dich das Aufwärmtraining mit meinen Krawallmachern etwa ermüdet?“ fragte jemand hinter ihm.
Talbot wandte langsam den Kopf, bis er den Besitzer der Stimme sehen konnte. Acht Männer standen hinter ihm. Sie hatten sich um einen schmächtigen, schwarzhaarigen Kerl gruppiert.
„Ich dachte mir, dass es Ärger geben würde“, sagte er. „Ich wusste es in dem Moment, als du durch das Gefängnistor kamst.“
„Ich habe den Kampf nicht begonnen“, verteidigte sich Talbot.
„O doch, das hast du. Mein Name ist Fabio Palvetti. Du hast meinen Onkel umgebracht. Und so etwas schätzen wir in meiner Familie gar nicht.“
„Es war nichts Persönliches.“
„Das glaube ich dir sogar. Trotzdem werde ich es nicht so einfach hinnehmen.“
„Was willst du tun?“ fragte Talbot. „Mich töten?“
Palvetti gab den Männern ein Zeichen.
„Los, macht ihn fertig.“
Talbot versuchte, einen anständigen Kampf zu liefern, aber gegen diese Übermacht war Widerstand ein hoffnungsloses Unterfangen. Er platzierte ein paar gezielte Treffer und dann wurde er einfach überrannt. Seine eigenen Schläge verpufften wirkungslos gegen die Mauer harter Körper und den Hagel schwingender Fäuste. Als er zu Boden ging, traten Schuhe nach ihm und trampelten auf ihm herum. Immer wieder versuchte er, hochzukommen, und wurde doch nur immer wieder niedergezwungen.
Wenigstens hatte er die Genugtuung, zwei seiner Gegner außer Gefecht zu setzen. Einmal fand er den Raum, eine Faust in das Gesicht eines Mannes zu stoßen. Talbot spürte, wie Knochen und Knorpel unter seinen Knöcheln zersplitterten. Der Mann flog rückwärts und krachte gegen den abseitsstehenden Palvetti. Beide stürzten zu Boden. Palvetti kam wieder hoch. Der andere blieb liegen und stieß einige wimmernde Laute aus.
Palvetti wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Seine Unterlippe war aufgeplatzt und blutete. Talbot kniete am Boden. Sein Atem kam stoßweise. Aus schmalen Augen musterte er den jungen Mann. Er brauchte einige Zeit, um die schmerzhafte Benommenheit abzuschütteln. Die Schläge hatten ihm ziemlich zugesetzt.
„Macht die Sau fertig!“ brüllte Palvetti.
Abermals stürmten die Männer auf ihn zu. Er setzte sich fluchend und trampelnd zur Wehr. Fäuste schlugen auf ihn ein. Dicht vor seinen geschwollenen Augen sah er die verzerrten Gesichter der Angreifer. Talbot krümmte sich am Boden zusammen. Einer der Männer hob seinen Fuß, um die rechte Hand zu zerstampfen.
„Aufhören!“
Eine Stimme aus dem Hintergrund setzte dem Blutbad schließlich ein Ende. Die Angesprochenen wandten sich um, keuchend und erschöpft. Ein Mann löste sich aus der Dunkelheit. Er war groß und schlank. Seine silbergrauen Haare trug er nach hinten gekämmt. Die dunklen Augen blickten stolz und ein wenig gelangweilt. Ein schmaler Schnurrbart zierte seine Oberlippe. Dem faltigen Gesicht nach zu urteilen, musste er mindestens sechzig Jahre alt sein. Er trat vor und warf einen Blick auf die blutende Gestalt, die gekrümmt am Boden lag.
„Genug“, sagte er. „Was soll das bedeuten, Fabio? Sorgst du hier so für Ruhe?“
„Ich … ich kann alles erklären, Don Amendola ...“
„Schweig. Du hast so viel Hirn wie eine Amöbe. Hier steht mehr auf dem Spiel als deine Rache.“
Dann wandte er sich an Talbot, der langsam auf die Füße kam.
„Nun zu dir. Wie soll ich dich nennen? Talbot? Ranok?“
„Ist das wichtig?“ fragte er. Blut rann aus seiner Nase und von seinem Mund, aber er hatte einen Gesichtsausdruck unveränderlicher Überlegenheit.
„Eigentlich nicht“, sagte Amendola ruhig. „Namen sind nur Zeitverschwendung. Zumindest hier drin. Und ich bin es gewohnt, mit wenig Zeit auszukommen, besonders wenn es sich um Leute wie dich handelt. Draußen habe ich mich mit Typen wie dir überhaupt nicht abgegeben und hier drin mache ich es nur dieses eine Mal. Wenn es ein zweites Mal geben sollte, dann windest du dich unter meinem Fuß wie eine Kakerlake.“
„Ich habe nicht vor, Ärger zu machen“, versicherte Talbot.
„Das will ich hoffen“, entgegnete Amendola. „Du bist ‘ne ziemlich große Nummer.“
„Möglich.“
Amendola schüttelte leicht den Kopf. „Nur nicht so bescheiden. In deiner Branche verzeiht man keine Fehler. Und die Tatsache, dass du dich so lange behaupten konntest, beweist, dass du was auf dem Kasten hast.“
Talbot antwortete nicht, sondern zuckte nur mit den Schultern.
„Na ja, wie dem auch sei“, fuhr Amendola fort. „Irgendwann verlässt einen das Glück, nicht wahr?“
„Vielleicht.“
„Sonst wärst du wohl kaum hier, oder?“
„Was soll das werden?“ fragte Talbot. „Eine Fragestunde bezüglich meiner beruflichen Qualifikation?“
„Die steht außer Zweifel.“
„Um was geht es dann?“
„Deine Anwesenheit hier in Fishkill schafft Probleme. Du ziehst Ärger magisch an. Der neue Direktor hat so seine eigenen Ansichten. Wir wollen, dass Ruhe herrscht … aus Gründen, die dich nichts angehen.“
„Die Flucht?“ fragte Talbot.
Amendola sah ihn unruhig an. „Du weißt davon?“
„Man munkelt darüber. Wenn es hier Tote gibt, inklusive meiner Wenigkeit, wird der Direktor eine Razzia veranstalten. Dann könnt ihr die Flucht vergessen. Deshalb wäre es besser, wenn ihr mich am Leben lasst.“
Der grauhaarige Mann überlegte einen Moment. „Vielleicht sollten wir dich doch besser töten. Du könntest reden!“
„Könnte ich“, bestätigte Talbot.
„Also, was sollen wir mit dir machen?“
„Ich hasse das Gefängnis genauso wie alle anderen, die hier eingesperrt sind. Ich bin dabei.“
„Nein!“ schrie Palvetti. „Er will dich reinlegen. Ich bin dafür, ihn zu töten. Wir lassen es wie ein Unfall aussehen.“
„Halt die Schnauze, Fabio“, herrschte Amendola ihn an. „Hier bestimme ich.“
Fabio Palvetti, außer Atem, wich zurück und machte eine Bewegung, als wolle er sich auf Talbot stürzen; aber dann schien er sich eines besseren zu besinnen. Er erstickte fast an seinem Hass und der Demütigung, aber er unternahm nichts.
Minutenlang musterte Amendola den Killer. Er bemühte sich, die Meinung zu präzisieren, die er angefangen hatte, sich über Talbot zu bilden. Dieses Ausforschen hatte in seinen Augen einen doppelten Wert, denn es gestattete ihm, sich ein Urteil über den Mann zu bilden. Und dieser Eindruck war durchaus positiv. Talbot konnte in seinen Zügen verfolgen, wie er mit sich kämpfte. Aber Amendola wusste, das er keine andere Wahl hatte. Es ging um sein Leben, um seine Freiheit.
„Okay“, sagte er schließlich. „Ich habe dich lieber an meiner Seite, als in meinem Rücken. Wir werden dich in Ruhe lassen.“
Talbot spürte, dass er vorübergehend das Spiel gewonnen hatte, aber es war ein sehr relativer Erfolg.
„Ich wusste, dass du die Fähigkeit hast, einen Sachverhalt richtig zu beurteilen. Ich bin kein Teufel, aber ich bin auch kein Engel. Ich bin Geschäftsmann, genau wie du. Eine Hand wäscht die andere.“
„Also Waffenstillstand bis wir frei sind“, sagte Amendola. „Bedauerlicherweise muss alles geheim bleiben, bis die Zeit reif ist.“
„Kein Problem“, erwiderte Talbot. „Du weißt, wo du mich finden kannst.“ Er wischte sich das Blut aus dem Gesicht. „Wenn die Zeit reif ist.“
Amendola nickte. Er zeigte keinerlei Anzeichen von Wut oder Nachdenklichkeit. Er war ruhig. Er war kalt. Eiskalt. Das musste er sein, wenn er es in einer Umgebung von mehrfachen Mördern, brutalen Schlägern und Kriminellen aller Art zu einem ungekrönten König gebracht hatte. Niemand kam in der Knasthierarchie so weit nach oben, ohne alle diese Eigenschaften zu haben.
„Ja, wenn die Zeit reif ist“, bestätigte Amendola. „Alles, was du tun musst, um zu überleben, ist, dich ruhig zu verhalten. Einfach ruhig sein – und dich von mir fernhalten.“
In diesem Moment heulte eine Sirene auf, ein kurzer gellender Ton. Es war das Signal für eine außerplanmäßige Anwesenheitskontrolle. Auch das gehörte zu den neuen Vorsichtsmaßnahmen, um etwaige Fluchtversuche zu unterbinden. Die Häftlinge mussten nun auf dem schnellsten Weg in ihre Zellen zurückkehren. Auf ein Fingerschnippen von Amendola eilten die Männer dem Ausgang zu.
Er zog sich würdevoll zurück mit der Befriedigung, die Angelegenheit so erledigt zu haben, wie er es für richtig hielt. Er hatte der Klugheit zum Sieg verholfen und einen großen Schritt im Hinblick auf die bevorstehende Flucht getan. Er hatte sich als geschickter Taktiker erwiesen und war sich bewusst, seine Kräfte in der bestmöglichen Weise eingesetzt zu haben.
Talbot war allein. Ein brutaler Spuk hatte Spuren auf seinem Körper hinterlassen, aber er lebte. Und das verdankte er ausgerechnet einem Mann wie Amendola. In seinem Fall war das Gefängnis als Strafinstrument der Justiz vollkommen nutzlos. Er befand sich zwar nicht in Freiheit, aber es ging ihm auch nicht schlecht.
Roberto Amendolas Spitzname lautete „Der Denker“. In der Unterwelt war er eine Legende. Manche verehrten ihn wie einen Gott. Er hatte viele Pläne. Was immer er tat, er plante es im großen Maßstab. Und Talbot wusste, dass er in Amendola Plänen keine Rolle spielte. Trotzdem wollte er ihm und seinen Handlangern beweisen, dass es unter 1800 Männern immer einen gab, der sich keine Angst einjagen ließ. Einen, der härter war.
Er verließ den Zellenblock, marschierte den Gang entlang und passierte die Schleuse. Der Wärter im Glaskasten beachtete ihn überhaupt nicht. Es schien ihn auch nicht zu interessieren, wer Talbot die Verletzungen zugefügt hatte. Dieser Umstand war ein weiterer Beweis dafür, wer in diesem Gefängnis wirklich die Befehle gab.
Die anderen Häftlinge drängten durch die Türen. Er straffte sich und versuchte, so gerade wie möglich zu gehen, obwohl jeder Muskel in seinem Körper schmerzte. Talbot erreichte seine Zelle gerade noch rechtzeitig, bevor die Wärter die Reihe der Stahlgittertüren abschritten, um zu kontrollieren, ob jeder an seinem Platz war.
Dann wurden die Türen automatisch verschlossen. Harper stand an seinem bevorzugten Platz und starrte durch das vergitterte Fenster. Talbot hatte nun Zeit zum Nachdenken. Er legte sich aufs Bett und blickte in die helle Lampe an der Decke, bis seine Augen schmerzten und er nichts mehr erkennen konnten. Alles war hinter einem Schleier grüner Ringe verborgen. Trotzdem fühlte er sich mit einem Schlag besser. Die Tatsache, dass Amendola eine Flucht plante, gab ihm Auftrieb. Im Augenblick wusste er noch nicht, was der Mann vorhatte, aber es musste etwas Großes sein. Und Talbot wollte seine Chance nutzen. Die Schmerzen ließen etwas nach. Er drehte sich auf die Seite und schlief, bis er von der Sirene zum Abendessen geweckt wurde.
In den darauffolgenden Tagen sprach niemand mit Talbot. Niemand kam in seine Nähe, aber die Blicke der anderen Gefangenen verfolgten ihn. Sie alle fragten sich, ob er bei der Flucht dabei sein würde. Doch im Moment konnten sie nur abwarten.
Nach dem Abendessen lag Talbot in seinem Bett und starrte die Decke an. Seine Nerven waren bis zum zerreißen gespannt. Die Ereignisse der letzten Tage hatten ihm klargemacht, dass das Leben eines Mannes in einem Gefängnis wie Fishkill Tag für Tag an einem seidenen Faden hing. Fishkill war die Hölle, und das hatte er keinen Tag lang vergessen.
Es war die Hölle für die Gefangenen und das Fegefeuer für die Wärter. Aber am schlimmsten war es für einen Mann, der nichts mehr zu verlieren hatte. Einem Mann, der den Rest seines Lebens in diesem Knast verbringen sollte. Doch Talbot wollte nicht hier bleiben. Er zählte die Tage und Minuten, bis er endlich von hier verschwinden konnte. Dann wollte er sich an dem Mann rächen, der ihn verraten hatte.
Doch das Warten fiel ihm schwer. Für einen Killer war Geduld eines der wichtigsten Werkzeuge. Aber wenn das Warten mit winziger, nagender Ungewissheit verbunden war, konnte es selbst einen Mann mit eisernen Nerven angreifen. Talbot war fast sicher, dass er jeden Blickwinkel beachtet und den einzig möglichen Schluss gezogen hatte, wie der nächste Schritt in diesem grimmigen Spiel aussähe.
Seine ganze Hoffnung ruhte auf Roberto Amendola. Der „Denker“ hatte schon unzählige Male vor dem Untersuchungsrichter gestanden, war aber immer Mangels Beweisen davongekommen. Talbot verzog die Lippen zu einem zynischen Lächeln. Das gehörte zum Prinzip der Mafia: Zeugen kaufen oder einschüchtern und, wenn alles nichts half, spurlos zu beseitigen. Es gab wenige, die es wagten, gegen einen Mafioso auszusagen. Manche, die es taten, hatten anschließend kaum noch Zeit, es zu bereuen.
Aber auch für einen Mann wie Amendola kam der Tag, an dem er sich für seine Taten verantworten musste. Zwei Jahre hatte das FBI gegen ihn ermittelt, hatte Telefongespräche abgehört und unzählige Beweise zusammengetragen. Selbst der beste Anwalt konnte ihn nicht mehr vor dem Gefängnis bewahren. Doch Amendola gab sich nicht geschlagen. Er hatte nach einem Weg gesucht, um aus Fishkill zu entkommen. Und er hatte ihn offenbar gefunden.
Talbot war fast sicher, aber nie ganz. Ein Verrückter war unberechenbar, und Amendola war verrückt, unbestreitbar. Aber ebenso war er davon besessen, einen Ausbruch zu organisieren. Und sein Ego fand nur darin Bestätigung, indem er das Unmögliche wagte – und schaffte. Das war der Grundgedanke von Talbots sorgfältigen Überlegungen. Trotzdem hasste er es, zu warten. Ein Tag glich dem anderem.
Der Ablauf war immer gleich. Um 7.00 Uhr erfolgte das Wecken, die Durchführung der Lebendkontrolle und die Ausgabe des Frühstücks. Um 9.00 Uhr war Arbeitsbeginn. Nachdem die Gefangenen gründlich durchsucht worden waren, gingen sie gestaffelt in die jeweiligen Arbeitsbetriebe oder in die interne Schule. Gefangene, denen keine Arbeit zugewiesen werden konnte, wurden bis zum Mittagessen in ihrer Zelle eingeschlossen.
Um 12.00 Uhr erfolgte die Mittagskostausgabe im Speisesaal. Um 15.30 Uhr erhielten die in den Vollzugsabteilungen befindlichen Gefangenen Aufschluss. Innerhalb der Abteilungen konnten sie sich nun frei bewegen. Um 17.30 Uhr erfolgte das Abendessen. Um 20.00 Uhr musste sich jeder Gefangene in seine Zelle begeben und wurde dort eingeschlossen. Erst am nächsten Morgen durfte er sie wieder verlassen.
Die Zellentür glitt zur Seite.
„He, Amendola“, sagte der Wärter. „Besuch für Sie. Ihr Anwalt.“
Er stieg aus dem Bett und folgte dem Wärter. Sein Anwalt war der einzige Mensch, der ihn regelmäßig besuchen durfte. Und es war die einzige Gelegenheit, bei denen sie verschlüsselte Botschaften über den Fortschritt der Operation austauschen konnten. Der Wärter führte ihn in den Besucherraum.
Amendola setzte sich an einen kleinen Tisch hinter einer schusssicheren Glasscheibe. Sein Besucher würde auf der anderen Seite sitzen. In Gegenwart eines Aufsehers konnten sie sich über eine Gegensprechanlage unterhalten. Die Tür auf der anderen Seite der Glasscheibe wurde geöffnet. Ein Mann mittleren Alters betrat den Raum. Er setzte sich und drückte auf den Sprechknopf.
„Guten Tag, Mister Amendola“, sagte er. „Wie geht es Ihnen?“
„Wie immer.“
„Ich soll Ihnen Grüße von Ihrer Frau bestellen.“
„Das freut mich“, entgegnete Amendola, obwohl er genau wusste, dass seine Frau vor drei Jahren an einem Herzinfarkt gestorben war. „Wie geht es ihr? Hoffentlich macht sie sich keine Sorgen um mich?“
Der Anwalt drückte wieder die Sprechtaste. „Natürlich macht sich Ihre Frau große Sorgen um Sie. Und auch Ihre Tochter und das ganze Viertel.“
„Ist meine Familie wenigstens gut versorgt?“
„Ja, ich habe mich um alles Notwendige gekümmert.“
„Und wie steht es um mein Wiederaufnahmeverfahren? Gibt es denn schon irgendwelche Fortschritte?“
„Wir arbeiten daran. Aber es ist natürlich sehr aufwendig.“
Amendola nickte. „Ich verstehe.“
„Können wir sonst noch etwas für Sie tun?“
Das war die vereinbarte Frage. „Meine Tochter wird am nächsten Freitag neun Jahre alt. Sagen Sie ihr, dass ich ihr alles Gute wünsche.“
Er ließ die Sprechtaste wieder los. Der Mann auf der anderen Seite wusste jetzt, was er wissen musste. Dass Amendola am nächsten Freitag einen Ausbruchsversuch unternehmen wollte, und zwar abends um 9.00 Uhr.
Der Anwalt erhob sich. Er lächelte Amendola aufmunternd zu. „Ich werde mich darum kümmern.“
Er verließ den Raum. Amendola stand ebenfalls auf und kehrte in seine Zelle zurück. Er war bester Laune. Das Treffen mit seinem Anwalt gab ihm die Hoffnung, dass er nicht mehr allzu lange hinter den Mauern von Fishkill auf die Annehmlichkeiten des Lebens verzichten musste. Mehr als vier Monate hatte er sich ein Bild von der Lage gemacht, wie dies jeder gewissenhafte Planer tun musste, anstatt sich kopfüber in Improvisation zu stürzen, was er besonders hasste.
Die meisten Häftlinge in diesem Gefängnis waren nicht fähig, ein Unternehmen durchzuführen, das ein wenig Intelligenz verlangte. Sie wussten nicht, dass man Zeit gewann, wenn man zuerst ein wenig nachdachte, anstatt einen wilden Umtrieb zu machen.
Er hatte nicht lange gebraucht, um die Schwachstellen in Fishkill ausfindig zu machen. Und er besaß genug Geld und die nötigen Verbindungen, um diese Schwachstellen für sich auszunutzen. Sein Plan war verhältnismäßig einfach, der Situation angepasst, und es war darin jede Eventualität berücksichtigt. Diesem Projekt hatte er sich mit der beruflichen Gewissheit gewidmet, die er früher bei der Ausübung seines Metiers für die Mafia an den Tag legte, wenn er ähnliche Pläne anfertigte, aber darüber hinaus auch mit einer fieberhaften Begeisterung, die er früher nicht empfand.
Amendola war keiner von jenen Menschen, die, völlig hypnotisiert von der vorbereitenden Arbeit, die Ära der Verwirklichung auf unbestimmte Zeit hinauszögern, weil sie ihre ganze Kraft der geistigen Arbeit zum Nachteil für die Materie widmeten. Er blieb immer mit beiden Füßen auf dem Boden. Gleichzeitig versuchte er, sämtliche Risiken schon im Vorfeld zu eliminieren.
Die Achtung, die man ihm entgegenbrachte, verdankte er seiner Umsicht und der Geduld, die er in der Zeit, welche der Aktion vorausging, an den Tag legte, und ebenso seiner Lebhaftigkeit und schnellen Entschlusskraft, wenn die Stunde zum Handeln gekommen war. Zudem stand er in dem Ruf, nichts dem Zufall zu überlassen. Nur das Ergebnis des Ganzen vermochte seinen Verstand zu interessieren, denn es symbolisierte in einer lebendigen Struktur die erbitterten Anstrengungen und zahllosen Erfahrungen, die er im Laufe der Jahre gesammelt hatte.
Greg Anderson stand am Fenster seines Büros und beobachtete einige Häftlinge, die damit beschäftigt waren, den Hof von Unrat zu säubern. Doch dieser Anblick lenkte ihn nicht von seinen Gedanken ab, sondern bildete nur eine Begleiterscheinung zu der quälenden Vorstellung, die seit einiger Zeit sein Hirn zermarterte.
Ein Gefühl der Angst hatte ihn ergriffen. Irgendetwas stimmte nicht. Er spürte es mit jeder Faser seines Körpers. Die Gefangenen verhielten sich seltsam ruhig. Zu ruhig für seinen Geschmack. Seit zwei Wochen hatte es keine Zwischenfälle mehr gegeben. Keine Auseinandersetzungen, keinen Streit, nicht einmal ein lautes Wort. Die Insassen verhielten sich absolut mustergültig.
Und genau das nährte seinen Verdacht, dass bald etwas Entscheidendes passieren würde. Dann war der Augenblick gekommen, in dem er handeln musste. Es war für ihn unumgänglich, sich im Voraus genau das vorzustellen, was er tun würde. Seine Frau machte ihm stets Vorhaltungen, weil er zu viel nachdachte.
Vielleicht genügte es, dass er sich diese Handlungen ausmalte, um seine Nerven zu verkrampfen und jeden seiner Muskel zu lähmen. Er durfte sich dem nicht entziehen. Tief im Innern hatte er intuitiv erkannt, dass dieser Ablauf zwangsläufig und seit Langem vorbereitet war. Unvermeidlich lief er auf die Prüfung seiner Fähigkeiten hinaus.
Schon seit Wochen kursierten Gerüchte über einen bevorstehenden Ausbruch. Aber es waren eben nur Gerüchte. Etwas Konkretes hatte er nicht in der Hand. Es gelang ihm auch nicht, die Vision der unmittelbaren Folgen zu verscheuchen. Er hielt sich also dazu an, ihr Bild zu betrachten, es entstehen zu lassen und es in allen Einzelheiten genau auszumalen.
Er zwang sich dazu, seine Aspekte zu analysieren, und hoffte dabei, ihrer überdrüssig zu werden, und zu der Gleichgültigkeit zu gelangen, die ihm zur Gewohnheit geworden war. Aber das Verfahren, sich auf diese Dinge vorzubereiten, blieb unwirksam. Im Grunde genommen konnte er nichts anderes tun, als abzuwarten.
Roberto Amendola lag in seinem Bett und hatte die Augen geschlossen. Aber er schlief nicht. Seit seiner Entscheidung über die Durchführung des Ausbruchs hatte er ein bis ins Detail ausgearbeitetes Programm aufgestellt. Er hatte die Rollen verteilt, damit jeder einzelne Teilnehmer im Voraus nachdenken und sich auf die notwendigen Schritte vorbereiten konnte. Auf diese Weise würden sie alle im geeigneten Augenblick den Kopf freihaben, um unvorhergesehenen Ereignissen begegnen zu können.
Es war kindisch, glauben zu wollen, dass ein Ausbruch ohne ernsthafte Vorbereitungen gelingen konnte. Aber hatte er wirklich an alles gedacht? Hatte er sämtliche Dinge in seine Planungen mit einbezogen? Eine fremdartige Empfindung quälte ihn. Sie war schrittweise auf dem Weg dunkler Gefühle in sein Bewusstsein eingedrungen, um sich dort in einen noch unklaren Gedanken zu verwandeln, der verzweifelt nach einem immer genaueren Ausdruck suchte.
Sein Unbehagen verschlimmerte sich, bis daraus ein Angstgefühl wurde, das er durch nüchterne Überlegungen zu zerstreuen suchte. Selbstverständlich hatte er alles genau geplant. Er zwang sich, nur noch an den Ausbruch und an die Aufgaben der einzelnen Männer zu denken, die auf die Stunde des Losschlagens warteten. Diese Stunde war nahe. Und der Erfolg der gesamten Aktion ruhte auf ihm.
Amendolas Angstgefühl zerstreute sich nicht. Das bewusste Gefühl suchte noch immer danach, sich exakter ausdrücken zu können, während es sich gleichzeitig der Analyse entzog. Amendolas Verstand kämpfte erbittert gegen dieses irritierende geheimnisvolle Etwas. Niemals passte sich die Aktion dem vorher entworfenen Plan an. Immer kam in der letzten Minute ein banaler, trivialer Zwischenfall und warf alles über den Haufen. Aber nicht bei ihm. Seine Pläne hatten immer funktioniert.
Die Nacht der Nächte war angebrochen. Stille zog in das Gefängnis ein. Worte erstickten in der Kehle. Die Männer bewegten sich auf Zehenspitzen. Niemand wagte einen Blick nach draußen. Der Wärter vollzog seine allabendliche Anwesenheitskontrolle. Sie verlief ohne Zwischenfälle. Er ging zum Telefon, um Bericht zu erstatten.
„Wachturm? Alle anwesend und gezählt“, meldete er. „Es liegt jetzt an euch. Schreibt in den Bericht, dass ich noch einmal zurückgegangen bin, um einen Streit zu schlichten, okay?“
Der Wärter hängte den Hörer ein und ging wieder zurück. Vor der Zelle von Amendola und Palvetti blieb er stehen.
„Okay, Ihr seid dran. Die Tore sind in zehn Minuten auf. Der Direktor hat keinen Verdacht. Viele unserer Jungs haben sich mit Durchfall krankgemeldet. Deswegen sind heute weniger Leute auf Wache.“
Er öffnete die Zellentür.
„Lasst es echt aussehen, damit ich meinen Job behalten kann. Am besten, Ihr bratet mir ein paar über, bevor Ihr mich fesselt. Was zum ...“
Der Wärter wich einen Schritt zurück. Seine Augen richteten sich auf die Pistole, die Amendola plötzlich in der Hand hielt. Als Schalldämpfer benutzte er eine leere Plastikflasche, die er über die Mündung gestülpt hatte. Die Waffe hatte er von einem bestochenen Wärter erhalten. Aber an einen Schalldämpfer war schon schwerer heranzukommen. Amendola betätigte den Abzug. Die Pistole gab nur einen dumpfen Knall von sich. Der Wärter stürzte so schnell, dass ihn Amendola nicht mehr auffangen konnte. Es dröhnte und polterte, als der Mann zusammenbrach.
Amendola grinste. Der Schalldämpfer funktionierte besser, als er erwartet hatte. Aber es war die einzige Möglichkeit, um zu verhindern, dass ein unbestochener Wärter den Schuss gehört und vorzeitig Alarm geschlagen hätte.
„Vorwärts!“, flüsterte er Palvetti zu. „Wir dürfen keine Zeit verlieren.“
Obwohl Chad Kendall die besten Schulen Amerikas besuchte und als überdurchschnittlich intelligent galt, hatte er nie die Absicht, Karriere zu machen, oder einen gut bezahlten Job anzunehmen. Sein einziger Ehrgeiz bestand darin, unzählige Taschenspielertricks und Zauberkunststückchen zu beherrschen, die er Freunden und Bekannten bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit vorführte.
Kendall war ein großer, ungemein traurig aussehender Mann. Ein Blick aus seinen Augen hätte den größten Geizhals der Welt bewegen können, dem Mann ein Almosen zu überlassen. Doch der Ausdruck in seinem Gesicht täuschte, denn Kendall war alles andere als sanftmütig. Er war phlegmatisch. Er ertrug die Widerwärtigkeiten des Lebens mit unglaublichem Gleichmut. Die Freuden dagegen genoss er.
Manche hielten Kendall für einen Lebenskünstler, andere behaupteten, er sei ein ausgemachter Trottel. Die Tatsache, dass er in der Justizvollzugsanstalt von Fishkill arbeitete, dessen Wachpersonal sich immerhin aus qualifizierten Männern zusammensetzte, bewies, dass Kendall über bestimmte Fähigkeiten verfügte. Er hielt seine Anstellung in Fishkill für reine Glückssache, und er tat nichts, um sich das Lob seiner Vorgesetzten zu verdienen.
In dieser Nacht patrouillierte er im zweiten Stock des Gefängnisses. Kendall benötigte zehn Minuten für einen Rundgang. Seine Aufgabe bestand darin, ständig zwischen den einzelnen Abteilungen hin und her zu gehen, um etwaige Ausbruchsversuche sofort zu unterbinden. Er entledigte sich seines Auftrags mit der gleichen Gelassenheit, die er immer an den Tag legte.
Jedes Mal, wenn er an der Schleuse vorbeikam, nickte er dem Wachposten im Glaskasten zu, woraufhin der Mann seinen Gruß ebenfalls durch ein Nicken erwiderte. Als er den Gang im Nordflügel erreichte, glaubte er, eine Bewegung gesehen zu haben. Er blieb stehen. Kendall hätte den Posten im Glaskasten alarmieren können, aber das wollte er erst tun, wenn er seiner Sache absolut sicher war.
Seine Hand näherte sich der Pistole, die in seinem Holster steckte. Plötzlich stand er Roberto Amendola und einem zweiten Häftling gegenüber. Die Männer grinsten. Kendall griff nach der Waffe. Im selben Moment sah er die Pistole mit der aufgestülpten Plastikflasche, die als Schalldämpfer diente. Amendola drückte ab. Nur ein leises Ploppen ertönte. Kendall presste die Hände gegen seinen Bauch. Dann sackte er zusammen und blieb reglos am Boden liegen.
„Ist er tot?“ fragte Fabio Palvetti.
„Sicher.“
„Du hast gut gezielt.“
Amendola schaute auf seine Pistole und nickte.
„Ich habe eine ziemlich ruhige Hand.“
Die beiden Männer setzten sich wieder in Bewegung. Erwartungsvolle Gesichter blickten ihnen aus den Zellen entgegen. Amendola und Palvetti näherten sich dem Glaskasten. Der Wachposten warf ihnen nur einen flüchtigen Blick zu. Er betätigte einen Knopf und die Tür öffnete sich.
„Alles glattgegangen?“ fragte er.
„Selbstverständlich“, erwiderte Amendola.
Er betrat den Glaskasten und warf einen prüfenden Blick auf die Monitore. Es gab kaum einen Winkel, der nicht von den Überwachungskameras erfasst wurde. Trotzdem hatte er einen Weg gefunden, um das System auszutricksen. Das Gefängnis verfügte über die modernsten Sicherheitsvorkehrungen, aber es gab eine Schwachstelle: Die Wärter. Wer sie kontrollierte, der kontrollierte das Gefängnis. Amendola trat ans Pult und betätigte einen Knopf.
Wie von Geisterhand glitten sämtliche Zellentüren zur Seite. Es war das verabredete Zeichen. Rufe ertönten. Schritte hallten durch die Gänge. Plötzlich fiel ein Schuss. Talbot erhob sich vom Bett, trat an den offenen Eingang und schaute sich um. Die Häftlinge verließen ihre Zellen und liefen in Richtung Schleuse.
Ein gewöhnlicher Mann hätte bei diesem Lärm überhaupt kein anderes Geräusch vernommen, aber das Gehör des Killers war durch die Anforderungen seines gefährlichen Berufs auf extreme Feinheit gestimmt. Gleichzeitig nahm er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr. Rasch wandte er sich um. Chris Harper kam langsam auf ihn zu. In der Hand hielt er eine Zahnbürste mit angespitztem Stiel.
„Ich mach dich fertig, du Mistratte!“
Speichel tropfte aus seinem Mundwinkel. Die Pupillen waren unnatürlich geweitet. Vermutlich hatte er sich wieder eine ordentliche Dosis Kokain in die Nase gezogen. Dafür sprach zumindest seine vollkommen überzogene Mimik. Mit einer blitzschnellen Bewegung stieß er zu. Talbot wich zur Seite. Sein Instinkt ließ ihn handeln und das Richtige tun. Der angespitzte Stiel schrammte knapp an seinem rechten Auge vorbei.
Talbot überschlug sich am Boden, landete auf den Fersen und kam wieder hoch. Er legte seine ganze Kraft in den flachen Hechtsprung, mit dem er auf seinen Gegner zuflog. Harper konnte nicht schnell genug ausweichen. Talbots Schädel prallte gegen seine Brust. Ein wuchtiger Hieb ließ die Zahnbürste im hohen Bogen durch die Luft fliegen. Gleichzeitig schlug der Killer dem Gegner seine Faust ans Kinn.
Harper taumelte einen Schritt zurück. Talbot setzte sofort nach. Seine Schlagkombinationen hatten große Wucht, und trotzdem vergeudete er nur seine Kraft. Das Kokain hatte Harper für Schmerzen unempfindlich gemacht. Er schien sich in einem wahren Rausch zu befinden. Talbot konnte noch so hart zuschlagen, sein Gegner spürte die Treffer kaum.
Für einen kurzen Augenblick ließ er von dem Mann ab. Dieser nutzte die Chance und griff sofort an. Seine knochigen Hände erwischten das Hemd. Es gelang Talbot nicht, sich loszureißen, und seine Fausthiebe in das Gesicht des Häftlings hatten nicht den geringsten Erfolg.
Harpers Nase war gebrochen. Er blutete, doch es schien ihm nichts auszumachen. Immer wieder schlug Talbot zu. Harper ließ den Killer mit einer Hand kurz los. Aber nur, um ihm die Finger um den Hals zu legen und brutal zuzudrücken. Talbot traten die Tränen in die Augen. Er setzte sich verzweifelt zur Wehr, verlor das Gleichgewicht und fiel. Harper ging mit ihm zu Boden. Ein böses Lachen entrang sich seiner Kehle.
Talbot schlug wie von Sinnen um sich. Harper legte ihm auch die zweite Hand um den Hals. Der Killer mobilisierte seine Kraftreserven. Mit einem Tritt beförderte er seinen Gegner zur Seite. Dann wälzte er sich nach rechts, japste gierig nach Luft und sprang auf.
Harper kam nicht so schnell wieder auf die Füße. Diesen Vorteil nutzte Talbot. Bevor sein Gegner sich erheben konnte, trat er zu. Doch es kam zu keinem Treffer, denn Harper fing den Fuß ab und stieß ihn zurück. Talbot verlor das Gleichgewicht und kippte nach hinten. Hart prallte er auf den Boden. Bevor er wieder auf die Füße kommen konnte, war Harper schon über ihm und schlug mit seiner rechten Faust zu.
Der Hieb traf Talbot am Hals. Ein höllischer Schmerz raste durch seinen Körper. Das gab Harper mächtigen Auftrieb. Er deckte den Killer mit brutalen Tritten ein. Jeder einzelne war qualvoll. Talbots Körper verwandelte sich in einen Herd des Schmerzes. Er biss die Zähne zusammen und kämpfte sich wieder hoch. Sogleich schlug Harper mit aller Kraft zu. Talbot tauchte unter dem gewaltigen Hieb weg und rammte ihm die Faust gegen die Brust. Der Mann brachte sich mit einem erschrockenen Satz in Sicherheit.
Bevor Talbot zum nächsten Schlag ausholen konnte, ging Harper wieder zum Angriff über. Mit einem gewaltigen Hieb versuchte er, das Brustbein des Gegners zu zertrümmern. Talbot hatte große Mühe, diesem Treffer zu entgehen. Dabei verlagerte er sein Gewicht so ungeschickt, dass er die Balance verlor und abermals zu Boden ging.
Harper triumphierte. Er dachte, nun könne er seinen Gegner fertigmachen. Mit einem raschen Sprung war er bei Talbot und fuhr ihm wieder an die Kehle. Der gnadenlose Druck nahm dem Killer die Luft. Ihre Augen begegneten sich. Harpers Augen flackerten unruhig und glühten vor Hass. Noch nie zuvor hatte Talbot so unverhüllte Raserei gesehen. Gleichzeitig wusste er auch, dass sich der Mann niemals ergeben würde. Er hätte gekämpft bis zum letzten Blutstropfen. Und genau das tat Talbot auch.
Er verpasste seinem Gegner einen harten Stoß mit dem Knie in die Nieren. Sekundenlang war Harper irritiert. Diese Zeitspanne benutzte Talbot dazu, den Mann von sich herunterzustoßen und sich auf ihn zu wälzen. Es war ein verzweifelter, grotesker Kampf, der Talbot sinnloser erschien, je länger er dauerte. Harper lag auf dem Rücken und versuchte vergeblich, den Mann über sich abzuschütteln.
Talbot keuchte. Blindlings schlug er zu, rammte die Fäuste in das Gesicht seines Gegners. Harper wehrte sich, so gut er konnte, doch er hatte keine Chance. Talbots Bewegungen blieben rasch, gewandt und wohlüberlegt. Nur seine Mimik wirkte ernst und konzentriert. Mit der Faust schlug er seinem Gegner mitten ins Gesicht. Harper zuckte zurück. Gleichzeitig schnellte Talbot herum und traf den Kerl mit ausgestrecktem Fuß seitlich in die Leisten.
Dann sprang er auf ihn zu. Mit einem festen Griff packte er Harpers Kopf und drehte ihn mit einer ruckartigen Bewegung nach links. Ein knackendes Geräusch ertönte, als das Genick brach. Kraftlos sackte der Mann zusammen. Talbot warf den Mann zu Boden, verließ die Zelle und trat auf den Gang hinaus. Abermals fiel ein Schuss. Laute Schreie ertönten. Um ihn herum herrschte ein ziemliches Durcheinander. Die Akustik war so schlecht, dass Talbot nicht ein Wort verstehen konnte. Es hallte und dröhnte in dem großen Gebäude. Ein Geräusch überlagerte das andere.
Talbot hatte nur eine ungefähre Ahnung davon, wie der Ausbruch ablaufen sollte. Aber er war davon überzeugt, dass Amendola im großen Maßstab dachte. Alle Gefangenen waren in Bewegung. Sie würden es lediglich bis zum Tor schaffen. Amendola konnte nur wenige Wärter in der Tasche haben. Die anderen würden sofort schießen, sobald der erste Gefangene auf dem Hof erschien. Sie führten sich selbst zur Schlachtbank.
Aber warum ertönte keine Alarmsirene?
Sie hätte längst gellen müssen, als die Türen geöffnet wurden. Es sei denn, Amendola hatte irgendjemanden im Wachturm gekauft. Dann waren alle Sicherheitssysteme ausgeschaltet. Der Turm wurde nach dem letzten Ausbruchsversuch gebaut. Er verfügte über einen eigenen Stromgenerator und ein eigenes Frischluftsystem.
Es gab lediglich eine Tür. Ihr elektronisch gesichertes Schloss konnte nur im Kontrollraum des Turms geöffnet werden. Keiner kam ohne die Zustimmung des Mannes dort rein. Von seinen Fenstern konnte er den Hof überblicken. Auf den Monitoren konnte er die Zellen, die Flure, einfach alles kontrollieren. Wer den Turm unter Kontrolle hatte, der kontrollierte das ganze Gefängnis. Und Amendola hatte offenbar den Mann im Turm unter Kontrolle.
Jason Bishop betrachtete die Monitore. Ein zufriedenes Lächeln huschte über sein Gesicht. Amendolas Plan hatte ausgezeichnet funktioniert. Insgeheim malte er sich schon aus, was er mit dem ganzen Geld machen würde, dass er bekommen würde. Er könnte endlich die Raten für das Haus abbezahlen, und seiner Frau die Halskette kaufen, die sich schon so lange wünschte. Vielleicht würde auch noch genug Geld für einen neuen Wagen übrigbleiben. Sein VW war schon ziemlich alt. Es grenzte an ein Wunder, dass er überhaupt noch fuhr.
Doch plötzlich hörte er ein scharrendes Geräusch hinter seinem Rücken. Er fuhr herum. Bill Flanary erwachte aus seiner Bewusstlosigkeit.
„Was … was ist denn los?“ stammelte er. „Was hast du mir in den Kaffee getan?“
Taumelnd kam er auf die Füße und blickte zu den Monitoren hinüber.
„Scheiße, was geht denn hier vor?“
Bishop zog seine Pistole aus dem Holster. „Warum bist du nicht bewusstlos geblieben? Jetzt muss ich dich ...“
„Du Schwein“, keuchte Flanary.
Er schätzte blitzschnell die Entfernung ab. Höchstens drei Schritte. Er sprang aus seiner kauernden Stellung hoch und rannte in zwei langen Sätzen auf Bishop zu. Dieser wich einen halben Schritt zurück und betätigte den Abzug seiner Waffe. Aber er reagierte nicht schnell genug. Flanary war schon heran, schlug Bishops Arm nach oben und rammte ihm gleichzeitig die rechte Faust in die Magengrube.
Bishop brach zusammen. Der Schuss ging in die Decke. Flanary gab ihm keine Gelegenheit, ein zweites Mal abzudrücken. Er warf sich über Bishop, packte mit beiden Händen zu und schlug dessen rechte Hand auf den Boden. Mit einem lauten Aufschrei ließ er die Waffe los. Bishops Wut verlieh ihm ungeheure Kräfte. Es gelang ihm, seinen Gegner abzuschütteln. Flanary warf sich zur Seite und versuchte, vor Bishop an die Pistole heranzukommen.
Aber er stieß sie nur mit den Fingerspitzen an und sie rutschte noch weiter weg. Bishop packte Flanary brutal am Hals und schleuderte ihn zurück. Dann sprang er auf die Waffe zu. Er riss sie an sich, kam auf die Füße und drehte sich zu Flanary herum. Seine Augen funkelten in wildem Triumph. Er hätte sofort abdrücken können, doch er kostete diesen Moment aus und krümmte ganz langsam den Finger am Abzug.
Flanary war für einen Augenblick wie gelähmt. Er starrte in die auf ihn gerichtete Pistolenmündung, und sein Herz schien auszusetzen. Doch dann ging ein Ruck durch seinen Körper. Mit dem Mut der Verzweiflung schnellte er auf Bishop zu, um ihm mit dem Fuß die Waffe aus der Hand zu treten. Doch der andere Mann wich unwillkürlich zurück. Eine Reflexbewegung. Abermals löste sich ein Schuss.
Die Kugel bohrte sich neben Flanary in den Boden. Bishops Gesicht verzerrte sich.
„Noch einen Schritt, und ich leg‘ dich um!“ brüllte er. Seine Stimme klang schrill. Sie überschlug sich.
„Was für eine Scheiße läuft hier eigentlich?“, wollte Flanary wissen. „Bist du jetzt total durchgeknallt?“
„Im Gegenteil, ich weiß genau, was ich tue. Ich verhelfe Amendola zur Flucht.“
„Das kannst du nicht tun“, entgegnete Flanary. „Du bist Gefängniswärter. Vergiss das nicht. Willst du dich etwa auf die Seite von diesem Abschaum schlagen?“
Bishop verlor vollkommen die Kontrolle über sich. Da war nur noch der Trieb, unbeschadet aus dieser Situation herauszukommen.
„Jason, sagte Flanary ruhig. „Lass dich nicht zu solchen Dummheiten hinreißen.“
Doch der Mann hörte ihm nicht zu. Seine Kehle war wie ausgetrocknet. Er zitterte immer stärker, doch seine Waffe zeigte unverwandt auf Flanary.
„Ich muss hier raus“, sagte er rau.
„Was glaubst du, wie weit du kommst?“ fragte Flanary. Seine Gelassenheit ließ Bishop einen Schritt zurückweichen. Er spürte, dass er mit den Beinen einen Stuhl berührte.
„Sehr weit. Amendola hat mir eine Menge Geld versprochen, wenn ich ihm bei der Flucht helfe.“
„Das ist doch verrückt. Der Kerl wird dich umlegen.“
„Nein, wird er nicht, denn schließlich verdankt er mir seine Freiheit.“
„Du begehst einen verhängnisvollen Irrtum.“
Flanary sprach noch immer ruhig und vermied es, eine Bewegung zu machen, die Bishop als Angriff werten konnte.
„Das wirst du niemals schaffen. Die Polizei wird dich jagen.“
Bishop winkte mit der Waffe. Er fühlte, dass er wütend wurde, aber er tat nichts, um dieses Gefühl zu unterdrücken. Sein Zorn würde die Furcht in ihm abtöten.
„Quatsch keinen Blödsinn.“
„Das ist die Wahrheit.“
„Interessiert mich nicht. Los, dreh‘ dich um. Ich werde dir eins über den Schädel ziehen und verschwinden. Dich wird man dann nicht zur Verantwortung ziehen.“
„Und was willst du tun, wenn ich mich weigere?“
Bishop zog die Augenbrauen zusammen. „Dann werde ich dich erschießen. Davor kann dich auch deine Uniform nicht bewahren.“
„Das stimmt“, gab Flanary zu. „Aber was würdest du gewinnen? Früher oder später würde man dich festnehmen.“
Bishop versuchte, über dieses Argument nachzudenken, aber es gelang ihm nicht. Er war nicht in der Lage, einen bestimmten Gedanken zu verfolgen. Alles, was ihn interessierte, war, lebend aus diesem Gefängnis herauszukommen.
„Ich warte nicht“, sagte er drohend.
„Amendola wird dich töten, verlass‘ dich drauf.“
Bishop zielte und jagte vor Flanarys Füßen eine Kugel in den Boden. Er sah, wie der Mann erschrocken zurückwich, und lachte hässlich.
„Dreh‘ dich um!“ schrie er.
Flanary blickte auf, und Bishop hatte das Gefühl, dass sein Kollege irgendetwas hinter ihm betrachtete. Ruckartig fuhr er herum. Im gleichen Augenblick wusste er, dass er einen Fehler begangen hatte. Er hob die Waffe, doch da prallte Flanary gegen ihn und warf ihn zu Boden. Bishop schrie und wälzte sich zur Seite. Er schoss, ohne zu zielen. Er traf nur die Decke. Flanary warf sich über ihn und drückte die Waffe zu Boden.
Bishop kämpfte verzweifelt gegen das Körpergewicht an, doch es gelang ihm nicht, sich freizumachen. Flanary entwand ihm die Waffe und sprang zur Seite. Im Liegen feuerte er zwei Schüsse auf Bishop ab. Der beißende Geruch nach Kordit und heißem Metall stieg ihm in die Nase. Er hatte schon seit einiger Zeit nicht mehr geschossen, aber nach dem ersten Rückstoß war er sich seiner Treffsicherheit wieder gewiss.
Er hatte auf das rechte Bein seines Kollegen gezielt, denn er wollte ihn nicht töten. Schließlich hatten sie einmal auf der selben Seite gestanden. Bishop stieß einen Schrei aus, als er getroffen wurde. Doch er gab nicht auf. Der Schock machte ihn relativ unempfindlich für die Schmerzen. Humpelnd näherte er sich Flanary. Abermals schoss der Wärter.
Die Kugel traf Bishops Oberarm. Durch die Wucht wurde er herumgerissen und stürzte zu Boden. Er versuchte, sich aufzurichten. Flanary drückte noch einmal ab. Die Kugel traf ihn ins Auge. Er kippte nach hinten und blieb reglos liegen. Eine Blutlache bildete sich unter seinem Körper.
Flanary kam langsam auf die Füße. Dabei fiel sein Blick auf die Bildschirme. Was er sah, erschreckte ihn dermaßen, dass er mitten in der Bewegung innehielt und den Schmerz kaum empfand, den seine gepeinigten Muskeln ausstrahlten. Sämtliche Zellentüren standen offen und die die Häftlinge liefen frei im Gefängnis herum. Hier ging es nicht nur um die Flucht eines einzelnen Gefangen.
Das war ein Massenausbruch!
Sein Verstand weigerte sich minutenlang, das Unfassbare zu begreifen. Er glaubte zu träumen und stützte sich auf der Stuhllehne ab. Es bedurfte nur dieser einen Bewegung, um ihn davon zu überzeugen, dass er sich in der Wirklichkeit befand. Sein ganzer Körper schmerzte so entsetzlich, dass er beinahe das Bewusstsein verloren hätte.
Er biss die Zähne zusammen und überwand den Schmerz. Stöhnend hielt sich an dem Stuhl fest, um nicht wieder umzufallen. Taumelnd bewegte er sich auf die Bildschirme zu. Dort blieb er stehen und blickte auf das Durcheinander, das im Gefängnis herrschte. Er drehte sich um, und sah Bishop regungslos auf dem Boden liegen.
Allmählich kehrte das Gefühl der Verantwortung zurück. Er wurde sich bewusst, dass jetzt alles von ihm abhing. Er streckte die Hand aus und drückte auf einen Knopf. Im selben Augenblick begann die Alarmsirene zu heulen.
Während Talbot weiter nichts zu tun hatte, als einen Fuß vor den anderen zu setzen und so schnell wie möglich voranzukommen, zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er ohne großes Aufsehen aus dem Gefängnis fliehen konnte. In sämtlichen Stockwerken hatten die Gefangenen ihre Zellen verlassen. Lärm herrschte. Die Insassen des Westblocks begannen zu randalieren. Von unten waren scharfe Kommandos zu hören. Mehrmals fielen Schüsse. Plötzlich ertönte die Alarmsirene. Die Jagd auf die entflohenen Gefangenen begann.
Talbot wusste, was das bedeutete. Amendolas Plan von einer lautlosen Flucht war gescheitert. Jetzt musste er sich etwas anderes ausdenken, um unbemerkt aus Fishkill verschwinden zu können. Aber Talbot war davon überzeugt, dass Amendola einen Ersatzplan hatte. Vermutlich würde er das allgemeine Durcheinander nutzen, um sich aus dem Staub zu machen.
Unangefochten gelangte Talbot bis an die Schleuse, die zu den Treppen führte. Die Tür stand offen. Der Glaskasten war nicht besetzt. Fast alle Häftlinge suchten nach einem Weg, wie sie aus dem Gefängnis entkommen konnten. Andere schienen der Sache nicht zu trauen. Sie blieben in ihren Zellen und beobachteten teils irritiert, teils ängstlich, was sich vor ihren Augen abspielte.
Nachdem er die Schleuse passiert hatte, entdeckte Talbot zwei Wärter. Der eine war tot, der andere lehnte an der Wand. Seine Hände hielten etwas, das wie eine Masse von schmutzigen roten und weißen Schlangen aussah. Als er näherkam, erkannte er, dass es die Eingeweide des Mannes waren. Die Häftlinge hatten ihm den Leib aufgeschlitzt, die Eingeweide herausgerissen und ihn dann gehetzt. Sein Körper war voller Messerstiche. Aber er lebte noch.
Talbot musste an einen Vorfall denken, der zehn Jahre zurücklag. Damals sollte er im Auftrag des russischen Geheimdienstes einen Dissidenten eliminieren. Er war neu in dem Geschäft und hatte nicht allzu viel Erfahrung. Talbot überraschte den Dissidenten in seiner Wohnung und schoss auf ihn. Der Mann war zusammengesackt, hatte die Hände auf den Bauch gepresst und schrie. Talbot hörte sich das etwa eine Minute an, dann drückte er noch einmal ab. Er hatte diesen Vorfall nie vergessen. In manchen Nächten träumte er sogar davon und wachte jedes Mal schweißgebadet auf.
Der Wärter blickte Talbot aus großen Augen an. Er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Seine Lippen zitterten. Offenbar wollte er noch etwas sagen. Ein heiseres Krächzen war alles, was er von sich geben konnte, dann rutschte er zur Seite und starb. Talbot presste die Lippen aufeinander. Nun würde das Wachpersonal vermutlich jede Nachsicht außer Acht lassen. Gereizt durch den Verlust zwei ihrer Männer, würden sie wahrscheinlich auf eine Gefangennahme der Häftlinge verzichten und stattdessen auf sie schießen.
Dieser Gedanke stachelte ihn zu größerer Eile an. Hastig lief er weiter zu der Treppe, die ins Erdgeschoss führte. Schreie ertönten, dann wurde wieder geschossen. Einige Häftlinge begegneten ihm. Einer blutete an der Schulter.
„Ihr verdammten Arschlöcher!“ ertönte die Stimme eines Wärters. „Euch mach‘ ich fertig!“
Talbot erkannte den Mann sofort wieder. Vor einigen Wochen war er mit ihm aneinandergeraten. Seine Gesichtsfarbe hatte sich nicht wesentlich verändert. Sie war immer noch rot. Auch seine Stimmung hatte sich nicht verbessert, was angesichts der Ereignisse jedoch verständlich war. Keiner der Häftlinge achtete auf den Mann.
Er riss seine Waffe hervor und feuerte. Zwei Mal hintereinander. Flammen, Metall und Rauch zuckten aus dem Lauf. Die Kugeln rissen einen Gefangenen von den Beinen. Die anderen flüchteten erschrocken und in Panik die Treppe hinunter. Talbot wollte ihnen folgen, doch im nächsten Moment schlug eine Kugel dich neben ihm in die Wand. Erschrocken wirbelte er herum.
Der Wärter jagte eine Kugel nach der anderen aus seiner Dienstwaffe. Sein Haar hing ihm wirr in die Stirn. Noch ehe Talbot sich in Sicherheit bringen konnte, spürte er ein scharfes, stechendes Brennen an der Schulter, das sofort einem heißen Schmerz Platz machte. Er war getroffen. Ein Streifschuss.
Abermals legte der Wärter auf ihn an, doch die Pistole gab nur noch ein leises Klicken von sich. Leergeschossen. Sofort versuchte der Wärter nachzuladen. Er zog das Magazin heraus, warf es auf den Boden und schob ein volles in die Pistole. Dann lud er durch. Doch es gelang ihm nicht mehr, die Waffe hochzureißen.
Talbot sprang auf ihn zu. Die Wucht des Zusammenpralls schleuderte beide Männer zu Boden. Talbot riss ihm die Waffe aus der Hand und zielte auf den Wärter. Sein Gesicht wurde noch eine Spur röter und ein feiner Speichelfaden lief aus seinem Mundwinkel.
„Das schafft ihr nie“, keuchte er.
„Schnauze“, befahl Talbot und verpasste ihm einen harten Faustschlag an die Schläfe. Der Mann verlor sofort das Bewusstsein. Natürlich hätte Talbot ihn töten können, doch das wäre Munitionsverschwendung gewesen. Vielleicht kam er in eine Situation, in der er jede einzelne Kugel brauchen würde. Zumindest besaß er jetzt eine geladene Waffe. Und das war ein entscheidender Vorteil.
Talbot wandte sich wieder der Treppe zu. Er musste hier raus, und zwar so schnell wie möglich. Am Leben bleiben wollte er. Nur darum ging es ihm in diesem Augenblick. Die Stufen nahm er mit wenigen Sätzen, und Sekunden später befand er sich schon in dem darunterliegenden Stockwerk. Überall war es inzwischen lebendig geworden. Aus der entgegengesetzten Richtung kamen ihm drei Wärter entgegen. Doch sie beachteten ihn gar nicht. Von allen Seiten waren die Geräusche rennender Männer zu vernehmen. Kommandos tönten durch die Gänge. Die Alarmsirene heulte durchdringend. Ihr an- und abschwellender Ton ging Talbot allmählich auf die Nerven.
In einiger Entfernung sah er fünf Häftlinge, die einen Wärter umkreisten. Der Mann hatte seine Waffe gezogen, doch er kam nicht mehr dazu, sie abzufeuern. Zwei Häftlinge stürzten sich auf ihn und rissen ihm die Pistole aus den Händen. Es gelang ihm, einige harte Schläge anzubringen, doch zu mehr reichte es im Moment nicht. Die drei anderen Häftlinge griffen in den Kampf ein. Keuchend und schreiend wälzten sie sich auf dem Boden.
Einmal gelang es dem Wärter, aus dem Knäuel hervorzukommen, doch er schaffte es nur für wenige Augenblicke. Dann fiel die Meute schon wieder über ihn her. Seine Kleidung hing in Fetzen von seinem Körper. Sein Gesicht war von Platzwunden, Rissen und Hautabschürfungen gezeichnet. Noch einmal stellte er sich zum Kampf. Seine Fäuste schlugen zwei Häftlinge zur Seite, doch dann hingen die drei anderen wie Kletten an ihm. Der Wärter musste zu Boden. Pausenlos prasselten Faustschläge auf ihn ein. Als die Häftlinge von ihm abließen, war der Mann tot.
Talbot kümmerte sich nicht weiter darum. Er wandte sich der nächsten Treppe zu und lief die Stufen hinab ins Erdgeschoss. Auch dort wurde gekämpft. Von überall tönten Rufe und Schreie.
„Immer ruhig!“
Genauer zielen!“
„Das ist doch nur ein Kratzer. Kümmere dich nachher darum!“
„Verdammt noch mal Gary! Schießt du auf die Rocky Mountains?“
„Schießt auf die Anführer!“
Ein Wärter rannte an Talbot vorbei und wollte sich in einer Nische in Sicherheit bringen. Zu spät erkannte er, dass das Versteck schon von einem Gegner besetzt war. Der Häftling wich hastig zur Seite und schlug mit beiden Fäusten nach dem Mann. Der überraschte Wärter ließ seine Waffe fallen. Als er sich danach bückte, schlug der Häftling abermals zu. Der Wärter war als Kämpfer völlig unerfahren, während der Häftling wie ein rasendes Tier über ihn herfiel.
Sofort wurde der Uniformierte in die Verteidigung gedrängt. Ein Faustschlag seines Gegners schickte ihn zu Boden. Der Häftling kniete sich auf ihn und versuchte, in den Besitz der Pistole zu gelangen, die ein Stück von ihm entfernt lag. Verzweifelt bäumte sich der Wärter auf. Schließlich bekam er den rechten Arm frei. Wütend stieß er nach dem Häftling, der jedoch mühelos zurückwich.
Plötzlich ließ sich der Mann nach vorne fallen. Der Wärter schrie. Als sich der Häftling wieder aufrichtete, hielt er die Pistole in der Hand. Er kniete jetzt auf seinem Gegner. Der Wärter schaute in die dunkle Mündung, die auf sein Gesicht zeigte. Dann löste sich der Schuss. Die Kugel drang dem Mann genau zwischen die Augen und verwandelte sein Gesicht in eine blutige Masse.
Befriedigt richtete sich der Häftling auf. Er verbarg sich in der Nische und begann ebenfalls auf die Wärter zu feuern. Talbot blickte sich um. Überall sah er rennende und feuernde Männer. Mehrmals erklangen Schreie. Das Gefängnis verwandelte sich zusehends in ein Kriegsgebiet.
Wenn das Wachpersonal nicht Gefahr laufen wollte, von den bewaffneten Häftlingen getötet zu werden, mussten sie sich immer weiter zurückziehen. Talbot schätzte, dass sie dieser Übermacht höchstens noch fünf Minuten standhalten konnten. Auch wenn es ihnen gelang, einige der Gegner auszuschalten, so wurden diese Verluste doch mühelos ersetzt.
Talbot sah in einiger Entfernung einen Wärter vorbeirennen. Sofort wurde auf ihn geschossen. Der Mann schwankte und wollte sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen, als eine Kugel seine Brust traf. Einen Augenblick sah Talbot das schmerzverzerrte Gesicht des Mannes, dann sank er zusammen. Zwei Wärter erschienen hinter einer Ecke und liefen durch den aufpeitschenden Kugelhagel zu dem Schwerverletzten.
Wie durch ein Wunder wurde keiner von ihnen getroffen. Sie brachten den Mann in Sicherheit und nahmen den Beschuss wieder auf. Aber es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis ihnen die Munition ausging. Rücksichtslos drangen die Häftlinge weiter vor. Einige hatten sich von der Seite herangearbeitet und feuerten auf die ungeschützten Wärter. Die Verluste unter den Männern wurden immer größer.
Viele von ihnen wurden in den Rücken oder in die Hüfte getroffen. Wenn sie versuchten, das Feuer zu erwidern, waren sie sich gegenseitig im Weg. Ein junger Wärter begann zu taumeln und ließ die Waffe fallen. Eine Kugel hatte seinen Brustkorb dicht unter den Rippen durchschlagen. Er stöhnte laut und kümmerte sich nicht darum, dass er ein gutes Ziel abgab.
„Los, in Deckung!“ rief einer seiner Kollegen.
Bevor der Mann reagieren konnte, trafen ihn noch einige Schüsse. Er ließ die Waffe fallen und presste beide Hände gegen seinen Bauch. Blut sickerte zwischen seinen Fingern hindurch. Er kippte zur Seite und blieb liegen.
„Sie wollen uns überrennen!“ schrie einer der Wärter.
Das heftige Abwehrfeuer des Wachpersonals brachte die Häftlinge kurzfristig zum Stehen. Doch die Gefangenen waren offenbar entschlossen, den Kampf jetzt schnell zu beenden. Immer mehr Häftlinge tauchten auf und griffen in die Auseinandersetzung ein. Die Wärter schossen blindlings. Zum Zielen hatten sie keine Zeit mehr.
Einige Häftlinge brachen zusammen. Doch die uniformierten Männer erkannten, dass sie gegen die Übermacht keine Chance hatten. Sie verschwanden so schnell aus der Nähe des Durchgangs, dass es fast so aussah, als seien sie durch einen Zaubertrick unsichtbar geworden. Die Häftlinge schwärmten aus. Sobald sie einen Wärter entdeckten, eröffneten sie sofort das Feuer.
Von überall her ertönten Schreie und Schüsse. Talbot konnte sich gerade noch zur Seite werfen, um einer Kugel zu entgehen. Er wälzte sich über den Boden und wollte das Feuer erwidern. Doch dann überlegte er es sich anders. Auf der gegenüberliegenden Seite entdeckte er eine Tür. Er sprang auf, rannte darauf zu und stieß sie auf. Er gelangte in einen Raum voller Betten und Schränke. Offenbar handelte es sich um ein Lager. An der linken hinteren Wand gab es eine weitere Tür.
Er wusste nicht, wohin sie führte. Dafür kannte er sich in Fishkill nicht gut genug aus. Aber dort wurde wenigstens nicht gekämpft. Zumindest hörte er keine dementsprechenden Geräusche. Und vielleicht gab es hinter der Tür einen ungefährlicheren Weg in die Freiheit. Gerade als er darauf zuging, zwang ihn eine Serie von Schüssen in Deckung. Talbot warf sich hinter einen Schrank.
Er war deshalb nicht getroffen wurden, weil er schnell auf die Gefahr reagiert hatte. Zudem schienen die Gegner, die ihn unter Feuer genommen hatten, keine besonders guten Schützen zu sein. Aber Talbot konnte sich nicht darauf verlassen, dass sie ihn noch einmal verfehlten. Seiner Schätzung nach musste es sich um mindestens zwei Gegner handeln. Vorsichtig schob er seinen Kopf hinter dem Schrank hervor, doch die Schützen waren nirgendwo zu sehen, aber er hatte eine ungefähre Ahnung, wo sie sich versteckt hielten.
Plötzlich jagten wieder Kugeln durch den Raum, gruben sich tief in den Bodenbelag oder in den Schrank. Holzsplitter flogen durch die Luft. Talbot fühlte mit brennendem Schmerz, dass einer seine Wange getroffen hatte. Vorsichtig zog er ihn heraus. Abermals ertönten Schüsse.
Talbot umklammerte den Kolben seiner Waffe, aber er konnte es nicht wagen, einen Blick aus seiner Deckung hervorzuwerfen. Von den Angreifern war im Augenblick nichts zu sehen. Wieder einmal war er in eine Falle gelaufen, dachte er bitter. Doch woher hätte er wissen sollen, dass sich jemand hier verborgen hielt?
Zwei Kugeln schlugen einen halben Meter neben ihm ein. Er sprang auf, feuerte einen Schuss ab und versuchte, eine neue Deckung zu finden. Seine Gegner reagierten nicht schnell genug. Zwar schossen sie, aber keine Kugel traf. Er warf sich hinter einen anderen Schrank und blickte kurz aus seiner Deckung. Als er im Hintergrund des Raumes eine schattenhafte Bewegung erkannte, zielte er und feuerte. Ein gellender Schrei ertönte. Ein Körper polterte auf den Boden.
Sofort flogen einige Kugeln an seinem Kopf vorbei und schlugen in die rückwärtige Wand. Talbot wusste, dass er nur eine Chance hatte, wenn er immer wieder seine Deckung wechselte. Er sprang auf und lief geduckt durch den Raum. Zwei Schüsse veranlassten ihn zu einem weiten Sprung. Er landete hinter einem Bettgestell. Es bot zwar kaum Deckung, aber das Mündungsfeuer hatte ihm den Standort des Schützen verraten.
Trotzdem musste er noch näher an ihn herankommen. Die Strecke ohne Deckung zurückzulegen, wäre reiner Selbstmord gewesen. Kein Mann konnte so schlecht schießen, dass er ihn nicht erwischt hätte. Talbot drehte sich zur Seite. In der nächsten Sekunde wurde ein weiterer Schuss auf ihn abgefeuert. Die Kugel verfehlte ihn nur um wenige Zentimeter. Sein Gegner hatte sich allmählich auf ihn eingeschossen. Es wurde höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen.
Er feuerte einen Schuss ab, sprang hoch und rannte zur nächsten Deckungsmöglichkeit. Den letzten Meter legte er mit einem gewaltigen Hechtsprung zurück. Er landete hart auf dem Boden und rutschte hinter einen niedrigen Schrank. Nun konnte ihn der Gegner nicht mehr sehen. Talbot lauschte. Auf der anderen Seite rührte sich nichts. Der Mann schien abzuwarten.
Talbot sprang auf, stieß einen lauten Schrei aus und rannte im Zickzack auf ihn zu. Der Mann tauchte aus seiner Deckung empor. Er hob seine Pistole und zielte auf Talbot. Es gelang ihm jedoch nicht mehr, den Abzug zu betätigen. Die Kugel aus Talbots Waffe traf ihn genau zwischen die Augen. Es gab ein dumpfes Geräusch, als er schwer auf dem Boden aufschlug.
Talbot ließ die Pistole sinken und betrachtete den Toten. Der Mann trug eine Uniform. Auch der zweite Schütze gehörte zum Wachpersonal. Warum hatten sich die beiden Männer hier versteckt? Gehörten sie vielleicht zu den Leuten, die von Amendola bestochen worden waren und abwarten wollten, wie sich die Lage entwickelt?
Talbot zog die Augenbrauen zusammen. Hoffentlich gab es nicht noch mehr unangenehme Überraschungen. Er zog das Magazin aus der Pistole, um nachzusehen, wie viele Kugeln er noch zur Verfügung hatte. Keine. Das Magazin war leergeschossen. Er überprüfte die Waffen der Wärter, aber nur eine enthielt noch zwei Kugeln.
Talbot wandte sich zur Tür und lauschte. Er hörte weder Schritte noch Stimmen. Seine Hand näherte sich dem Knauf. Er drehte ihn langsam herum, öffnete die Tür einen Spaltbreit und schaute hindurch. Vor ihm lag ein hellerleuchteter Gang. Menschen konnte er nicht entdecken.
In dem Moment, als die Alarmsirene ertönte, wusste Greg Anderson, dass das widrige Schicksal noch nicht alle seine Karten ausgespielt hatte. Eigentlich wollte er schon vor drei Stunden zu Hause sein, doch es gab noch eine Menge Arbeit, die erst erledigt werden musste. Nun war es zu spät. Er konnte lediglich feststellen, dass ihn sein gut funktionierender Instinkt nicht betrogen hatte.
Sämtliche Gefühlsregungen der vergangen Tage waren ein Hohngelächter im Vergleich zu dem, was er in dieser Sekunde empfand. Sein Herz schlug laut in der Brust wie eine Begleitmusik zu dem Wahnsinn verzweifelter Schreie, die von draußen zu ihm hereindrangen. Dass ein oder zwei Gefangene einen Fluchtversuch unternehmen würden, damit hatte er immer gerechnet, aber ein Massenausbruch …
Wie konnte das nur passieren?
Dieses Gefängnis gehörte zu den modernsten in ganz Amerika. Erst vor einem Jahr waren neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, um Ausbruchsversuche zu verhindern. Man hatte sogar einen neuen Wachturm errichtet, von dem aus alles kontrolliert werden konnte. Und trotzdem war es den Häftlingen gelungen, einen Aufstand anzuzetteln.
Wie war das nur möglich?
Je länger er darüber nachdachte, desto erschreckender wurde die Antwort, die er auf seine Frage bekam. Die Gefangenen hatten Unterstützung. Und zwar von einigen Wärtern. Das war die einzig mögliche Erklärung. Aber was sollte er jetzt tun? Wem konnte er noch trauen?
Er hatte viel zu wenig Leute, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Und bis die Verstärkung aus den umliegenden Orten eintraf, konnten gut und gerne zehn bis zwanzig Minuten vergehen. Die Häftlinge hatten also genug Zeit, um Fishkill in ein Chaos zu verwandeln. Anderson wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn.
Ihm wurde bewusst, dass er einen Fehler begangen hatte. Wenn es zu Unruhen in diesem Gefängnis kam, konnte sich das auf seine Karriere ausgesprochen nachteilig auswirken. Er würde dafür büßen müssen. Bevor er noch weiter darüber nachdenken konnte, wurde die Tür von donnernden Schlägen erschüttert. Er hatte zwar abgeschlossen, doch wie lange konnte sie einem Ansturm standhalten?
Anderson fühlte plötzlich eine eisige Kälte sein Rückgrat entlangkriechen. Abermals krachten Schläge gegen die Tür. Sie flog auf und acht Häftlinge standen im Rahmen. Einige trugen Schusswaffen. Er kannte ihre Namen nicht, aber ihre Gesichter waren ihm vertraut. Und er sah die Mordlust in ihren Augen, als sie langsam auf ihn zukamen.
„Schaut mal, wen wir da haben“, sagte der Anführer höhnisch. „Wenn das nicht unser lieber Direktor ist?“
„Ja, genau“, erwiderte ein anderer. „Verkriecht sich hier, der feige Dreckskerl.“
„Vielleicht scheißt er sich gerade vor Angst in die Hose“, vermutete ein Dritter.
„Das erklärt auch diesen unangenehmen Geruch“, meinte der Anführer.
Er war ein untersetzter Kerl mit toten Haaren und einer Narbe auf der rechten Wange. Als er grinste, sah Anderson ein paar Zähne. Aber es waren wohl nur die Überreste von den zahlreichen Schlägereien, die der Mann mit Sicherheit schon hinter sich hatte. In seiner Hand hielt er eine Glock-22-Pistole.
Anderson hatte sich vom ersten Schrecken erholt. Er begann wieder zu überlegen. Die Männer machten einen unentschlossenen Eindruck. Trotz ihres leichten Sieges schien sie nicht zu wissen, was sie mit ihm anfangen sollten.
Anderson vermied es, die Waffen seiner Gegner anzusehen. Die Männer waren von einer Hysterie befallen, die sie jeden Augenblick zum Abdrücken veranlassen konnte. Dann, dachte Anderson düster, würde er blutüberströmt auf dem Boden liegen und einen qualvollen Tod sterben.
„Sie machen einen Fehler“, sagte er und erschrak gleichzeitig über den heiseren Klang seiner Stimme. Die Anstrengung, seine Lippen bewegen zu müssen, kostetet ihn eine unendliche Mühe.
„Ach ja?“ erwiderte der Anführer grinsend.
„Sie schätzen Ihre Lage falsch ein. Es dauert nicht mehr lange, bis die Verstärkung eintrifft, und dann ...“
„Da erzählst du uns nichts Neues“, knurrte der Mann. „Du willst nur Zeit schinden.“
„Ich will Ihnen klarmachen, dass Sie nichts gewinnen, wenn Sie mich erschießen. Aber wenn Sie jetzt aufgeben, dann werde ich mein Möglichstes tun, um Ihnen zu helfen. Ich könnte beispielsweise dafür sorgen, dass Ihre Haftbedingungen erleichtert werden.“
Der Anführer richtete seine Pistole genau auf Andersons Gesicht.
„Sonst hast du nichts anzubieten?“
„Ich verstehe nicht ...“
„Erleichterte Haftbedingungen. Das soll wohl ein Witz sein?“
Anderson presste die Lippen zusammen und verwünschte seine Unvorsichtigkeit. Wenn er nur etwas Zeit gewinnen konnte, bis Verstärkung eintraf.
„Was immer Sie auch vorhaben, die Polizei wird es nicht zulassen. Es gibt keine Möglichkeit, aus diesem Gefängnis zu entkommen.“
„Wirklich nicht?“ fragte der Anführer. Sein Finger lag am Abzug der Waffe. Und seine Augen drückten das aus, was Anderson befürchtete. Dieser Mann würde sofort schießen, wenn er eine falsche Bewegung machte.
„Nein. Man wird das Gefängnis von außen abriegeln und jeden töten, der einen Fluchtversuch unternimmt.“
„Und was schlägst du vor?“
„Sämtliche Häftlinge müssen sich ergeben. Dafür verspreche ich euch, dass ihr am Leben bleiben werdet.“
„Ein schönes Leben“, sagte einer der Männer verächtlich.
„Ist deine Ansprache beendet?“ wollte der Anführer wissen. Seine Stimme klang trügerisch sanft und angenehm.
Anderson nickte.
„Dann bin ich jetzt an der Reihe. Es ist uns scheißegal, was du tust und was nicht. Wir kommen hier raus. Auf die eine oder andere Art. Aber du wirst jetzt sterben.“
„Dafür wird man Sie töten.“
„Das mag schon sein, doch wir werden dafür sorgen, dass dein Tod ein dreckiger Tod wird. Was glaubst du, ist danach noch von dir übrig?“
„Nicht sehr viel, fürchte ich“, gab Anderson zu.
Die Augen des Anführers leuchteten auf. Anderson sah, wie die Waffe in seiner Hand zitterte. Noch nie hatte er dem Tod so unmittelbar gegenüber gestanden wie in diesem Augenblick. Er griff nach einem letzten verzweifelten Strohhalm.
„Was würden Sie tun, wenn ich Ihnen verspräche, Ihnen eine Gelegenheit zur Flucht zu geben?“ fragte er.
„Ich würde sagen, es ist ein verdammter Trick!“ rief der Anführer.
Ich könnte Tage reden, ohne das Misstrauen auszulöschen, das sich angesammelt hat, überlegte Anderson erschüttert. Sie würden ihn töten, egal, was er sagte oder tat. Diese Männer hatten nichts zu verlieren. Die meisten saßen hier in Fishkill eine lebenslange Haftstrafe ab. Andere waren zu zwanzig oder dreißig Jahren verurteilt worden.
„Wir sollten dem Schwein zuerst die Kniescheiben durchlöchern“, forderte einer der Männer.
„Genau“, stimmte ein anderer zu. „Als Nächstes kommen die Eier dran. Und dann schauen wir zu, wie er langsam verblutet.“
„Nein!“ Der Gefängnisdirektor starrte die Häftlinge entsetzt an. „Das … das könnt ihr nicht machen.“
„Los, komm her!“ befahl der Anführer. „Stell dich da hin.“
Anderson wusste, was als Nächstes passieren würde. Sein Tod war beschlossene Sache, egal, welche Versprechen er diesen Männern machte.
„Nun gut“, sagte er langsam.
Er tat so, als wollte er dieser Anordnung nachkommen, doch stattdessen warf er sich mit einem mächtigen Satz in Richtung seines Gegners. Im Grunde genommen wusste er, dass er keine Chance hatte, trotzdem wollte er sich nicht so ohne Weiteres geschlagen geben. Sein Plan war simpel. Er wollte dem Mann die Waffe entreißen und sich den Weg freischießen.
Krachend entlud sich die Pistole. Die Kugel bohrte sich in die Decke. Anderson umklammerte die Waffenhand des Mannes und drückte sie nach unten. Dann holte er mit der anderen Hand aus und schlug sie dem Häftling ins Gesicht. Er gab einen unartikulierten Laut von sich. Sein Körper bäumte sich auf. Verzweifelt versuchte er, Anderson von sich abzuschütteln. Sein Gegner war mindestens zehn Pfund schwerer als er.
Wieder schlug der Gefängnisdirektor zu. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die anderen Häftlinge dem Kampf tatenlos zugesehen, doch jetzt packten sie Anderson und zerrten ihn von dem Mann herunter. Fäuste schlugen auf ihn ein. Er bekam eine Schuhspitze in die Seite. Der Tritt nahm ihm den Atem. Keuchend schnappte er nach Luft, erinnerte an einen Fisch auf dem Trockenen. Sein Gesicht war angeschwollen. Blut rann ihm aus der Nase und sickerte als Rinnsal über Mund und Kinn. Langsam kam der Anführer wieder auf die Füße. Aus schmalen Augen musterte er Anderson, der von zwei Männern festgehalten wurde.
„Das hättest du nicht tun sollen“, sagte er. „Nun ist es aus mit dir.“
Anderson presste die Lippen fest gegeneinander. Verzweifelt suchte er nach einer Möglichkeit, um aus dieser Situation herauszukommen. Doch es sah verdammt schlecht aus. Der Rothaarige tat zwei schnelle Schritte und schlug Anderson die Faust in das aschfahle Gesicht. Der Gefängnisdirektor flog nach hinten und prallte hart auf den Boden.
„Packt ihn!“ sagte der Anführer zu den anderen. „Wir werden mit unserem Freund einen kleinen Spaziergang machen.“
Er grinste.
„In ein paar Minuten wirst du baumeln, du Drecksau. Dann bezahlst du für alles.“
Anderson antwortete nicht.
„Fesselt den Scheißkerl. Dann hängen wir ihn auf!“
Bevor Anderson sich rühren konnte, waren schon zwei Männer über ihm. Einer packte ihn am Haar und zog den Kopf soweit zurück, dass im Zimmer das Knacken von Halsknochen hörbar war. Ein anderer Häftling ging zum Fenster, riss die Gardinenschnur herunter und band Anderson die Hände auf den Rücken. Sie hielten ihn auf den Knien, während der grinsende Anführer systematisch auf ihn einschlug.
„Du hast mich wie ein wildes Tier in einen Käfig gesteckt.“
Er beugte sich vor und spuckte dem Mann ins Gesicht.
„Du hättest mich umbringen sollen. Dann sähe es jetzt besser für dich aus.“
Er richtete sich auf. Sein Lächeln war eine satanische Maske. Dann wandte er sich dem Schreibtisch zu, nahm den gläsernen Bilderrahmen und betrachtete das darin enthaltene Foto, auf dem eine blonde Frau und ein dunkelhaariges, etwa sechs Jahre altes Mädchen zu sehen waren.
„Deine Familie?“ fragte er.
Anderson schwieg.
„Wie wär‘s, wenn wir ihr einen kleinen Besuch abstatten würden?“ Er deutete mit dem ausgestreckten Arm auf einen seiner Männer. „Billy da drüben hat schon seit elf Jahren keine Frau mehr gefickt. Ich glaube, er ist es leid, seinen Schwanz dauernd in irgendwelche behaarten Ärsche stecken zu müssen. Er wäre bestimmt ganz scharf auf deine Frau.“
Der Anführer grinste.
„Und für deine Tochter finden wir auch eine Verwendung. Vielleicht verkaufen wir sie an das dreckigste Bordell der Welt. Dort wird sie von so vielen Männern gefickt, dass sie sich wünscht, tot zu sein“
Anderson stemmte sich wie besessen gegen die Hände, die ihn am Boden hielten.
„Gütiger Gott, nein!“ schrie er. „Sie sind unschuldig und haben nichts mit dem hier zu tun.“
Der Anführer neigte den Kopf und betrachtete Anderson mehrere Sekunden. „Niemand ist unschuldig“, sagte er leise.
Auf seine Geste hin wurde Anderson auf die Füße hochgerissen. Dann schleppten sie ihn aus dem Büro. Seine Chancen, doch noch aus dieser Lage entkommen zu können, wurden immer kleiner. Er wusste ganz genau, dass diese Männer nicht blufften.
Hastig lief Talbot den Gang entlang. Er wusste nicht, wohin er führte, aber insgeheim hoffte er, einen Weg nach draußen gefunden zu haben. An der linken Wand wurde eine Tür geöffnet. Ein Wärter betrat den Gang. Talbot feuerte zwei Mal. Der Mann stöhnte leise und brach dann zusammen. Aber er war noch nicht tot. Abermals betätigte Talbot den Anzug, doch die Waffe gab nur ein leises Klicken von sich. Das Magazin war leer.
Er warf die Pistole zur Seite, beugte sich über den Wärter, packte seinen Kopf und drehte ihn mit einer schnellen Bewegung nach rechts, bis das Genick brach. Der Mann trug keine Waffe bei sich. Das Holster war leer. Talbot stieß einen leisen Fluch aus. Doch dann kam ihm eine Idee. Er zog dem Mann die blutverschmierte Uniform aus und schlüpfte hinein. Dadurch bot er den anderen Häftlingen zwar ein Ziel, aber die Wärter würden nicht auf ihn schießen, wenn er versuchte, das Gefängnis zu verlassen.
Er öffnete die Tür einen Spaltbreit und entdeckte einen weiteren Gang. An dessen Ende befand sich eine Schleuse. Talbot grinste. Nun wusste er, wo er sich befand. Diese Schleuse musste er passieren, als man ihn in das Gefängnis gebracht hatte. Hastig rannte er den Gang entlang. Gerade als er die Schleuse erreichte, kamen ihm zwei Wärter entgegen.
Talbot gelang es gerade noch, die Blutflecken an seiner Uniform zu verbergen, indem er sich dicht an der Wand hielt. Die Männer rannten an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten. Talbot wandte sich der Schleuse zu. Der Kasten mit den kugelsicheren Scheiben war nicht besetzt. Die Tür stand offen. Talbot konnte das Hindernis ohne Schwierigkeiten passieren. Dahinter befand sich die Tür, die auf den Gefängnishof führte. Sie konnte nur vom Inneren des Glaskastens geöffnet werden.
Talbot trat an das Pult mit der Tastatur und las die Beschriftungen. Schon nach wenigen Sekunden hatte er den richtigen Knopf gefunden. Ein leises Summen ertönte, als die Tür zur Seite glitt. Talbot lief darauf zu und blickte in den Hof hinaus, der stellenweise gleißend hell erleuchtet war, während andere Teile in fast völliger Finsternis lagen.
Die Alarmsirene klang hier draußen noch lauter. Als Talbot den Hof betrat, krachten draußen Schüsse und die Kugeln zischten haarscharf an seinem Kopf vorbei. Er zuckte zurück und duckte sich. Geschrei drang von draußen herein.
Von seinem Standpunkt aus konnte er beobachten, dass einige Gefangene mit Pistolen über den Hof liefen und in voller Auflösung Deckung suchten, während andere schon reglos auf dem Boden lagen. Von einem der Wachtürme wurde das Feuer eröffnet. Einer der Häftlinge schoss zurück und wollte in Deckung gehen. Doch ehe er noch Schutz gefunden hatte, fasste er sich mit schmerzverzerrten Zügen an den Hals und stürzte zu Boden. Eine Kugel hatte ihm das Schlüsselbein durchschlagen.
Der zweite Mann richtete sein Gewehr auf den Wachturm. Aber gerade, als er den Abzug spannte, schrie er vor Schmerz auf und ließ die Waffe fallen. Mit glasigem Blick starrte er auf das Blut, das aus seiner linken Brust strömte. Er versuchte noch, das Gewehr mit der linken Hand aufzufangen. Doch er schaffte es nicht mehr.
„Tom! Tom!“
Der dritte Gefangene rief immer wieder seinen Namen, während er im Zickzack auf das Haupttor zurannte. Die Kugeln der Wärter flogen über seinen Kopf hinweg. Nach wenigen Metern änderte er die Richtung und rannte zur Mauer. Dort konnte er von den Schützen nur schwer getroffen werden. Minuten vergingen. Die Augen unablässig auf die Wachtürme gerichtet, drückte er sich gegen die Mauer.
Er schien zu überlegen, ob er seinen Standort verlassen sollte oder nicht. Zwei Schüsse nahmen ihm die Entscheidung ab. Sie fielen fast gleichzeitig, und er sah, wie die Kugeln dicht neben ihm in die Wand einschlugen. Zuerst konnte er nicht feststellen, wo sich der Schütze befand. Dann sah er, dass an der Nordseite eine Tür einen Spaltbreit offen stand. Die Mündung einer Pistole kam zum Vorschein. Der Häftling lief los. Dabei gab er sich Mühe, dicht an der Mauer zu bleiben.
Dann änderte er wieder die Richtung. Diesmal rannte er quer über den Hof und versuchte, den Lichtkegeln der Scheinwerfer auszuweichen. Plötzlich donnerte ein Schuss. Eine Kugel flog durch die Luft und blieb im Rücken des Mannes stecken. Er taumelte noch zwei Schritte vorwärts, dann stürzte er zu Boden. Talbot schüttelte den Kopf über so viel Dummheit. Was hatte den Kerl bloß dazu veranlasst, seine Deckung an der Mauer zu verlassen und quer über den Hof zu laufen?
Bevor er weiter darüber nachdenken konnte, wurde die Tür der Gefängniswerkstatt geöffnet. Ein alter Pick-up rollte auf den Hof. Talbot konnte erkennen, dass zwei Männer in Gefängniskleidung darin saßen. Plötzlich gab der Fahrer Gas. Mit halsbrecherischem Tempo raste der Wagen auf das Haupttor zu. Offenbar wollten die beiden das Hindernis mit dem Fahrzeug durchbrechen.
Ein sinnloses Unterfangen.
Von einem der Wachtürme neben dem Tor wurde der Pick-up unter Feuer genommen. Alle vier Reifen zerplatzten mit lautem Knall. Das Fahrzeug rollte noch einige Meter und kam dann zum Stillstand. Rauch quoll aus der Motorhaube hervor. Abermals wurde geschossen. Talbot drückte sich flach auf den Boden.
Als er vorsichtig den Kopf hob, sah er an den Mündungsfeuern, dass aus mindestens fünf Waffen auf den Pick-up geballert wurde. Zwei Schützen hielten sich auf dem linken Wachturm verborgen, die anderen drei befanden sich auf dem rechten. Plötzlich hörte das Feuer auf.
Die Tür auf der Beifahrerseite wurde geöffnet und ein Arm mit einem weißen Taschentuch schob sich heraus. Die Antwort auf dieses Friedenszeichen waren neue Feuerstöße. Der hintere Teil des Pick-ups wurde von Geschossen durchlöchert. Das weiße Taschentuch sank herab und fiel auf den Boden.
Ein dicker Mann sprang auf der Beifahrerseite heraus und brach in die Knie. Er kam stolpernd auf die Füße und begann zu laufen. Das Feuer verstärkte sich. Die Kugeln rissen ihn halb herum, schleuderte ihn dann in die entgegengesetzte Richtung. Seine Hände krallten in die Luft, als ob sie nach einem Halt suchten. Dann sank er wie eine fette Marionette zusammen.
Die Männer auf den Wachtürmen stellten ihr Feuer kurzzeitig ein. Weißgraue Rauchwolken wehten über den Hof. Die Tür auf der Fahrerseite wurde geöffnet. Ein zweiter, kleinerer Mann sprang aus dem Wagen und rannte im Zickzack auf das Haupttor zu. Die Waffen begannen wieder zu feuern. Der Mann warf den Kopf zurück und schrie mit heiserer Stimme: „Fickt euch, ihr Schweine!“
Dann warfen ihn die Geschosse zu Boden. Die Wärter feuerten weiter auf ihn. Talbot sah, wie die Kugeln Stofffetzen aus seiner Kleidung rissen. Aber der Mann lebte noch und schrie ununterbrochen: „Fickt euch!“
Dann traf eine Kugel seinen Kopf. Sofort verstummte er. Eine Blutlache bildete sich unter seinem Körper. Talbot blickte zu dem Toten hinüber. Die Wärter schossen auf jeden, der einen Fluchtversuch unternahm. Trotzdem musste er einen Weg finden, um zum Gefängnistor zu gelangen. Aber er wusste auch, dass es nicht einfach sein würde. Der Weg war lang und bot kaum Deckungsmöglichkeiten.
„Na, wie fühlst du dich?“ höhnte der Häftling. Sein harter Blick traf Anderson, der auf einem Stuhl stand und Mühe hatte, nicht herunterzufallen. Die Schlinge eines Seils lag um seinen Hals. Das andere Ende war um ein Rohr verknotet, das unter der Decke entlanglief. Schweigend blickte er in die grinsenden Gesichter der acht Häftlinge.
„Gleich werden wir sehen, ob du jetzt auch noch den starken Mann spielst.“
Andersons Gesicht blieb regungslos. Seine Augenbrauen waren derart zugeschwollen, dass er kaum noch etwas erkennen konnte. Blut lief aus Nase und Mund. Er glaubte, keine einzige Rippe mehr in seinem Körper zu haben.
„Du bist schon ein mieser Wichser“, sagte der Anführer. „Weißt du, wie viele Tage Einzelhaft ich dir verdanke? Vermutlich nicht. Aber jetzt wirst du dafür die Quittung bekommen.“ In seinen Augen lag ein tückisches Funkeln. „Hast du noch einen letzten Wunsch?“
Anderson warf einen Blick auf die Männer und wusste, dass er von ihnen keine Gnade erwarten durfte.
„Du wirst niemals wieder über das Schicksal von Häftlingen entscheiden, du verdammter Scheißkerl“, sagte der Anführer. „Jetzt machen wir dich alle.“
Anderson räusperte sich.
„Ihr begeht einen schweren Fehler“, klang seine heisere Stimme. „Wenn ihr mich umbringt, werdet ihr dafür bezahlen.“
Der rothaarige Anführer nickte spöttisch.
„Sicher“, antwortete er ruhig. „Aber bestimmt nicht in der nächsten Zeit.“
Er nickte einem anderen Häftling zu. Andersons Augen weiteten sich. Er wusste, dass der Moment gekommen war, an dem es hieß, von dieser Welt Abschied zu nehmen. Wie gebannt starrte er auf die Hand des Mannes, die sich jetzt ganz langsam dem Stuhl näherte. Die Schlinge zog sich um seinen Hals zusammen. Er keuchte. Die Umgebung begann vor seinen Augen zu flimmern. Übelkeit zog durch seinen verkrampften Körper. Er fühlte sein Herz in einem wilden Stakkato gegen seine schmerzenden Rippen hämmern.
Die Hand des Mannes hatte den Stuhl noch nicht erreicht. Diese Sekunden wurden für Anderson zu einer Ewigkeit. Sein Gesicht nahm eine bläuliche Färbung an. Hörbar schnappte er nach Luft. Doch der Mann kam nicht mehr dazu, ihm den Stuhl unter den Füßen wegzuziehen. Ein anderer Häftling riss seine Pistole hoch und feuerte.
Zwei Mal.
Die Kugeln drangen in Andersons Kniescheiben. Seine Beine gaben nach. Er knickte ein, stieß einen kurzen Schmerzensschrei aus, der in ein heiseres Röcheln überging. Das Seil straffte sich. Er spürte einen ziehenden Schmerz am Hals, hatte das Gefühl, dass man ihm den Kopf von den Schultern reißen würde. Sein Körper zuckte ein paar Mal, bäumte sich gegen den drohenden Tod auf, dann wurde es schwarz vor seinen Augen. Anderson glaubte, in einen unendlich tiefen Schacht zu stürzen, aus dem es kein Entkommen mehr gab.
„Erledigt“, klang die zufriedene Stimme des Anführers. Er blickte auf den Gefängnisdirektor, der leblos in der Schlinge hing. Sein Körper pendelte hin und her.
„Hauen wir ab. Dieser Dreckskerl wird keine Gefangenen mehr schikanieren.“
Die acht Männer rannten davon. Niemand gönnte dem leblosen Körper noch einen Blick.
Roberto Amendola hielt sich mit Fabio Palvetti und einem weiteren Häftling dicht an der Mauer und achtete darauf, nicht vom Licht der Suchscheinwerfer erfasst zu werden.
„Scheiße, die Sache ist schiefgegangen“, sagte der Mann links neben ihm. Mit zitternden Händen hob er die Pistole, die er einem Wärter abgenommen hatte.
„Nur die Ruhe, Salvatore“, entgegnete Amendola. „Noch ist nichts verloren.“
„Das soll wohl ein Witz sein?“ erwiderte der andere aufgebracht. „Die haben uns am Arsch.“
„Im Gegenteil. Wir werden uns das Chaos zunutze machen.“
„Ach ja? Und wie soll das funktionieren?“ wollte Salvatore wissen. „Wir kommen hier nicht mehr raus.“
„O doch, das werden wir!“ versicherte Amendola
„Und wie?“
„Wir laufen zur nördlichen Außenmauer.“
„Und dann? Sollen wir einfach rüberspringen?“
„Nein, viel simpler.“
„Was soll das heißen?“
„Das wirst du schon sehen“, erwiderte Amandola.
„Aber das ist ein ganz schön weiter Weg bis zur Außenmauer.“
„Es ist nur ein Kilometer.“
„Ein tödlicher Kilometer“, verbesserte der Mann ernst. „Hast du nicht selbst gesagt, dass der Großalarm entsprechende Konsequenzen nach sich zieht? Dann wird auf jeden ohne Anruf geschossen. Du hast doch gesehen, was mit den anderen passiert ist. Da kommen wir niemals durch.“
„Wir versuchen es trotzdem“, sagte Amendola eigensinnig. „Aber wir dürfen nicht mehr lange warten.“
Wahrscheinlich kam er den beiden anderen Häftlingen wie ein Verrückter vor, der Zeit damit vergeudete, etwas völlig Sinnloses zu tun. Trotzdem blieben sie an seiner Seite, als er über den Hof lief.
„Gleich geschafft“, rief Amendola. „Noch hundert Meter.“
Genau neben ihnen schlugen einige Kugeln in den Boden, aber die drei Männer änderten die Richtung nicht. Sie beugten sich nur etwas tiefer, um sich vor den herumfliegenden Geschossen zu schützen. Salvatore riss die Pistole hoch und erwiderte das Feuer. Aber er hatte keine Gelegenheit mehr, das Ergebnis seiner Treffsicherheit zu sehen. Mehrere Kugeln trafen ihn. Sein Gesicht hatte sich in eine formlose, blutige Masse verwandelt.
Er hielt die Pistole noch eine oder zwei Sekunden hoch, ließ sie dann mit einem lauten Poltern fallen, torkelte wie betrunken und stürzte. Regungslos blieb er auf dem Boden liegen. Seine Hände waren auf der Brust gefaltet, als läge er bereits im Sarg. Seine Lippen bewegten sich, doch er brachte keinen Ton heraus.
„Salvatore hat‘s erwischt“, rief Palvetti.
„Na und? So was passiert schon mal. Jetzt komm endlich.“
Palvetti blickte zu Salvatore hinüber. Der Mann krümmte sich. Blutiger Schaum trat auf seine Lippen. Es war ein sicheres Zeichen für einen Lungendurchschuss. Das wusste Palvetti.
„Komm endlich!“ forderte Amendola.
„Und was ist mit Salvatore?“
„Dem kann keiner mehr helfen.“
Palvetti nickte mechanisch. Es war ihm bewusst geworden, dass Amendola ihn genauso zurücklassen würde, wenn ihm was passierte. Amendola dachte nur noch an die Flucht. Alles andere war unwichtig geworden. Palvetti würde nun ständig daran denken müssen, während er dem Mann folgte. Geduckt liefen sie weiter. Einige Schüsse ertönten, doch sie galten nicht den beiden Männern. Trotzdem sorgten sie dafür, dass Palvetti von Panik ergriffen wurde.
„Wir sind am Ende“, schrie er Amendola zu. In wenigen Minuten würden sie ein komplettes SWAT-Team vor sich haben. Oder die Nationalgarde. Davon war er fest überzeugt. Schon jetzt gab es keine Möglichkeit für einen Rückzug. Die Wärter würden sie unweigerlich voll Blei pumpen.
„Das schaffen wir nie!“ rief Palvetti verbissen.
„Hör endlich auf“, fuhr Amendola ihn an.
Er sah das Flackern in den Augen des Mannes. Palvetti war mit den Nerven am Ende.
„Was nützt es, wenn wir die Mauer erreichen? Die Wärter werden uns einfach abknallen.“
„Denk jetzt nicht darüber nach“, erwiderte Amendola. „Wir werden hier rauskommen. Verlass dich drauf.“
Palvetti lachte spöttisch. „Das glaubst du doch selbst nicht.“ Seine Stimme wurde leiser und er begann, unverständliche Worte vor sich hinzumurmeln.
Amendola schüttelte den Kopf. Er fragte sich, was in den sonst so zuverlässigen Mann gefahren war. Er benahm sich wie ein elender Feigling. Und so etwas konnte Amendola im Augenblick überhaupt nicht gebrauchen.
„Immer mit der Ruhe“, rief er. „Wir werden es schon schaffen.“
„Einen Scheißdreck werden wir“, schrie Palvetti. „Sieh‘ doch endlich ein, dass alles verloren ist.“
„Halt endlich die Schnauze!“
Palvetti wollte sich umdrehen und zurücklaufen, doch Amendola packte ihn am Arm und riss ihn herum. Dann verpasste er ihm zwei kräftige Schläge mit der flachen Hand ins Gesicht. Palvetti gab einen ächzenden Laut von sich und taumelte einige Schritte rückwärts. Aus weit aufgerissenen Augen starrte er sein Gegenüber an. Für einen Moment sah es so aus, als wollte er sich auf Amendola stürzen, um ihm die Faust ins Gesicht zu rammen, doch dann überlegte er es sich anders. Palvetti wischte sich mit einer fahrigen Geste über den Mund. Offenbar hatte er sich wieder gefangen.
„Wir werden hier ‘rauskommen“, sagte Amendola beschwörend. „Hast du das verstanden?“
Palvetti nickte.
„Gut, dann hör endlich auf, dich wie ein kleines Kind zu benehmen.“
Talbot sah Roberto Amendola und Fabio Palvetti quer über den Hof laufen. Feuerstöße prasselten herab, doch Amendola wurde nicht einmal langsamer. Plötzlich stieß er einen lauten Schrei aus. Er packte Palvetti am Arm und zog ihn nach links hinüber. Dort warfen sie sich auf den Boden und schützten ihre Köpfe mit den Armen.
In nächsten Moment schien die Welt unterzugehen. Die Mauer an der Nordseite flog auseinander. Eine heiße Druckwelle fuhr über den Hof. Das Geräusch der Detonation mischte sich mit den Schüssen. In Talbots Ohren klang es überlaut. Gesteinsbrocken flogen durch die Luft. Talbot wurde durch die Druckwelle zurückgeschleudert. Er spürte, wie ihm das Bewusstsein schwand. Mit atemberaubender Geschwindigkeit sah er den Boden auf sich zukommen.
Er stürzte aufs Gesicht. Unendlich lange Zeit, schien ihm, kämpfte er gegen die Schwärze, die ihn einzuhüllen drohte. Der Sturz hatte ihn benommen gemacht, aber unter dem Eindruck seiner Hilflosigkeit wuchs sein Widerstandswille. Er wollte nicht aufgeben. Tobender Zorn erfüllte ihn bis in die letzte Nervenfaser. Er musste sich wehren, sonst würden die Wärter ihn töten. Talbot wunderte sich sowieso, dass er noch lebte.
Die Schwäche ließ nach. Plötzlich konnte er den Boden vor sich wieder deutlich sehen. Er hörte Schussgeräusche, schreiende Männer und hastige Schritte. Er hob den Kopf. Wilder Schmerz zuckte durch seinen Körper, aber er bezwang sich und kam auf die Füße. Zunächst war nur Staub um ihn, dass er dachte, ersticken zu müssen. Talbot spürte das Blut von der Stirn tropfen. Vorsichtig betastete er die Wunde. Es war nur ein kleiner Kratzer.
Plötzlich wurde es wieder hell. Der Staub sank langsam zu Boden. Talbot sah Amendola. Er zwängte sich gerade durch das Loch in der Gefängnismauer. Die Wärter auf den Türmen schienen verwirrt. Trotzdem jagten sie einige Schüsse hinter ihm her, doch sie trafen nicht. Palvetti lag immer noch am Boden und schützte seinen Kopf mit den Armen. Langsam blickte er auf und sah die Öffnung. Dann erhob er sich, lief darauf zu und verschwand ebenfalls nach draußen.
Talbot grinste. Man konnte über Amendola denken, was man wollte, aber wenn es darum ging, einen Plan auszuarbeiten, war er unschlagbar. Andere mochten solch einen Ausbruch für undurchführbar erachtet haben, aber er hatte das Gegenteil bewiesen. Talbot kam auf die Füße. Sein Kopf bewegte sich unablässig von einer Richtung zur anderen. Seine Augen durchforschten jeden Winkel und jeden Spalt, während er auf das Loch zulief. Gleichzeitig versuchte er, den Suchscheinwerfern auszuwieichen.
Schüsse ertönten. Zwei Kugeln schlugen dicht neben ihm in den Boden. Talbot ließ sich fallen und robbte an der schützenden Mauer entlang, bis er noch etwa fünfzig Meter von der Öffnung entfernt war. Aus den Augenwinkeln sah er zwei Männer in Häftlingskleidung, die ebenfalls auf das Loch zuliefen. Sie hatten noch nicht einmal die Hälfte des Weges zurückgelegt, als mehrere Schüsse ertönten. Einem Mann wurde der Hinterkopf weggerissen, der andere konnte noch einige Meter laufen, bevor er von drei Kugeln getroffen, zusammenbrach.
Talbot verließ den Schutz der Mauer und näherte sich der Öffnung. Vorsichtig schob er den Kopf hindurch und blickte nach draußen. In einiger Entfernung sah er Amendola und Palvetti. Ein dunkler Wagen stand auf der Straße. Talbot zog den Kopf zurück und kletterte durch das Loch ins Freie. Sein Hosenbein verfing sich an einer Metallstange, die aus dem Beton herausragte. Nur mit Mühe gelang es ihm, sich zu befreien. Doch schließlich hatte er es geschafft. Immer noch brüllten Männer und krachten Schüsse.
Er blickte zu dem Fahrzeug hinüber, das auf der Straße stand. Es handelte sich um einen großen Leichenwagen. Er war über und über mit Blumen geschmückt. Die Tür des Laderaums, in den normalerweise die Särge geschoben wurden, stand offen. Amendola und Palvetti kletterten hinein und legten sich flach auf den Boden. Ein korpulenter Mann in einem schwarzen Anzug schloss die Tür. Dann setzte er sich hinter das Steuer und fuhr los.
Talbot warf noch einen kurzen Blick auf das graue Gebäude mit den hohen Mauern und den vergitterten Fenstern. Schließlich wandte er sich um und rannte die Straße entlang. Nur weg! So schnell wie möglich. Mehrmals schaute er über die Schulter nach hinten, doch niemand folgte ihm. Er taste nach der Wunde an seinem Oberarm. Sie blutete nicht mehr. Nach einigen Minuten tauchte in der Ferne ein Auto auf. Als der Fahrer den uniformierten im Scheinwerferlicht sah, trat er auf die Bremse und ließ das Fenster herunter. Im selben Moment sah er den Blutfleck auf dem weißen Hemd.
„Was ist denn los?“
„Im Gefängnis hat es einen Aufstand gegeben“, antwortete Talbot. „Ich wurde angeschossen und muss sofort zu einem Arzt.“
„In Ordnung“, sagte der Fahrer, während er die Tür öffnete und ausstieg.
Talbot taumelte auf den Mann zu. Dann trat er hinter ihn, schlang den rechten Arm um seinen Hals und drückte mit der linken Hand den Kopf zur Seite, bis das Genick brach. Er schleppte den Toten in den Straßengraben und nahm die zweihundert Dollar, die er bei sich trug. Als sich der Killer aufrichtete, sah er in der Ferne Blaulicht flackern.
Talbot setzte sich hinter das Steuer, schlug die Tür zu und fuhr los. Erst jetzt atmete er tief durch. Der erste Teil seiner Flucht hatte geklappt. Sobald er mehrere Kilometer zwischen sich und das Gefängnis gebracht hatte, wollte er den Wagen irgendwo abstellen und in Brand setzen. So war es für die Polizei unmöglich, seine Fingerabdrücke zu finden. Das würde ihm einen kleinen Vorsprung verschaffen. Aber er machte sich keine Illusionen. Er war zwar entkommen. Aber früher oder später würden ihn die Bullen finden. Darauf konnte er sich verlassen.
ENDE