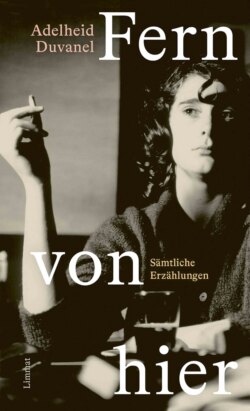Читать книгу Fern von hier - Adelheid Duvanel - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Taddea
ОглавлениеMan nannte die kleine Taddea eine Lügnerin, weil sie sich nicht viel aus Gedanken machte, die sich wie Blumen oder Früchte entwickelt hatten. Sie spickte die ihren, die Samenkörnchen glichen, munter umher. Wohin sie fielen, wusste sie nicht, glaubte aber bestimmt, dass der Wind sie auf die höchsten Berge, auf die größte Meereswoge, ins tiefste Tal trug, und wer weiß, vielleicht wuchsen daraus Vögel, Schlangen, schillernde Käfer oder Ungeahntes? Taddea liebte Wörter, deren Bedeutung sie kaum kannte, die sie aber jeweils, wenn sie traurig und einsam war, vor sich hinsagte: «Zarewitsch» war eines, dann gab es noch «Ignatius von Loyola» und «raffsüchtig». Sie liebte auch Leute, die sie gar nie gesehen und von welchen sie auch nie gehört hatte, die sie sich nur zu ihrem eigenen Vergnügen ausdachte.
Am Abend, wenn die Mutter glaubte, ihre kleine Tochter löse Schulaufgaben, lag Taddea mit hinter dem Kopf verschränkten Armen auf dem Bett in ihrem Zimmer. Das Fenster rahmte Häuser ein, die an einem sanft leuchtenden Himmel lehnten und sich von Bäumen, die aussahen, als wären sie aus Licht und Schatten gestrickt, streicheln ließen. Sie sah Fernsehantennen auf den Dächern, bunte Wäsche auf den Balkonen, sie hörte Geschirrgeklapper aus den Küchen, irgendwo, gedämpft, Gemurmel aus dem Radio, in der Ferne das Klingeln der Straßenbahn.
Taddea hatte keinen Vater, und die Mutter kümmerte sich kaum um sie, denn abends ging sie meist ins Kino. Sie sagte, weil sie den ganzen Tag im Büro arbeite, brauche sie diesen Ausgleich, doch Taddea befürchtete, dass dieser Ausgleich anders beschaffen sei, als die Mutter vorgab. Ihre Schulkameradinnen sagten: «Deine Mutter ist eine Hure», und sie sagten, als wäre dies ebenso schlimm: «Deine Mutter hat das Haar gefärbt.» Seit Taddea ahnte, dass eine Hure mit dem sechsten Gebot in Zusammenhang stand, das sie während längerer Zeit nicht ganz begriffen hatte, das sich aber um Schlimmes drehte, um Dinge, die man im Kino sah, um Dinge, die der Pfarrer im Religionsunterricht verschwieg, war sie immer bedrückt. Einigen Schulkameradinnen war dieses Gebiet nicht fremd; sie tuschelten unverschämt lachend darüber, doch Taddea, die log, wie wir wissen, auch stahl, hielt sich da lieber fern; es genügte schon, wenn sich die Mutter damit befasste, die übrigens aus «gutem Haus» stammte, wie eine Tante erklärte, und daran hielt sich das Mädchen. Die Mutter selbst sprach nie davon. Taddea wusste nicht, ob die Mutter schön war, sie kümmerte sich nicht darum, nur ihr rotes Haar betrachtete sie jeweils argwöhnisch, als sei es das Symbol ihres sündhaften Lebens, und ihre Brüste, die ihr viel zu mächtig schienen, kamen ihr unangenehm vor. Überhaupt roch sie aufdringlich nach «Frau». Sie war noch sehr schlank, ihre Kleiderausschnitte waren zu groß, ihre Haut welk und gepudert, ihre Stimme rau, manchmal weckte sie Sehnsucht, Erinnerungen nach entschwundener Wärme, Geborgenheit, Vertrautheit, und das Mädchen starrte ihr in die Augen, als suche es dort etwas, doch ihr Blick wich immer aus. Einmal sah Taddea sie mit einem Mann, einem jener Männer wahrscheinlich, mit denen sie Verbotenes tat. Sie betrachtete die beiden genau, konnte aber nichts Besonderes entdecken: Sie waren ungezwungen, wie Erwachsene sind, kalt, böse lächelnd, arrogant, geheimnisvoll. Vielleicht war die Stimmung, die Taddea zu spüren glaubte, tatsächlich anders als die Stimmung, die gewöhnliche Menschen verbreiten; sie glich mehr Tabak, Alkohol, Kino, Dancing, gar nicht Tischtuch, Milch, Schuhputzcreme, Einkaufstasche und Wetterprognose.
Als Taddea noch jünger gewesen war, glaubte sie, die Erwachsenen schenkten der Welt der Kinder Beachtung. Im Winter grub sie jeweils sonderbare Spuren in den Schnee, um die Passanten zu irritieren. Sie stellte sich vor, sie würden zueinander sagen: «Was für ein Tier ging hier wohl? Das war doch kein Hase, kein Reh, kein Fuchs, kein Hund?» Und am andern Tag würde in der Zeitung stehen: «Rätselhaftes Tier, ein Urtier vielleicht, ging durch unsere Stadt.» Doch nichts dergleichen geschah.
Übrigens schien das unstete Leben der Mutter, ihre Unruhe, ihr Jagen nach Abwechslung, nach Abenteuern, eine Flucht vor einer Last zu sein, eher das Vergessen dieser Last, die sie immer mit sich trug. Sie bestand aus Worten wie «Familie», «Verantwortung», «Stand», «Ehre», die plötzlich ihre Bedeutung für sie verloren hatten, denn ihr Vater, der letzte Spross einer vornehmen Familie, war ein Spieler, Trinker und Schürzenjäger gewesen und hatte das Vermögen verjubelt. (Sein Sohn, Onkel Theodor, den Taddea nie gesehen hatte, war Kommunist. Sie stellte sich diesen Beruf sehr schlimm vor.) Die Schwester der Mutter, Tante Sybill, die mit einer gerümpften Nase zur Welt gekommen war, lebte, ziemlich arm, für fremde Leute nähend, in einem Stübchen im Haus der verstorbenen Eltern und hütete das Klavier, die Familienfotos, gestickte Deckchen, verstaubte, dunkle Gemälde, schlecht gemalt, aber immerhin Onkel Alphons und Tante Lilly und Cousine Astrid darstellend, die alle längst tot waren. Die übrigen Räume hatte sie an ruhige, seriöse Leute vermietet. Taddea wollte, wenn sie einmal erwachsen sein würde, auch so leben wie Tante Sybill, die vor allem Widerwärtigen geschützt schien. Doch wenn sie sich im Spiegel betrachtete, konnte sie sich nicht vorstellen, wie dieses ruhige Leben, das nach Staub roch, nach Pfefferminz und Geranienblüten, zu ihr passen würde, denn ihre schrägstehenden Augen, die die Farbe von dunklem Bier hatten, blickten wild, sie war geschmeidig und dünn, obwohl sie viel aß, heimlich geradezu leidenschaftlich Zucker verschlang, Hafer, Butterbrote, Eier.
Oft stand Taddea minutenlang in der leeren Wohnung, in welcher kein Bild hing, keine gestickte Decke lag, ohne sich zu rühren, gelähmt, Angst im Herzen, und glaubte, ihre Gedanken würden wie Glaskügelchen von ihr abfallen und in alle vier Ecken des Zimmers rollen. Sie wollte ihnen nacheilen, sie einsammeln, um wieder sie selbst zu sein, doch sie konnte nicht. Manchmal schrie sie, und sie musste sich die Hand auf den Mund pressen, denn sie war, trotz ihrem verwegenen Äußeren, rücksichtsvoll. Eine ältere Dame, die nur Katzen besaß, strich ihr hie und da über den Kopf, was sie innerlich steif, mit einem falschen, demütigen, halben Lächeln geschehen ließ.
Taddea besaß viele Spielsachen, denn jeden Samstag, bevor die Mutter in ihrem Sportwagen wegfuhr, kaufte sie ihr etwas, eine kleine Welt, die sich in ihre Hand, an ihr Herz schmiegen sollte, doch am liebsten verbrachte das Mädchen die freien Stunden mit dem Schmücken eines Hydranten, der an der Straßenecke stand. Es zog ihm alte Wollmützen an und abgetragene Jacken seiner Mutter, verschiedene Halstücher, Schürzen, einen zerrissenen Vorhang, den es in einem Mistkübel fand und der ihm gefiel, weil er wie Seide schimmerte. Es taufte den Hydranten «Beethoven» oder «Chopin» und unternahm mit ihm Reisen nach Texas, nach Mexico, nach allen Ländern, die es kannte, weil ihre Namen in den Schlagern enthalten waren, die es am Radio hörte. Ältere Kinder, die seinem Treiben belustigt zusahen, versteckten jeweils die Kleider und lachten, wenn Taddea an ihrem nackten Freund lehnte und weinte.
Eines Nachts träumte Taddea, ihre Mutter wandere in einem langen Korridor, immerzu, aber ohne kleiner zu werden, immerzu gegenwärtig wie das ewige Licht in der Kirche, das dem kleinen Mädchen von jeher unheimlich vorgekommen war, und auf ihrem Kopf saß eine Katze, die fragte: «Du liebst mich?», nicht: «Liebst du mich?», woraus das Kind schloss, dass die Katze um seine Liebe zu ihr wusste und eigentlich nur der Form halber fragte. Das Tier war krank, und Taddea fühlte, dass es bald sterben würde, denn alle Blumen und Tiere, die in Mutters Obhut waren, starben über Nacht: Die Kakteen, der Kanarienvogel, die Schildkröte, der kleine Frosch. (Sehr zum Verdruss, aber, wie Taddea richtig empfand, auch zum Schmerz der Mutter, die nach diesen traurigen Erlebnissen vorgab, Pflanzen und Tiere zu verabscheuen, aber dralle, lebhafte Hunde mit eifersüchtigem Lächeln lobte.)
Taddea erwachte. Die Uhr im Nebenzimmer schlug Mitternacht. In der Ferne sangen einige Italiener, Taddea stellte sie sich wie gigantische Engel vor, die singend Wolken kneten. Sie schlüpfte aus dem Bett und ging leise ins Schlafzimmer ihrer Mutter, sah jedoch, dass das Bett leer war. (Die Mutter brachte ihre Männer nie nach Hause. Vielleicht aus Rücksicht?) Sie trat ans Fenster. Die Nacht lag weich und warm wie Samt in den Gassen. Taddea beugte sich weit hinaus, um nach der Mutter Ausschau zu halten, die vielleicht mit der letzten Straßenbahn zurückgekehrt war (das Auto war zu jener Zeit zur Reparatur in einer Werkstatt) und nun allein durch die Straße ging, mit abwesendem Blick, ihr unglückliches, ein wenig slawisches Gesicht wie eine zerfetzte Fahne vor sich hertragend. Sie roch nach Wein, schien aber nie betrunken, und sie trug immer neue Kleider wie der Hydrant, ihre Augen waren schwarz glimmende Scherben, ihre Lippen geschabte Rüben, ihre Hände Krallen, die für Taddea Geld auf die Bank trugen, mechanisch, wie einem inneren Zwang gehorchend. Sie schien stets müde und doch gespannt, hie und da schrie sie ohne Grund, dann weinte sie und schenkte ihrer Tochter Schokolade.
Taddea beugte sich weiter hinaus. War es nicht die Mutter, die dort um die Ecke bog? Aber weshalb kam sie nicht hierher, wo ihre Wohnung war, weshalb verschwand sie in einer anderen Straße? Plötzlich verlor das Mädchen, das aufs Fenstersims gestiegen war, das Gleichgewicht und stürzte hinunter; schnell, lautlos flatterte es auf die Nacht zu. Der Tod nahm sein Herz in die Hände und flog mit ihm in jene Welt, von der wir träumen, wenn der Schlaf mit uns in die Tiefen taucht, wo silberne Flüsse leise wie Katzen zwischen blauen Wolken gehen, wo Männer und Frauen heulend wie hungrige Wölfe auf hohe Türme steigen und stattliche Kröten lachend über Sommerwiesen eilen.