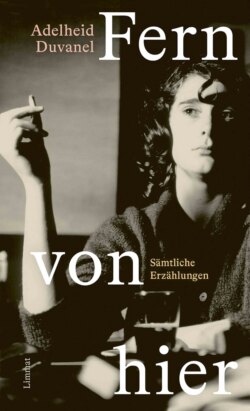Читать книгу Fern von hier - Adelheid Duvanel - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Leo
ОглавлениеJeden Schritt, jede Bewegung schien der kleine Leo zu kosten. Wenn er irgendwo saß, das Kinn auf die Hand gestützt, die Zehen betrachtend, die er spielerisch bewegte, die braunen Augen mit dem verschwommenen Blick halb geschlossen, scharf durch die schmale Nase atmend, dann schien er nicht nur das Atmen, das Spiel der Zehen, das Ruhen des Kinns auf der Hand zu genießen, sondern er schien sich gleichzeitig erfreut seine braunroten Locken vorzustellen, seine kleinen Ohren, die oben spitz zuliefen, seine hübschen Hüften, die blassen, herzförmigen Lippen, die er mit der Zunge streichelte. Diese Trägheit und das verträumte Wesen gefielen seinem Onkel, erregten jedoch den Zorn seiner Tante. «Es soll einmal ein Mann aus ihm werden, vergiss es nicht, Paul!», schrie sie jeweils, doch Onkel Paul betrachtete seinen Pflegesohn als eine teils freundlich, teils bizarr schimmernde Pflanze, sie sich hegen und pflegen ließ und von der fremden Welt träumte, von wo ihr Same aus Versehen auf die Erde gefallen war und nun staunend sich verwandelte, staunend das Dasein genoss und staunend verwelkte.
Tante Elise hätte man sich gut mit einem roten, flatternden Kopftuch auf einem Traktor sitzend vorstellen können, in einem kommunistischen Propagandafilm beispielsweise, entschlossen eine Fahne schwenkend, während Onkel Paul, der vierblättrige Kleeblätter sammelte, Kaugummi kaute und deshalb immer nach Pfefferminz roch, eher einem Landpfarrer oder Landarzt glich; man umfing seine Gestalt mit einem einzigen Blick, nahm sie sozusagen mit einem Schluck wie einen guten, herben Wein, während Tante Elise mit den harten Augen, der geröteten Nase, den breiten, abfallenden Schultern mit einer zähen, schwer verdaulichen Wurst Ähnlichkeit hatte, die sich nicht gut häuten lässt, die beim Kochen aufspringt oder pappig wird, kurzum: die einen vor Probleme stellt. Das Einzige, was an Onkel Paul befremdete, war seine Angewohnheit, die Hände immer zur Faust geschlossen zu halten, wobei er die Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger gefangen hielt, als wären sie die Verkörperung des Bösen.
Onkel Paul war der Sohn eines Kleinbauern, hatte mit Stipendien studiert und durfte sich Herr Doktor nennen, obwohl er orthografische Fehler machte. Seine Arbeit, Zähne flicken, tat er genau, die Patienten liebten ihn, denn er war stets heiter, wenn auch schweigsam. Er besaß eine moderne Praxis in der Stadt und bewohnte ein Haus in der Vorstadt, dessen vorderes Gesicht auf eine Fabrikstraße blickte (einige staubbedeckte Bäume waren zu sehen, rumpelnde Lastwagen, im Hintergrund ein Heer von rauchenden Schornsteinen), dessen hinteres Gesicht aber den Strom betrachtete, auf welchem sich am Sonntag rotweißbeflaggte Ruder- und Motorboote tummelten. Am Samstagabend, wenn die Glocken den Sonntag einläuteten, konnte man Onkel Paul mit andächtigem Gesicht auf der Terrasse stehen sehen, wie er mit schillernden Äuglein über das Wasser blickte.
Hätte man aus der Innenausstattung des Hauses auf den Charakter seiner Bewohner schließen wollen, wäre man in Verlegenheit geraten, als müsse man aufgrund eines Bauchinhalts die Eigenschaften des Trägers dieses Bauches enträtseln. («Bauch ist Bauch» war übrigens der Lieblingsausspruch Onkel Pauls, dessen er sich immer bediente, wenn man ihn in irgendeiner Angelegenheit um seine Meinung fragte. Er schien damit vielleicht auf eine etwas rätselhafte Art sagen zu wollen, alles sei relativ, alles sei im Grunde gleichermaßen wertvoll oder wertlos, so und so zu betrachten, habe seine Vorder- und seine Kehrseite, sei positiv und zugleich negativ, aus diesem Grunde anzustreben und aus jenem Grunde zu verachten.) Onkel Paul besaß einen Fernsehapparat, schöne, alte Bauernmöbel nebst Stühlen, die Abortschüsseln glichen, eine im Warenhaus gekaufte abstrakte Frau, die Ähnlichkeit mit einem Eselsohr hatte, eine rosafarbene Badewanne und eine beachtliche Bibliothek, denn er war eine Leseratte.
An einem Samstag im Frühling trugen fremde Menschen den kleinen Leo ins Haus, weil er von einem der großen Lastwagen überfahren worden war; die Fenster standen offen und breiteten ihre Flügel weit aus, als wollten sie davonfliegen. Während Tante Elise dem Arzt telefonierte, kniete Onkel Paul am Bett des Knaben, der mit einem scharfen Wenden seines Kopfes hierhin und dorthin blickte und mit einer eigentümlich kalten, heiseren Stimme unverständliche Worte sprach. Blut floss schräg über sein Gesicht, das der Onkel mit einem Taschentuch immer wieder zitternd abwischte.
Ein Traum, der so groß war, dass er das ganze Zimmer ausfüllte, die Wände sprengte und überallhin floss wie ein farbiger Brei, der wunderliche Formen annimmt, zeigte dem Knaben die Daumen seines Onkels, die aus den Händen krochen, sich vermehrten, wie Zeppeline durchs Zimmer flogen, gegeneinanderstießen, schreiend, mit offenen Mündern um die Lampe wirbelten. Die Menschen und Gegenstände erstarrten, die Nacht wuchs aus den Dächern und warf ihren Schatten ins Zimmer. Mahlzeiten, die Leo geliebt hatte, erstanden vor seinen Augen, doch waren sie sonderbar verzerrt, als ob man sagen würde: «Ich bud» statt «ich badete»; nicht aus Unwissenheit, sondern aus einem unerklärlichen Übermut oder Überschwang, der der Sache gar nicht angemessen war. Eine Bratwurst mit Zwiebeln roch nach Vanille, einer Torte entstieg Knoblauchgeruch, eine Forelle war zäh und klebrig wie Nougat.
Je länger Onkel Paul das Kind anblickte, desto fremder kam es ihm vor; manchmal wurde es plastisch, wie es vorher nie gewesen war (es hatte eigentlich immer unräumlich, verwischt wie auf einer schlechten Fotografie gewirkt), sein längliches Gesicht war wie von einem Heiligenschein umgeben, die Augen wurden überdeutlich, ragten wie Stecknadeln hervor und begannen zu leuchten, hinter seinem Gesichtchen schien sich Unbekanntes zu verbergen, und seinen blutenden, gekrümmten Körper schien es zu ignorieren; es lebte hinter ihm wie der Wahnsinnige hinter den Mauern seiner Zelle, die er nicht wahrnimmt, und wenn er mit dem Kopf an sie stößt, kann man sein wütendes, schmerzliches Aufbrüllen hören. (Wenn seine Vernunft hie und da den Ansturm der Traumbilder zurückdrängte und sich umsähe, würden sich auf seinem Gesicht Erschrecken, Staunen, Widerwillen zeigen, hätten die Hiebe der Dämonen es nicht zerstört.) Der Knabe glich einem Engel, der sich in ein Tier verwandelt, in eine Ratte beispielsweise, sich aber immerzu schämt und die Füße beschnuppert, um festzustellen, ob sie nicht übel riechen, und den Schwanz einzieht wie ein geschlagener Hund, und wenn er irgendwo Seife frisst oder an einer Türe nagt, träumt er von weißen, zarten Flügelchen, vermeidet es, zu rülpsen, und die sehnsüchtigen Worte: «Wenigstens ein Schmetterling …» drängen sich auf seine Rattenlippen.
Als der Arzt endlich kam, unsanft Tante Elise und den verstörten Lastwagenchauffeur zurückstieß, die ihn mit Fragen und Erklärungen bedrängten, runzelte Leo die Stirn, atmete einige Male kurz und heftig, schloss die Augen und öffnete die weißen trockenen Lippen. Onkel Paul erhob sich, blickte sich erschreckt im Zimmer um, und während er sich gleichzeitig mit dem Arzt über Leo beugte, wusste er, dass das Kind tot war, und es schien ihm, er habe es geliebt, wie man eine Frau liebt, mehr noch als Elise, deren Weinen er wie aus weiter Ferne hörte, mehr als seine Bücher, mehr als sich selbst.
Er öffnete seine Hände, und als der Arzt ihm eine Frage stellte, schwieg er, denn seine Stimme, seine Zunge und seine Lippen blieben bewegungslos wie seine Hände, sie wurden zu etwas Fremdem, zu Gegenständen, die er nicht mehr gebrauchen konnte und wollte, da der Knabe nicht mehr da war, zu dem er hätte reden, den er hätte streicheln und küssen können und der schön war.