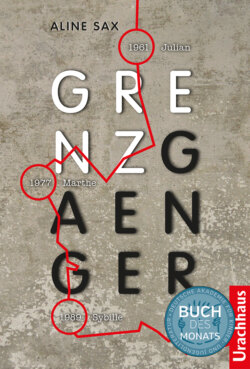Читать книгу Grenzgänger - Aline Sax - Страница 20
FÜNFZEHN
ОглавлениеEs wurde die merkwürdigste Woche meines Lebens. Ich war ängstlich, erleichtert, aufgeregt und deprimiert – alles zugleich. Die Zeit verging zu schnell und doch nicht schnell genug. Ich versuchte, Franks Anweisung zu befolgen und mich so zu verhalten wie sonst auch. Aber das war schwierig, weil ich mich so völlig anders fühlte.
Am Esstisch prägte ich mir das Gesicht meiner Mutter ein, ihre Augenfarbe, ihre Haarfarbe und die feinen Fältchen in den Mundwinkeln. Jeden Satz, den sie sagte, wollte ich mir merken.
Auch meinen Vater betrachtete ich heimlich. Und wieder einmal wurde mir bewusst, wie wenig ich ihn doch kannte. Zu gern hätte ich gefragt, woher sein Starrsinn und seine Härte rührten, warum er sich wie mit einem Panzer gegen uns abschottete. Der Krieg hat ihn innerlich umgebracht, hatte meine Mutter einmal gesagt, aber nicht erklärt, wie sie das genau meinte. Er selbst mied das Thema Krieg. Als er ’46 aus russischer Gefangenschaft zurückkehrte, traf er zu Hause Kinder an, die ihn den größten Teil ihres Lebens nicht gesehen hatten. Ich – damals fünf – hatte ihn überhaupt noch nie gesehen. Mein Vater war für mich das Foto auf Mutters Nachttisch. Ein stattlicher Offizier in Wehrmachtsuniform mit lachendem Gesicht. Und auf einmal stand ein ausgemergelter Mann in der Tür, der meine Mutter küsste und von da an bei uns wohnte. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, dass der wortkarge Mann, der mich schlug, wenn ich im Weg herumstand oder meinen Teller nicht leeraß, derselbe war wie auf dem Foto. Für ihn wiederum war ich das Kind, von dem er nur aus Briefen meiner Mutter wusste. Gudrun und Rolf hingegen hatte er als Säuglinge und Kleinkinder erlebt.
Als ich in die Pubertät kam, rechnete ich des Öfteren nach, traute mich aber nicht, meine Mutter direkt zu fragen, ob er neun Monate vor meiner Geburt auf Heimaturlaub gewesen war.
Jedenfalls war es, als hätte sein Leben erst mit der Rückkehr aus der Gefangenschaft begonnen, denn über früher sprach er nie, auch nicht über die Zeit vor dem Krieg. Eine einzige Geschichte aus dem Krieg kam mir zu Ohren, als er sie Florian erzählte. Vater und seine Kameraden hatten im Afrikakorps gekämpft und in der Wüste ein Kamel eingefangen, mit dem sie ein britisches Lager überfallen wollten. Weil das Tier ihnen den gesamten Wasservorrat wegsoff, war ihr Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Aber das konnte ihn innerlich nicht umgebracht haben. Es musste etwas anderes gewesen sein.
Ich überlegte, ob er es mir wohl sagen würde, wenn er von unserem Fluchtplan wüsste und dass wir einander wahrscheinlich nie mehr sehen würden. Nein, eher nicht … stattdessen würde er mir eine Predigt halten. Über Gehorsam und Pflichtbewusstsein. Und mich abkanzeln, weil ich mir von einem Mädchen aus dem Westen den Kopf hatte verdrehen lassen. Seine wahren Gefühle würde er hinter Prinzipien und Ermahnungen verstecken. So wie immer. Also ließ ich es beim Beobachten und bedauerte, dass ich meinen Vater nie wirklich würde kennenlernen.
Wenn ich durch die Straßen ging, kamen mir die Farben anders vor, die Sonne wärmte meine Haut intensiver, und der Wind trug die verschiedensten Gerüche heran. An den heruntergekommenen Häusern, den Schutthalden aus dem Krieg, den neu angelegten breiten Straßen und den einförmigen Wohnblocks nahm ich Details wahr, die mir vorher nie aufgefallen waren. Ich sah, dass die Sockel der Laternenpfähle entlang der Stalinallee kleine Klappen hatten und dass eines der Arbeiterdenkmäler an der Rathausstraße statt Stiefeln eine Art Pantoffeln trug. Die Herbstblumen im Park hatten leuchtendere Farben, und die Straßenbahnen bimmelten lauter. Nur die Parolen auf den Plakatwänden blieben leere Phrasen.
Und ich achtete auf etwas, das mich bisher nie interessiert hatte: die Gullys. Ihr Durchmesser würde einen problemlosen Abstieg erlauben. Und sie hatten Löcher, an denen der Deckelmann sie anheben konnte. Wie viele von den Gängen darunter mochten in den Westen führen? Letztlich wohl alle, denn da unten stand alles miteinander in Verbindung. Und wenn ich auf einem Gullydeckel stehen blieb, war mir, als könnte ich das fühlen und als hörte ich das Abwasser unter mir rauschen.
Mir alles so gut wie möglich einzuprägen war meine einzige Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Mutter und Vater müssten sich später alles zusammenreimen. Das heißt, vermutlich würde jemand von der Staatssicherheit kommen, um sie über unsere Flucht zu informieren. Sie würden die Nachricht ebenso verwundert wie entsetzt aufnehmen, sodass der Stasi-Mensch gar nicht auf die Idee kam, sie könnten Mitwisser sein.
Weil mein Vater mir andauernd zusetzte und weil ich mich verhalten sollte wie sonst auch, bemühte ich mich weiterhin um Arbeit. Und es war, als hätte der Teufel die Hand im Spiel. Als ich mich am Mittwoch zum x-ten Mal bei irgendeinem Stellvertreter irgendeines Geschäftsführers irgendeiner Baufirma vorstellen durfte, hatte ich auf einmal eine Stelle. Nicht als Maurer, aber als Hilfskraft. Der Lohn betrug nur einen Bruchteil dessen, was ich bei Reitmann & Sohn verdient hatte. Aber weil es ohnehin egal war, sagte ich zu. Am Montag könne ich anfangen, hieß es. Ich nickte, stellte pro forma noch ein paar Fragen, unterschrieb den Vertrag und verabschiedete mich mit einem Händedruck. Der Mann würde sich wundern, wenn ich am ersten Arbeitstag gar nicht erst auftauchte. Aber das brauchte mich nicht zu kümmern.
Einzig mit Rolf konnte ich über alles reden. Ich ging jeden Abend bei ihm vorbei. Den Rücken an die Wand gelehnt, saßen wir nebeneinander auf seinem Bett, tranken Bier, und er rauchte eine Zigarette nach der anderen. Als ich ihm erzählte, wie anders ich alles empfand, nickte er nur. Wahrscheinlich erging es ihm genauso.
»Willst du wirklich nach Italien?«, fragte ich ihn, als eine längere Stille eintrat.
»Ja.« Er sah mich an. »Erst als du von Freiheit geredet hast, ist mir klar geworden, was uns hier alles versagt bleibt. Wie begrenzt unsere Welt ist. Seitdem spuken mir alle möglichen Länder und Orte durch den Kopf, die ich gern sehen möchte.« Er schloss die Augen: »Rom … Paris …«
Solche Träume hatte ich nicht. Ich konnte nicht weiter denken als bis Sonntagabend. Und daran, was dann alles für immer zu Ende sein würde.
»Am Sonntag hat Franziska Geburtstag.« Ich nahm einen Schluck Bier. »Wir könnten Gudrun und Hermann fragen, ob sie zum Essen kommen. Als Absch…« Das Wort blieb mir im Halse stecken.
Rolf nickte.
»Und wegen Franziska natürlich.«
Ich fragte mich, ob meine kleine Schwester mir wohl fehlen würde. Und ich ihr. Gudrun ja, die würde mir fehlen. Und Marthe und Florian ebenso. Ob die beiden sich in zehn Jahren, falls die Mauer so lange stand, noch an mich erinnerten? Oder würde ich dann ein Onkel sein, der nur als Foto existierte?
Ich versuchte, an etwas Erfreuliches zu denken. An Heike. Daran, wie überrascht sie sein würde, wenn ich plötzlich vor ihr stand. Wir würden uns eine gemeinsame Wohnung suchen. Bestimmt könnte ich mir bald ein Auto leisten, sodass wir verreisen konnten. Wenn ich Appetit auf Bananen oder Apfelsinen hatte, würde ich die einfach im Laden kaufen. Und kein Uniform-Heini könnte mich je mehr demütigen. Ach ja, noch war das alles Zukunftsmusik.
Wieder trank ich von meinem Bier.
»Du grübelst zu viel.« Rolf prostete mir mit seiner Bierflasche zu. »Komm, lass uns eine Partie Schach spielen.«