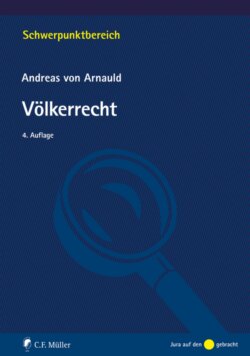Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 137
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Protest
Оглавление272
Mit einem Protest bringt ein Völkerrechtssubjekt zum Ausdruck, dass es das Verhalten eines anderen Völkerrechtssubjekts für rechtswidrig bzw. eine Rechtsbehauptung für unzutreffend hält. Der Protest dient der Rechtswahrung auf Seiten des Protestierenden: Er verhindert, dass dieser eines Rechts im Wege der acquiescence (dazu sogleich) verlustig geht; er kann erreichen, dass eine im Entstehen begriffene Norm des Gewohnheitsrechts den Protestierenden nicht erfasst;[83] geht es um eine Änderung zwingenden Völkerrechts können Proteste die Rechtsänderung sogar ganz verhindern, da diese Normen von der internationalen Gemeinschaft als ganzer getragen sein müssen. Dies gibt dem einzelnen Staat (oder zumindest einer Gruppe von Staaten) eine Vetoposition bei Veränderung der Grundwerte der Völkerrechtsgemeinschaft.
273
Wird ein Protest unterlassen, wo er zu erwarten gewesen wäre, kann auf Seiten des sich still Verhaltenden ein Rechtsverlust eintreten: Er wird so behandelt, als habe er stillschweigend in die Situation eingewilligt. Über diesen Grundsatz der sog. acquiescence (entspricht dem römisch-rechtlichen Grundsatz qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset: „wer schweigt, scheint zuzustimmen, wenn er hätte reden müssen und können“, kurz: Qui-tacet-Grundsatz) ist es also möglich, dass rechtsgeschäftliche (oder auch gewohnheitsrechtliche) Bindungen durch Schweigen eintreten oder erlöschen.[84] Hier wird aus Anlass einer einseitigen Erklärung ein Konsens der Beteiligten unwiderleglich vermutet.
So blieb z. B. die Erklärung Österreichs von 1990, dass es die Rüstungsbeschränkungsklauseln im österreichischen Staatsvertrag von 1955 als obsolet betrachte, unwidersprochen, weswegen die Klauseln auch mit Wirkung gegenüber den Vertragsparteien als erloschen anzusehen sind.
Tempel von Preah Vihear (IGH 1962)[85]
Kambodscha und Thailand stritten sich über das Gebiet des Tempels von Preah Vihear im Grenzgebiet zwischen beiden Staaten. Thailand stützte sich auf einen Vertrag des Königreichs Siam (das heutige Thailand) mit Frankreich (der damaligen Protektoratsmacht für Kambodscha) aus dem Jahre 1904, der dieses Gebiet Thailand zuordnete. Kambodscha dagegen berief sich auf eine Karte, die von französischen Experten im Auftrag einer durch den Vertrag eingesetzten Grenzkommission 1907 erstellt wurde. Dieser Karte zufolge, die an Thailand übergeben und auch veröffentlich wurde, gehörte das Gebiet zu Kambodscha.
Der IGH sprach das Gebiet des Tempels Kambodscha zu. Zur Begründung stellte es auf die Karte ab, die Thailand bekannt gewesen sei. Von Thailand wäre zu erwarten gewesen, gegen den unrichtigen Grenzverlauf zu protestieren. Indem Thailand den Protest hiergegen unterlassen habe, habe es stillschweigend den veränderten Grenzverlauf akzeptiert. Auf einen Irrtum könne sich Thailand nicht berufen, weil dieser vermeidbar gewesen sei.
Das Urteil hatte keine befriedende Wirkung, nicht zuletzt, weil nur der engere Tempelbezirk Gegenstand des Verfahrens war. Seit Ende der 1990er Jahre kam es erneut zu Spannungen, die Anfang 2011 in bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen beiden Staaten mündeten. Kambodscha hat im Mai 2011 den IGH um eine Interpretation seines Urteils von 1962 ersucht. In einer einstweiligen Anordnung v. 18. Juli 2011 hat der IGH um den Tempel herum eine demilitarisierte Zone festgelegt und beide Parteien zum sofortigen Rückzug ihrer Truppen aus dieser Zone aufgefordert. In seinem Auslegungs-Urteil v. 11. November 2013 erklärte der IGH, dass der gesamte Tempelberg zu Kambodscha gehöre.