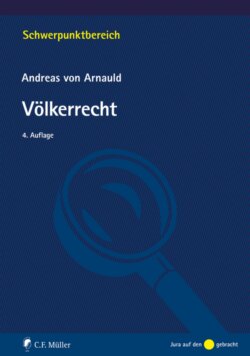Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 131
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Feststellung von Gewohnheitsrecht
Оглавление259
Ein Problem beim Gewohnheitsrecht ist seine Feststellung. Nach traditioneller Auffassung ist die Praxis das Primäre, so dass zunächst die einschlägige Staatenpraxis zusammenzutragen ist, um anschließend Indizien für eine Überzeugung zu sammeln, dass diese Praxis Ausdruck einer Rechtspflicht ist.[60] Diese Aufgabe wird erleichtert, wenn man einem moderneren Ansatz folgend umgekehrt an der Rechtsüberzeugung ansetzt und für diese Bestätigungen in der Staatenpraxis sucht. Im Nicaragua-Urteil von 1986 hat der IGH in diesem Sinne formuliert: „The Court must satisfy itself that the existence of the rule in the opinio juris of States is confirmed by practice.“[61] Unterstützend gibt es die Möglichkeit, Rechtsprechung und Literatur als Rechtserkenntnisquellen heranzuziehen (vgl. Art. 38 Abs. 1 lit. d IGH-Statut). Dennoch bleibt die Arbeit oft eine mühselige, die keine eindeutigen Ergebnisse zu Tage fördert. Da gegen Gewohnheitsrecht verstoßen werden kann (nicht darf!), sind – auch wiederholte – Fälle von Nichtbeachtung noch kein Grund, das Bestehen einer gewohnheitsrechtlichen Pflicht zu verneinen.[62] Bei zahlreichen Regeln ist daher umstritten, ob sie gewohnheitsrechte Geltung beanspruchen können oder nicht. Um Streit über die Existenz einer Gewohnheitsrechtsnorm zu vermeiden, bietet sich die Verschriftlichung an. Insbesondere die UN-Völkerrechtskommission (ILC) ist mit der Ausarbeitung völkerrechtlicher Verträge befasst, die zu einem großen Teil bereits gewohnheitsrechtlich geltendes Völkerrecht kodifizieren, aber darüber hinaus auch neue Regelungen enthalten können.[63] Auf diese Weise kann Gewohnheitsrecht zusätzlich vertragliche Geltung erlangen, was den Streit über die gewohnheitsrechtliche Geltung erübrigt und auch mit größerer Genauigkeit den Inhalt der Norm bestimmen lässt.
260
Umgekehrt kann auch aus Vertragsrecht Gewohnheitsrecht entstehen, wenn Staaten vertragliche Pflichten unabhängig von einer vertraglichen Verpflichtung als bindend betrachten (z. B. Genfer Rotkreuz-Konventionen, Gewaltverbot aus Art. 2 Nr. 4 UNCh). Hierzu hat der IGH in seinem Festlandsockel-Urteil von 1969 richtungweisende Aussagen getroffen. Danach muss es sich um Regelungen mit einem grundlegenden normbildenden Charakter[64] handeln, die sich aus einem Vertrag mit umfassender und repräsentativer Beteiligung ergeben und eine nahezu (!) einheitliche Staatenpraxis zur Folge haben. Die ILA hält es in ihrer Prinzipienerklärung in seltenen Ausnahmefällen sogar für möglich, dass ein Vertrag aus sich heraus („of its own impact“) Gewohnheitsrecht schafft, wenn er seinem Inhalt nach auf eine universelle Geltung gerichtet ist. Sie nennt hier die UN-Charta (vgl. Art. 2 Nr. 6 UNCh) sowie Teile der Genfer Rotkreuz-Konventionen.[65] Man wird auch den Nichtverbreitungsvertrag zu diesen Fällen rechnen können (vgl. Rn. 1158).
Festlandsockel-Fall (IGH 1969)[66]
Die Bundesrepublik Deutschland stritt mit Dänemark und den Niederlanden vor dem IGH um die Abgrenzung ihrer aneinandergrenzenden Festlandsockel in der Nordsee. Art. 6 der Genfer Konvention über den Festlandsockel von 1958 sah hierfür die Anwendung des Äquidistanzprinzips vor. Die Bundesrepublik war nicht Partei der Genfer Konvention und somit nicht an sie gebunden, Dänemark und die Niederlande behaupteten jedoch, die Regel in Art. 6 habe sich seit 1958 zu allumfassend geltendem Völkergewohnheitsrecht entwickelt.
Der IGH stellte fest, dass eine völkervertragliche Regelung zu Völkergewohnheitsrecht werden kann, wenn ihr ein grundlegender normbildender Charakter zukommt. Dies kann auch in relativ kurzer Zeit erfolgen, wenn der Vertrag umfassende und repräsentative Beteiligung erfährt. Die Staatenpraxis muss in dieser Zeit weitverbreitet und nahezu einheitlich sein. Zudem müssen die Staaten dabei die notwendige opinio juris haben, d. h. die Ansicht, dass sie in Übereinstimmung mit einer völkerrechtlichen Verpflichtung handeln und nicht nur aus Courtoisie, Bequemlichkeit oder Tradition. Im konkreten Fall hielt der IGH die Staatenpraxis nicht für ausreichend, damit Art. 6 zu Völkergewohnheitsrecht erstarken konnte.