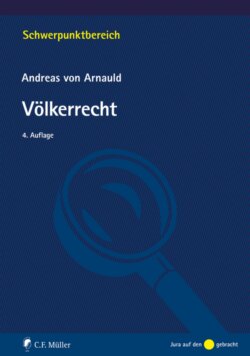Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 111
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Rechtsquellen des Völkervertragsrechts
Оглавление196
Wie völkerrechtliche Verträge geschlossen, ausgelegt, geändert, suspendiert und beendet werden können, hat sich über lange Zeit gewohnheitsrechtlich herausgebildet und entwickelt. Eine Kodifikation dieser Regeln – sowie einige Neuerungen, die nicht Bestandteil des Gewohnheitsrechts waren – findet sich seit 1969 in der Wiener Vertragsrechts-Konvention (WVK; Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, in Kraft seit 1980), die auf Arbeiten der ILC beruht.[8] Diese Regeln sind für die Vertragsparteien nunmehr kraft Vertrages gültig. Die WVK hat heute 116 Vertragsstaaten (Stand: Juni 2019), darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Angesichts dieser Akzeptanz und der generellen Orientierung an ihren Regeln im völkerrechtlichen Verkehr dürften diejenigen ihrer Bestimmungen, die nicht zuvor bereits Gewohnheitsrecht waren, inzwischen mehrheitlich zu Gewohnheitsrecht erstarkt sein.
197
Wie bei allen anderen Verträgen auch ist der Anwendungsbereich der WVK in dreifacher Hinsicht begrenzt:
| – | sachlich (ratione materiae): Die WVK behandelt nur schriftliche völkerrechtliche Verträge zwischen Staaten, vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 3 WVK. Nicht erfasst sind mündliche Verträge, privat-, staats- oder verwaltungsrechtliche Verträge oder Verträge mit oder zwischen Internationalen Organisationen. Zu den letzteren existiert das an den Regeln der WVK orientierte Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge zwischen Staaten und Internationalen Organisationen oder zwischen Internationalen Organisationen von 1986 (WVKIO), das noch nicht in Kraft getreten ist. |
| – | persönlich (ratione personae): Die WVK ist selbst ein Vertrag und bindet daher nur die Vertragsparteien. Die meisten Regeln des Übereinkommens stellen jedoch, wie ausgeführt, zugleich Gewohnheitsrecht dar und binden auch Nichtparteien. |
| – | zeitlich (ratione temporis): Die WVK gilt nur für Verträge, die nach ihrem Inkrafttreten geschlossen wurde (ausdrücklich in Art. 4 geregelt). Hierin zeigt sich der Grundsatz des sog. intertemporalen Rechts, wonach rechtlich relevante Handlungen in der Regel am Maßstab des Rechts zu messen sind, das zum Zeitpunkt der Vornahme dieser Handlungen gegolten hat.[9] Auch für das Völkerrecht gilt also, dass es regelmäßig keine Rückwirkung hat (vgl. Art. 28 WVK). Da die wichtigsten Regeln der WVK schon vor 1969 als Gewohnheitsrecht anerkannt waren, können auch ältere Verträge nach diesen Regeln behandelt werden. Im Einzelnen kann eine Diskussion darüber nötig werden, ob die konkrete anzuwendende Regel hierunter fällt. |
198
Die Regelungsgegenstände der WVK erinnern an das BGB. Während innerstaatlich die Regeln über Grundsätze, Verfahren und Grenzen des Vertragsschlusses in Form eines Gesetzes festgelegt sind, greift das Völkerrecht hierfür auf genossenschaftliche Handlungsformen (Gewohnheitsrecht oder Vertrag) zurück. Dass die WVK ein „Vertrag über Verträge“ ist, führt zu Selbstbezüglichkeiten: So bestimmt Art. 28 WVK, dass Verträge, die unter der WVK geschlossen werden, keine Rückwirkung haben; Art. 4 WVK regelt ebenfalls den Grundsatz der Nichtrückwirkung – allerdings für die WVK selbst.
199
Fall: Gentlemen’s Agreement?
Nach einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Nachbarländer Askanien und Bethanien wird eine von beiden Seiten autorisierte „Gemeinsame Schlusserklärung“ veröffentlicht, wonach beide Staaten den Abbau von Grenzkontrollen befürworten. Dadurch sollen bilateral Völkerverständigung und Handel gefördert werde. Einige Zeit später entsteht zwischen beiden Regierungen Streit darüber, ob mit der Erklärung rechtsverbindliche Verpflichtungen übernommen wurden: Askanien hält die Erklärung für verbindlich, Bethanien nicht. Wie ist die Rechtslage? Kommt es darauf an, ob beide Staaten Vertragsparteien der WVK sind?
Lösungsskizze:
1. Völkerrechtliche Verträge müssen nicht als solche bezeichnet werden, so dass grundsätzlich denkbar ist, dass es sich bei der „Gemeinsamen Erklärung“ um einen Vertrag handelt. Die Erklärung bringt eine Vereinbarung zwischen den beiden Staaten (vertreten durch ihre Staats- und Regierungschefs) zum Ausdruck, die sich auch auf einen völkerrechtlichen Gegenstand (Abbau der Grenzkontrollen bezieht). Allerdings ist das Vorliegen eines Rechtsbindungswillens zweifelhaft. Dieser fehlt nicht bereits, weil Bethanien bestreitet, gebunden zu sein – es kommt auf eine objektivierte Betrachtung an. Allerdings deuten die wenig konkrete Formulierung, der Abbau von Grenzkontrollen werde „befürwortet“ und der Hinweis auf so allgemeine Ziele wie Völkerverständigung und Handel auf eine bloße politische Absichtserklärung hin, durch die sich die Parteien nicht binden wollten.
2. Ob die beiden Staaten Vertragsparteien der WVK sind, ist irrelevant, weil die Definition des völkerrechtlichen Vertrags aus Art. 2 Abs. 1 lit. a WVK inhaltsgleich mit dem hier zu Grunde gelegten gewohnheitsrechtlichen Begriff des völkerrechtlichen Vertrages ist.