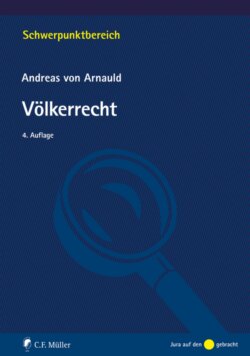Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 128
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Übung (consuetudo)
Оглавление252
An der internationalen Übung nehmen alle Völkerrechtssubjekte, also auch Internationale Organisationen (IO), teil. Die wohl h. M. hält dagegen am Dogma der „Staatenpraxis“ fest und interpretiert den Beitrag von IO zum Völkerrecht noch immer als Beitrag der Mitgliedstaaten. Eine solche bloß indirekte Beteiligung der IO an der Völkerrechtsentwicklung wirkt gekünstelt und wird dem eigenständigen Beitrag zumindest „starker“ Organisationen wie der UNO oder der EU nicht gerecht.[49] Innerhalb von Staaten sind v. a. Exekutive und Legislative die maßgeblichen Träger der relevanten Praxis. Die Rolle der innerstaatlichen Gerichte ist schwieriger zu beurteilen: Nach Art. 38 Abs. 1 lit. d IGH-Statut sind ihre Entscheidungen Hilfsmittel für die Erkenntnis von Rechtsnormen. Begreift man Rechtsprechung jedoch auch als rechtsschöpferischen Akt, kann man Gerichtsentscheidungen als Teil der Staatenpraxis begreifen – jedenfalls sofern sie über bloße Rechtsfeststellungen hinausgehen.[50] Wo Gerichte das Handeln der beiden ersten Gewalten im Staat steuern, beeinflussen sie zumindest mittelbar die Praxis ihres Staates; unmittelbar relevant sind Gerichte namentlich dort, wo es um Verfahrensfragen geht (Standards fairer Verfahren, Immunitätenfragen usw.). Problematisch kann auch sein, die innerstaatliche Praxis heranzuziehen: Hier kann es sein, dass ein Staat sich in einer bestimmten Weise verhält, weil er sich verfassungsrechtlich, nicht aber völkerrechtlich hierzu verpflichtet sieht.
In einem gemeinsamen Schreiben an den Präsidenten des IKRK haben die Rechtsberater des Außen- und des Verteidigungsministeriums der USA, John Bellinger und William Haynes, u. a. kritisiert, dass das IKRK für seine 2005 publizierte Studie zum gewohnheitsrechtlich geltenden humanitären Völkerrecht auch auf US-Militärhandbücher zurückgegriffen habe, die rein internen Charakter besäßen.[51]
253
Die Entstehung von Gewohnheitsrecht setzt eine gewisse Dauer, Einheitlichkeit und Verbreitung der Übung voraus, ohne dass hier konkrete Zahlen genannt werden könnten. Es genügt, auf eine verbreitete und repräsentative Praxis abzustellen.[52] Diese „Quasi-Universalität“ bewirkt, dass große Staaten es leichter haben als kleine, eine neue Übung zu etablieren, nicht zuletzt, weil ihr Verhalten mehr Aufmerksamkeit erlangt. Dennoch ist es möglich, dass sich eine Gewohnheitsrechtsnorm auch gegen die Position eines „big player“ entwickelt; dieser erhält gegebenenfalls den Status eines persistent objector (Rn. 257–258). Ob sich an einer Praxis die überwiegende Zahl der Staaten aktiv beteiligen muss oder ob auch die Duldung der Praxis einiger Staaten durch die Staatenmehrheit ausreicht, ist umstritten. Betrifft eine Gewohnheitsrechtsnorm nur bestimmte Staaten auf Grund ihrer Beschaffenheit (z. B. als Küsten- oder als Archipelstaaten) oder ihrer Fähigkeiten (z. B. zur Weltraumnutzung), kommt es maßgeblich auf die Praxis und Haltung dieser Staaten an.
254
Das Völkergewohnheitsrecht ist überwiegend universell, d. h. seine Regeln gelten weltweit für alle Völkerrechtssubjekte. Daneben gibt es aber auch regionales Gewohnheitsrecht. Ein klassisches Beispiel ist das diplomatische Asyl, das allein in Südamerika gewohnheitsrechtlich verankert ist (Rn. 586). Als weiteres Beispiel mag das Verbot der Todesstrafe gelten, das angesichts umfassender Ächtung der Todesstrafe in völkerrechtlichen Abkommen (v. a. ZP 6 und 13 zur EMRK), im nationalen Verfassungsrecht und in verschiedenen Resolutionen in Europa gewohnheitsrechtlich gilt.
Asyl-Fall I (IGH 1950)[53]
Nach einem erfolglosen Putschversuch gegen die peruanische Regierung im Oktober 1948 flüchtete sich der Anführer der linkspopulistischen American People’s Revolutionary Alliance, Haya de la Torre, in die kolumbianische Botschaft in Lima. Vor dem IGH stritten sich Peru und Kolumbien über das Recht Kolumbiens, Haya de la Torre diplomatisches Asyl in den Räumlichkeiten der Mission zu gewähren.
Der IGH erklärte die Gewährung diplomatischen Asyls durch Kolumbien für rechtswidrig. Zwar hielt er regionales Gewohnheitsrecht für grundsätzlich möglich, sah aber noch nicht genügend Anzeichen für die Existenz eines Rechtssatzes, der die Gewährung diplomatischen Asyls in Südamerika trage. In jedem Fall hätte sich Peru einem solchen Anspruch stets widersetzt und wäre somit als persistent objector (Rn. 257–258) nicht gebunden. In seinem abweichenden Votum bestätigte dagegen v. a. der chilenische Richter Alvárez die Existenz eines entsprechenden Gewohnheitsrechts in Südamerika.