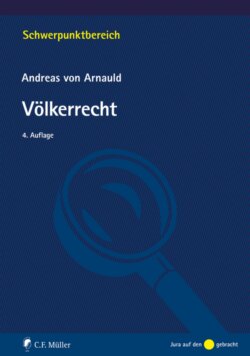Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 141
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. Rechtserkenntnisquellen
Оглавление280
Als nichtschriftliche Rechtsquelle ist namentlich das Gewohnheitsrecht nicht leicht feststellbar (Rn. 259). Auch die Ermittlung allgemeiner Rechtsgrundsätze oder die Auslegung völkerrechtlicher Verträge kann vor Schwierigkeiten stellen. Hier spielen die Entscheidungen von Gerichten und Schiedsgerichten sowie die veröffentlichten Meinungen anerkannter Völkerrechtler eine wichtige Rolle. Art. 38 Abs. 1 lit. d IGH-Statut räumt ihnen den Status einer Rechtserkenntnisquelle („Hilfsmittel“) zur Ermittlung von Völkerrecht ein.
281
Als Rechtserkenntnisquelle können internationale wie nationale Gerichte dienen. Soweit nationale Gerichte rechtsschöpferisch tätig sind (Rn. 252), bewegen sie sich in einer Doppelrolle als Akteure und als Interpreten des Völkerrechts. Internationale Gerichte sind mit der Einordnung unter die bloßen „Hilfsmittel“ ebenfalls nur unzureichend charakterisiert. Auch ohne eine Präjudizienbindung besitzen v. a. Judikate des IGH erhebliche Orientierungswirkung für den internationalen Rechtsverkehr. Dass insbesondere die rechtsquellentheoretischen Fragen rund um das Gewohnheitsrecht den richterlichen Erkenntnisakt zu einem rechtsschöpferischen Akt machen, ist an anderer Stelle ausgeführt worden (Rn. 263). Gerade auch über eine persuasive authority wirken Gerichte – natürlich abhängig von ihrer Reputation – nicht selten auf die nachfolgende Staatenpraxis ein. So hat sich Belgien im Verfahren vor dem IGH über den belgischen Haftbefehl gegen den kongolesischen Außenminister etwa auf das Pinochet-Urteil des britischen House of Lords berufen.[88]
282
Die „Lehrmeinung der fähigsten Völkerrechtler der verschiedenen Nationen“ verweist schließlich auf die wichtige Rolle, die die Völkerrechtswissenschaft im Zusammenwirken mit den Gerichten bei der Konsolidierung, Konkretisierung und Fortentwicklung des Völkerrechts spielt. Der IGH zitiert – im Gegensatz zu anderen internationalen und nationalen Gerichten – in seinen Urteilen praktisch nie Werke einzelner Autoren namentlich; dennoch werden völkerrechtswissenschaftliche Publikationen vom Gerichtshof zur Kenntnis genommen und können hintergründigen Einfluss auf die Entscheidung erlangen. Wer zu den „fähigsten Völkerrechtlern der verschiedensten Nationen“ zählt, ist von der Reputation oder einer besonderen Expertise in dem fraglichen Rechtsgebiet abhängig. Von großer Bedeutung sind Institutionen, die gebündelten völkerrechtlichen Sachverstand repräsentieren. An erster Stelle ist hier die ILC zu nennen, daneben das Institut de Droit International (eine Vereinigung von höchstens 132 Gelehrten des internationalen Rechts, die ihre Neumitglieder über ein Kooptationsprinzip selbst auswählt) und die International Law Association (eine weltweit verzweigte Nichtregierungsorganisation, die der Pflege und der Verbreitung des Völkerrechts dient).[89] Diese Institutionen werden selbst in den Entscheidungen des IGH des Öfteren zitiert.
Vertiefende Literatur zu E.:
J. d'Aspremont, Softness in International Law: A Self-Serving Quest for New Legal Materials, EJIL 19 (2008), 1075; ders., La doctrine du droit international face à la tentation de la «juridicisation» sans limites, RGDIP 112 (2008), 849; ders. u. a. (Hg.), International Law as a Profession, 2018; M. Barelli, The Role of Soft Law in the International Legal System, ICLQ 58 (2009), 957; L. Blutman, In the Trap of a Legal Metaphor: International Soft Law, ICLQ 59 (2010), 605; A. v. Bogdandy/I. Venzke (Hg.), International Judicial Lawmaking, 2012; E. De Brabandere, The Use of Precedent and External Case Law by the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea, LPICT 15 (2016), 24; I. Breutz, Der Protest im Völkerrecht, 1997; O. Dilling/M. Herberg/G. Winter (Hg.), Transnational Administrative Rule-Making, 2011; C. Eckart, Promises of States under International Law, 2012; C. Eick, Protest, MPEPIL (7/2006); M. Frenzel, Sekundärrechtsetzungsakte internationaler Organisationen: Völkerrechtliche Konzeption und verfassungsrechtliche Voraussetzungen, 2011; S. Gadinis, Three Pathways to Global Standards: Private, Regulator, and Ministry Networks, AJIL 109 (2015), 1; A. Guzman/T. Meyer, International Common Law: The Soft Law of International Tribunals, ChiJIL 9 (2008/09), 515; H. Hillgenberg, Soft Law im Völkerrecht, ZEuS 1998, 81; B. B. Jia, International Case Law in the Development of International Law, RdC 382 (2015), 175; E. Kassoti, The Juridical Nature of Unilateral Acts in International Law, FinnYIL 23 (2012/13), 411; dies., Unilateral Acts Revisited: Common Law v. Civil Law Approaches and Lessons from the International Law Commission’s (Failed) attempt to Codify Unilateral Acts of State, HYIL 26 (2013), 168; J. Klabbers, Reflections on Soft International Law in a Privatized World, FYIL 16 (2005), 313; S. Kopela, The Legal Value of Silence as State Conduct in the Jurisprudence of International Tribunals, AYIL 29 (2010), 87; S. Kratzsch, Rechtsquellen des Völkerrechts außerhalb von Artikel 38 Abs. 1 IGH-Statut, 2000; F. Lüth, Soft Law in International Arbitration: Some Thoughts on Legitimacy, StudZR 2012, 409; N. S. Marques Antunes, Acquiescence, MPEPIL (9/2006); T. Milej, Entwicklung des Völkerrechts durch internationale Gerichte und Sachverständigengremien, 2014; K. Parrot-Gibert, La jurisprudence interne, «source» de droit international conventionnel?, RGDIP 113 (2009), 19; V. Pergantis, Soft Law, Diplomatic Assurances and the Instrumentalisation of Normativity: Wither a Liberal Promise?, NILR 56 (2009), 137; A. Pronto, Understanding the Hard/Soft Distinction in International Law, VJTL 48 (2015), 941; A. Roberts, Comparative International Law? The Role of National Courts in Creating and Enforcing International Law, ICLQ 60 (2011), 57; V. Rodríguez Cedeño/M. Torres Cazorla, Unilateral Acts of States in International Law, MPEPIL (2/2013); P. Saganek, Unilateral Acts of States in Public International Law, 2016; S. Sivakumaran, The Influence of Teachings of Publicists on the Development of International Law, ICLQ 66 (2017), 1; E. Suy/N. Angelet, Promise, MPEPIL (12/2007); D. Thürer, Soft Law, MPEPIL (3/2009); S. Torp Helmersen, Scholarly-Judicial Dialogue in International Law, JLPICT 16 (2017), 464; M. Wood, Teachings of the Most Highly Qualified Publicists (Art. 38 (1) ICJ Statute), MPEPIL (10/2010).
Teil I Allgemeines Völkerrecht › § 3 Quellen des Völkerrechts › F. Verhältnis zwischen den Rechtsquellen