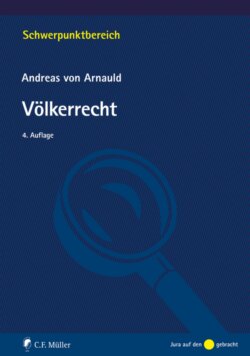Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 140
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Soft law
Оглавление278
Die Bezeichnung „soft law“ ist irreführend, da es sich nicht um Recht handelt, sondern um nicht rechtsverbindliche Resolutionen, Erklärungen und Übereinkünfte. Die beteiligten Akteure wollen sich hier gerade nicht rechtlich binden. Das soft law spielt in den internationalen Beziehungen eine große Rolle und kann auch als Initiator oder als Katalysator zur Herausbildung von (verbindlichem) Völkerrecht beitragen, etwa indem Standards des soft law in Verträge aufgenommen werden oder wenn sich im Laufe der Zeit zu der Praxis eine Rechtsüberzeugung entwickelt. Beispiele für solche „Verrechtlichungsprozesse“ sind die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948), der heute in weitem Umfang gewohnheitsrechtliche Geltung beigemessen wird und die namentlich für die internationale „Bill of Rights“ (UN-Zivilpakt, UN-Sozialpakt) als Vorbild gedient hat, oder die Erklärung von Rio (1992), die die Entstehung von Gewohnheits- und Vertragsrecht im Umweltvölkerrecht nachhaltig beeinflusst hat.
279
Resolutionen von Organen Internationaler Organisationen können außerdem auslegungsleitende Bedeutung für ihnen anvertraute Verträge erlangen. Dies gilt z. B. für Resolutionen der UN-Generalversammlung. Mit ihrer Prinzipien-Resolution (Friendly Relations Declaration) von 1970 hat sie einen wichtigen Beitrag zur Interpretation der Grundsätze des Art. 2 UNCh geleistet und mit der Aggressions-Definition (1974) den Begriff der „Angriffshandlung“ in Art. 39 UNCh maßgeblich konkretisiert. Auch die General Comments des UN-Menschenrechtsausschusses zum IPBPR geben – trotz fehlender Rechtsverbindlichkeit – wichtige Anhaltspunkte zur Auslegung der Rechte des UN-Zivilpakts. Insbesondere im Bereich der Menschenrechte führen solche Wechselbezüge zwischen soft law und verbindlichen Normen zur Ausbildung von Menschenrechtsstandards.[87]