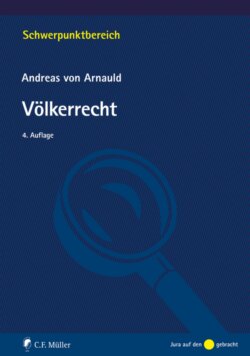Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. „Realistische“ Schulen
Оглавление13
Die Zwangstheorie wirkt bis heute in der „realistischen“ Schule der Internationalen Beziehungen (International Relations) nach. Die Begründer dieser politikwissenschaftlichen Theorierichtung (v. a. Hans Morgenthau [1904-1980][14]) kamen nicht zuletzt unter dem Eindruck wiederholter schwerer Völkerrechtsbrüche während der NS-Zeit zu der Ansicht, dass Völkerrecht eine Form internationaler Moral ohne rechtliche Bindungskraft sei. Nicht im Recht, sondern allein in der Macht und im Streben nach ihr soll danach das bestimmende Moment der internationalen Beziehungen liegen.[15] Ein solcher theoretischer Ansatz ist für die Völkerrechtswissenschaft nicht anschlussfähig, da für sie Begründung, Interpretation und Durchsetzung völkerrechtlicher Normen im Mittelpunkt stehen. Anders steht es mit solchen Theorien, die im Recht eine zumindest mitbestimmende Größe in den internationalen Beziehungen erblicken.
14
Die in „realistischer“ Tradition stehende New Haven School (Myres McDougal, Harold Lasswell u. a.) leugnet zwar nicht die Relevanz des Völkerrechts überhaupt, relativiert aber seine Bedeutung.[16] Aus Sicht ihres policy-oriented approach gibt es kein Primat des Völkerrechts vor der Politik; das Völkerrecht ist vielmehr ein Abwägungsgesichtspunkt im außenpolitischen Entscheidungsprozess. Eine solche Sicht mag die US-Außenpolitik in vielem treffend analysieren, eignet sich aber nicht als normatives Grundmodell der internationalen Beziehungen. Seiner Idee nach muss das Völkerrecht als Recht auf Einhaltung bestehen. Ein Verstoß gegen das Völkerrecht mag von einem Staat gelegentlich um anderer Interessen wegen in Kauf genommen werden, wenn er meint, sich dies erlauben zu können; er bleibt aber ein Völkerrechtsbruch.