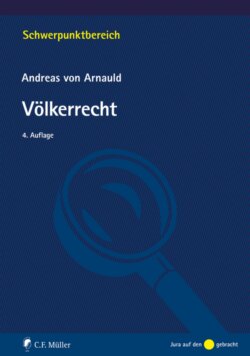Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Konstitutionalisierungsprozesse im modernen Völkerrecht
Оглавление29
Durch den Prozess der Globalisierung hat das lange Zeit primär auf Koordination angelegte Völkerrecht in den Jahrzehnten nach 1945 einen stärker kooperativen Zug erhalten: Es geht um die Vereinbarung gemeinsamer Maßnahmen gegen gemeinsame Probleme. Je mehr Probleme die staatlichen Grenzen überschreiten, desto mehr werden Lösungen auf internationaler Ebene gesucht. Die Politikwissenschaft widmet sich diesen Phänomenen im Rahmen des Diskurses über „Global Governance“ (oder auch „Weltordnungspolitik“), in dem es unter anderem auch, aber nicht allein, um die Rolle des Völkerrechts geht.[30] Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive hingegen steht die Fortentwicklung des Völkerrechts im Mittelpunkt des Interesses: Zu beobachten ist eine zunehmende „Vervölkerrechtlichung“ vieler Politikbereiche, d. h. eine steigende Regelungsdichte auf völkerrechtlicher Ebene.[31] Hand in Hand mit dieser Entwicklung geht der Aufstieg der Internationalen Organisationen ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
30
Dabei bleibt es nicht aus, dass das Völkerrecht sowohl in inhaltlicher als auch in institutioneller Hinsicht Strukturen ausprägt, die an das innerstaatliche Recht erinnern. Hier setzt der sog. public law approach im Völkerrecht an. Ihm verwandt ist die Konstitutionalisierungsschule, die v. a. in der deutschen Völkerrechtswissenschaft einflussreich ist (u. a. Hermann Mosler, Jost Delbrück, Bruno Simma und Christian Tomuschat als Wegbereiter der Diskussion).[32] Die Spielarten von „Konstitutionalismus“ und „Konstitutionalisierung“ sind dabei vielfältig: Teils wird die Idee einer internationalen Gemeinschaft in den Mittelpunkt gerückt,[33] die gemeinsame Werte teilt (v. a. Menschenrechte, aber auch das Gewaltverbot), teils eher institutionell auf die Bedeutung starker Internationaler Organisationen abgestellt, namentlich auf die Vereinten Nationen als Organisation von quasi-universeller Bedeutung, deren Satzung (Charta) der Charakter eines Verfassungsdokuments attestiert wird.[34] Während einige Autoren das Ergänzungsverhältnis von staatlichen Verfassungen (die im Prozess der „Vervölkerrechtlichung“ ihre Vollständigkeit einbüßen) und internationalem Recht in der Gesamtperspektive betrachten,[35] fokussieren andere allein auf veränderte rechtliche Strukturen der internationalen Beziehungen. Schließlich lässt sich der Konstitutionalismus als eher analytisch-empirisches Projekt betreiben (dann gibt es bereits Verfassungsstrukturen, die es zu beobachten gilt) oder als ein normatives Projekt (dann gilt es, die Konstitutionalisierung des internationalen Rechts im Dienste universeller Werte und von Gemeinschaftsinteressen zu fördern).
31
Tatsächlich weist das moderne Völkerrecht eine Reihe von Elementen auf, die sich nur bedingt in das „Westfälische“ Modell einordnen lassen – sowohl in inhaltlicher als auch in institutioneller Hinsicht. Diese Wandlungen hat vor allem das universelle Bekenntnis zu Menschenrechten ausgelöst (vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948[36]). Das vormals in erster Linie der Machtkoordination dienende Völkerrecht ist verstärkt in den Dienst der Menschen gestellt worden. Als universelle Standards ermöglichen die Menschenrechte Kritik auch an Zuständen im Inneren von Staaten und relativieren das Souveränitätsargument (Rn. 309, 313–315). Die souveräne Staatlichkeit ist aber auch durch die zunehmende Institutionalisierung unter Druck geraten: Die Einordnung in Internationale Organisationen führt zu einem Verzicht auf die Ausübung souveräner Rechte, am weitesten für die Mitgliedstaaten der EU. Auch die UNO dringt vermehrt in Bereiche staatlicher Politik vor, die vormals durch den Souveränitätsgrundsatz vor Einmischungen geschützt waren. So hat die weite Auslegung des Begriffs des Friedens durch den UN-Sicherheitsrat (Rn. 1055) Konsequenzen für die Ausgestaltung der innerstaatlichen Verhältnisse. Insoweit Friedensvoraussetzungen, d. h. die Bedingungen, unter denen Frieden bestehen kann, zu einem Staatengemeinschaftsinteresse geworden sind, können die Staaten sich nicht mehr darauf zurückziehen, dass es um interne Angelegenheiten gehe – ihr Inneres ist keine von der Außenwelt abgeschlossene black box mehr.
32
Es gibt demnach durchaus Tendenzen im Völkerrecht, welche die Konstitutionalisierungsthese stützen. Es handelt sich jedoch um allmähliche Prozesse, und die Strukturen, die sich bisher herausgebildet haben, bleiben hinter denen staatlicher Verfassungen weit zurück.[37] Zudem hat der Aufstieg neuer Regionalmächte (v. a. der sog. BRICS-Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), die z. T. ein traditionelleres Souveränitätsverständnis vertreten, den konstitutionalistischen Optimismus nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 1990 etwas gedämpft. Die Rede vom „post-westfälischen“ Zeitalter geht daher – zumindest völkerrechtlich betrachtet – zu weit. Umgekehrt ist das heutige Völkerrecht aber auch kein reines Koordinationsrecht mehr, sondern besitzt eine, wenn auch noch schwach ausgeprägte, „Verfassungsschicht“. Als eine „Denkhaltung“[38] kann die konstitutionelle Perspektive diese Wandlungen im modernen Völkerrecht erklären und begleiten helfen. Normativ geht es darum, internationale Institutionen zu stärken und universelle Werte behutsam im Dialog zu entfalten.[39] Zentrale Bedeutung für eine weitere „Konstitutionalisierung“ der internationalen Ordnung dürfte dabei haben, ob und wie einer möglichst breiten und repräsentativen Vielzahl von Akteuren Zugang zur wirkungsvollen Kritik der Normen und Verfahren internationaler Politik („Kontestation“) am Maßstab der Grundwerte der internationalen Gemeinschaft gegeben werden kann.[40]
33
Die konstitutionalistische Perspektive hilft dabei, Zusammenhänge zwischen den völkerrechtlichen Teilgebieten zu erkennen und einer von manchen diagnostizierten Fragmentierung des Völkerrechts entgegenzutreten.[41] Dabei geht es um die Beobachtung, dass durch eine zunehmende Ausdifferenzierung des Völkerrechtsstoffs völkerrechtliche Teilordnungen entstehen, die mehr und mehr ihren eigenen Regeln folgen. Hierdurch droht die Einheit des Völkerrechts in Gefahr zu geraten. So stellt sich z. B. die Frage, wie Belange des Menschenrechts- oder Umweltschutzes gegenüber der Eigenlogik einer Weltwirtschaftsordnung zur Geltung gebracht werden können (Rn. 230, 978–982).
34
Dass dieses Lehrbuch mit einem Allgemeinen Teil eröffnet wird, ist schon Ausdruck der Überzeugung, dass trotz solcher Eigenlogiken die Einheit des Völkerrechts nach wie vor existiert. Hinter der Vielfalt der Teilrechtsgebiete stecken letztlich dieselben Fragen nach Legitimation und Geltung, nach Rechtsgrundlagen und Verfahren. Gemeinsame Grundwerte, allen voran universelle Menschenrechtsstandards und das Streben nach Frieden, verlangen in allen Gebieten des Völkerrechts nach Beachtung. Eine wichtige Rolle spielt dabei die in Art. 31 Abs. 3 lit. c WVK niedergelegte Regel, wonach bei der Interpretation völkerrechtlicher Verträge alle zwischen den Parteien geltenden einschlägigen Völkerrechtssätze zu beachten sind. Dies bürgt für eine Integration auch konkurrierender völkerrechtlicher Pflichten in die Vertragspraxis.[42]
Vertiefende Literatur zu B.:
Zu I. und II. C. Amerasinghe, The Historical Development of International Law – Universal Aspects, AVR 39 (2001), 367; A. Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, 2005; A. v. Arnauld (Hg.), Völkerrechtsgeschichte(n): Historische Narrative und Konzepte im Wandel, 2016; J. d’Aspremont, The Critical Attitude and the History of International Law, 2019; J. Barthélemy u. a., Les fondateurs du droit international (1904), Neuausgabe 2014; A. Becker Lorca, Universal International Law: Nineteenth-century Histories of Imposition and Appropriation, HarvILJ 51 (2010), 475; ders., Mestizo International Law, 2015; T. Broude/Y. Shany, The Shifting Allocation of Authority in International Law, 2008; G. Gozzi, Rights and Civilizations: A History and Philosophy of International Law, 2019; W. Grewe, Vom europäischen zum universellen Völkerrecht, ZaöRV 42 (1982), 449; ders., Epochen der Völkerrechtsgeschichte, 1984; M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960, 5. Aufl. 2008; S. Neff, Justice among Nations: A History of International Law, 2014; J. Reynolds, Empire, Emergency and International Law, 2018; H. Steiger, Probleme der Völkerrechtsgeschichte, Staat 26 (1987), 103; ders., Von der Staatengesellschaft zur Weltrepublik? 2009; ders., Die Ordnung der Welt: Eine Völkerrechtsgeschichte des karolingischen Zeitalters (741 bis 840), 2010; ders., Universalität und Partikularität des Völkerrechts in geschichtlicher Perspektive, 2015; J. Verzijl, International Law in Historical Perspective (12 Bände), Leyden 1968-1998; K.-H. Ziegler, Zur Geschichtlichkeit des Völkerrechts, Jura 1997, 449. MPEPIL, Beiträge zu: History of International Law: W. Preiser, Basic Questions and Principles (12/1984), ders., Ancient Times to 1648 (12/1984), S. Verosta, 1648 to 1815 (12/1984), H.-U. Scupin, 1815 to World War I (12/1984), M. Koskenniemi, World War I to World War II (7/2007), ders., Since World War II (7/2007).
Zu III. M. Andenaes, Reassertion and Transformation: From Fragmentation to Convergence in International Law, GeorgeJIL 46 (2015), 685; ders./E. Bjorge (Hg.), A Farewell to Fragmentation, 2015; J. d’Aspremont/F. Dopagne, Two Constitutionalisms in Europe: Pursuing an Articulation of the European and International Legal Orders, ZaöRV 68 (2008), 939; A. Atilgan, Global Constitutionalism: A Socio-legal Perspective, 2018; M. Belov (Hg.), Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law, 2018; E. Benvenisti, The Conception of International Law as Legal System, GYIL 50 (2007), 393; ders., The Law of Global Governance, RdC 368 (2013), 47; ders./G. Nolte (Hg.), Community Interests Across International Law, 2018 B.-O. Bryde, Konstitutionalisierung des Völkerrechts und Internationalisierung des Verfassungsrechts, Staat 42 (2003), 61; O. Diggelmann/T. Altwicker, Is There Something Like a Constitution of International Law? ZaöRV 68 (2008), 623; A. Fischer-Lescano/P. Liste, Konstitutioneller Pluralismus der Weltgesellschaft, FS Bryde, 2013, 569; L. Gordillo, Interlocking Constitutions: Towards an Interordinal Theory of National, European and UN Law, 2012; A. Halpin/V. Roeben (Hg.), Theorising the Global Legal Order, 2009; E. Jouannet, What Is the Use of International Law? International Law as a 21st Century Guardian of Welfare, MichJIL 28 (2007), 815; S. Kadelbach, International Law – A Constitution for Mankind? GYIL 50 (2007), 303; S. Kadelbach/T. Kleinlein, Überstaatliches Verfassungsrecht: Zur Konstitutionalisierung im Völkerrecht, AVR 44 (2006), 235; J. Klabbers/A. Peters/G. Ulfstein, The Constitutionalization of International Law, 2011; J. Klabbers/T. Piiparinen (Hg.), Normative Pluralism and International Law: Exploring Global Governance, 2013; T. Kleinlein, Konstitutionalisierung im Völkerrecht: Konstruktion und Elemente einer idealistischen Völkerrechtslehre, 2012; M. Knauff, Konstitutionalisierung im inner- und überstaatlichen Recht – Konvergenz oder Divergenz?, ZaöRV 68 (2008), 453; M. Koskenniemi, Constitutionalism as Mindset: Reflections on Kantian Themes About International Law and Globalization, TIL 8 (2007), 9; D. Kühne, Materielle Konstitutionalisierung im Völkerrecht: Zum Entstehen einer internationalen Verfassungsordnung, 2014; M. Kumm, The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism, IJGLS 20 (2013), 605; I. Ley, Kant versus Locke: Europarechtlicher und völkerrechtlicher Konstitutionalismus im Vergleich, ZaöRV 69 (2009), 317; A. Mills, The Private History of International Law, ICLQ 55 (2006), 1; H. Mosler, The International Society as a Legal Community, 1980; M. Nettesheim, Das kommunitäre Völkerrecht, JZ 2002, 569; M. Neves, Transconstitutionalism, 2013; Y. Onuma, International Law in a Transcivilizational World, 2017; A. Paulus, Die internationale Gemeinschaft im Völkerrecht, 2001; M. Payandeh, Internationales Gemeinschaftsrecht, 2010; A. Peters, Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International Norms and Structures, LJIL 19 (2006), 579; dies., Merits of Global Constitutionalism, IJGLS 16 (2009), 397; M. Prost, The Concept of Unity in Public International Law, 2012; D. Pulkowski, The Law and Politics of International Regime Conflict, 2014; C. Schwöbel, Organic Global Constitutionalism, LJIL 23 (2010), 529; S. Seebaß, Staaten als de-facto-Verfassungsgeber im konstitutionalisierten Völkerrecht?, ARSP 105 (2019), 233; B. Simma, From Bilateralism to Community Interest in International Law, RdC 250 (1995), 225; B. Simma/A. Paulus, The “International Community”: Facing the Challenge of Globalization, EJIL 9 (1998), 266; A.-M. Slaughter, A New World Order, 2004; C. Tomuschat, Die internationale Gemeinschaft, AVR 33 (1995), 1; S. Villalpando, The Legal Dimension of the International Community: How Community Interests Are Protected in International Law, EJIL 21 (2010), 387; C. Walter, Constitutionalizing (Inter)national Governance: Possibilities for and Limits to the Development of an International Constitutional Law, GYIL 44 (2001), 170; P. Webb, International Judicial Integration and Fragmentation, 2016; E. de Wet, The International Constitutional Order, ICLQ 55 (2006), 51; dies., The Emergence of International and Regional Value Systems as a Manifestation of the Emerging International Constitutional Order, LJIL 19 (2006), 611; S. Wheatley, The Democratic Legitimacy of International Law, 2010; M. Young (Hg.), Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation, 2015.
Teil I Allgemeines Völkerrecht › § 1 Einführung in das Völkerrecht › C. Charakteristika des Völkerrechts