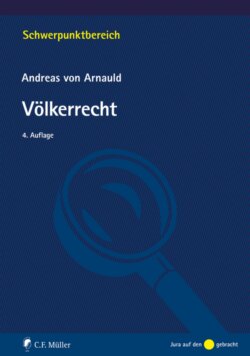Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 69
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Eingeschränkte Handlungsfähigkeit
Оглавление93
Eingeschränkte Handlungsfähigkeit ist u. a. kennzeichnend für besetzte Staaten. Diese bewahren ihre Souveränität und „Außenrechtsfähigkeit“, nur übt die Besatzungsmacht die Hoheitsgewalt treuhänderisch aus. Dass der besetze Staat seinen Status als Völkerrechtssubjekt bewahrt, ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass dem Besatzer gegenüber dem besetzten Staat Pflichten nach dem Recht des bewaffneten Konflikts obliegen (Rn. 1295–1302).
94
Die autonome Handlungsfähigkeit eines Staates kann außerdem durch Übertragung von Hoheitsrechten auf eine internationale oder supranationale Organisation eingeschränkt werden. Mit einer solchen Übertragung von Hoheitsrechten (z. B. Ermächtigung des UN-Sicherheitsrates zum Erlass rechtsverbindlicher Resolutionen in Art. 25 UNCh oder Unterwerfung unter die Gerichtshoheit des EGMR in Art. 46 EMRK) verzichtet der übertragende Staat nicht auf Teile seiner Souveränität, sondern lediglich darauf, bestimmte souveräne Rechte auszuüben. Dies wird darin deutlich, dass es dem Staat in letzter Konsequenz rechtlich möglich bleibt, aus der Organisation auszutreten. Dies gilt grundsätzlich auch für informelle Mittel der Steuerung von Politik durch internationale Institutionen („weiche“ Standards, Berichte usw.), die sich freilich in ihren eher indirekten Wirkungen rechtlich schwer rückbinden lassen.[54]
95
Von diesen völkerrechtlichen Grundsätzen hat sich die Europäische Union inzwischen in mehrfacher Hinsicht entfernt. Schon seit den 1960er Jahren betont der EuGH die Eigenständigkeit der Unionsrechtsordnung: Das Unionsrecht ist weder „gewöhnliches“ Völkerrecht noch innerstaatliches Recht. Völkerrecht findet nur in Außenbeziehungen der EU Anwendung, nicht im Binnenverhältnis zu den Mitgliedstaaten. Das Unionsrecht ist autonom; seine Regeln sind nach eigenen Maßstäben auszulegen.[55] Kennzeichnend für den supranationalen (also überstaatlichen, nicht zwischenstaatlichen) Charakter der EU sind die Grundsätze des Vorrangs und der unmittelbaren Anwendbarkeit des Unionsrechts. Mit dem über die Jahrzehnte erreichten Integrationsstand und dem Ziel einer „immer engeren Union der Völker Europas“ (Art. 1 UAbs. 2 EUV) zeichnet sich ein Verschmelzungsprozess ab, dessen Ende offen ist. Betrachtet man den Grad, den die Beschränkungen der EU-Mitgliedstaaten in der autonomen Ausübung ihrer souveränen Rechte erreicht haben, stellt sich die Frage, ob das hier skizzierte herkömmliche Souveränitätskonzept, bei dem die Staaten Inhaber der Souveränität bleiben und die Organisation nur „beliehen“ wird, noch befriedigende Erklärungen zu geben vermag. Für ein offeneres Konzept geteilter oder zusammengefasster Souveränität hat sich das tschechische Verfassungsgericht in seinem (2.) Lissabon-Urteil ausgesprochen:[56]
[T]he European Union has advanced by far the furthest in the concept of shared – “pooled” – sovereignty, and today already forms an entity sui generis, which is difficult to classify in classical political science categories. A key manifestation of a state's sovereignty is the ability to continue to manage its sovereignty (or part of it), or to cede certain powers temporarily or permanently.
Das BVerfG freilich hält an der klassischen völkerrechtlichen Konstruktion fest und betont den Charakter des Unionsrechts als einer von den Mitgliedstaaten als „Herren der Verträge“ abgeleiteten Grundordnung.[57] Insbesondere dürfte nach Auffassung des BVerfG die Gründung eines europäischen Bundesstaates nicht „schleichend“, sondern nur durch besonderen Akt erfolgen, der eine Volksabstimmung nach Art. 146 GG nötig machen würde. Ein archimedischer Punkt dieses traditionellen Souveränitätskonzepts ist das Recht auf Austritt (Art. 50 EUV). Was lange theoretisch schien, dürfte mit dem angekündigten Austritt des (noch) Vereinigten Königreichs aus der EU Realität werden.[58] Wirkliche Unabhängigkeit wird das Königreich kaum erlangen können; vor allem aus ökonomischen Gründen wird mittelfristig eine erneute Annäherung an die Union unvermeidlich sein. Angesichts der engen wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Verzahnung dürfte ein Austritt aus der EU für die meisten Mitgliedstaaten praktisch kaum vorstellbar (und politisch nicht sinnvoll) sein. Mit dem „Brexit“ könnte das traditionelle Souveränitätsdenken einen Pyrrhussieg errungen haben.