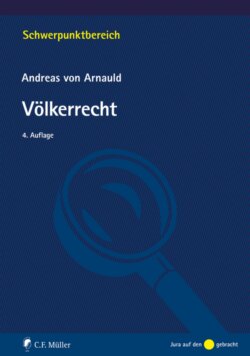Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 79
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Begrenzte Völkerrechtspersönlichkeit
Оглавление116
Um Völkerrechtssubjekt zu sein, muss eine Vereinigung die folgenden Voraussetzungen erfüllen, die sich u. a. aus dem Bernadotte-Gutachten des IGH[96] ableiten lassen:
| – | Sie muss von mindestens zwei Völkerrechtssubjekten (v. a. Staaten oder anderen Internationalen Organisationen, nicht: Privatpersonen) gegründet und getragen werden, um am völkerrechtlichen Verkehr teilnehmen zu können. |
| – | Sie muss auf Dauer angelegt sein, weil es sich sonst nicht um eine Organisation handelt, die eigene Rechtspersönlichkeit erlangen kann. |
| – | Sie muss auf internationaler Ebene nach Maßgabe des Völkerrechts tätig sein (nicht etwa allein im innerstaatlichen Bereich nach dem Recht eines der Gründungsstaaten). |
| – | Ihr müssen eigene Aufgaben zur selbstständigen Wahrnehmung übertragen sein. Nur dann ist eine hinreichende Selbstständigkeit gegeben, die es rechtfertigt, die Vereinigung von der Rechtspersönlichkeit ihrer Mitglieder zu lösen. |
| – | Zum Zwecke der selbstständigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben muss die Organisation schließlich mindestens mit einem eigenen handlungsfähigen Organ ausgestattet sein. |
117
Liegen diese Voraussetzungen vor, so kann die Völkerrechtspersönlichkeit auch implizit vorhanden sein.[97] Vielfach verleihen die Mitgliedstaaten der Organisation die Völkerrechtsfähigkeit jedoch ausdrücklich im Gründungsvertrag (vgl. z. B. Art. 4 Abs. 1 S. 1 IStGH-Statut, Art. 47 EUV). Von der Völkerrechtsfähigkeit, d. h. der Teilnahme am internationalen Rechtsverkehr im eigenen Namen, ist die innerstaatliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit zu unterscheiden, die notwendig ist, um z. B. Miet-, Kauf- und Arbeitsverträge im Sitzstaat zu schließen. Diese dürfte einer Internationalen Organisation regelmäßig implizit mit ihrer Gründung verliehen sein, wird aber z. T. in den Gründungsabkommen ebenfalls explizit geregelt (z. B. Art. 4 Abs. 1 S. 2 IStGH-Statut, Art. 104 UNCh).
118
Die Völkerrechtspersönlichkeit von Internationalen Organisationen ist in sachlicher Hinsicht begrenzt: Rechte und Pflichten der Organisation betreffen nur den Bereich ihrer Zuständigkeit (sog. partielle Völkerrechtspersönlichkeit) So ist z. B. die WMO nur für meteorologische Fragen zuständig, wie sie in der Gründungssatzung festgelegt sind, oder die WTO für Fragen grenzüberschreitenden Handels. Nach traditioneller Ansicht ist der Subjektstatus Internationaler Organisationen zudem im Außenverhältnis in „persönlicher“ Hinsicht begrenzt. Anders als bei Staaten als „geborene“ Völkerrechtssubjekte handelt es sich bei ihnen um künstlich geschaffene („gekorene“) Rechtssubjekte. Um nach außen Völkerrechtssubjekt werden zu können, bedarf die Internationale Organisation demnach der Anerkennung und besitzt Rechtspersönlichkeit nur gegenüber Staaten, die sie anerkennen (sog. relative Völkerrechtspersönlichkeit). Eine Ausnahme wird allgemein für die UNO gemacht, der der IGH schon 1949 im Bernadotte-Gutachten eine gegenüber allen Staaten wirkende objektive Völkerrechtspersönlichkeit zugesprochen hat (Rn. 137). Die zentrale Begründung des IGH in jenem Gutachten (Repräsentation eines großen Teils der Staatengemeinschaft) trifft inzwischen allerdings auf eine Vielzahl von Organisationen zu. Der Repräsentationsgedanke ist aber nicht das alleinige Argument: Selbst regionale Organisationen wie die EU oder die AU sind heute ganz selbstverständlich als wichtige internationale Akteure in der gesamten Staatenwelt akzeptiert. Angesichts der zentralen Rolle Internationaler Organisationen im heutigen Völkerrecht erscheint es gekünstelt, an dem Erfordernis einer (ohnedies in aller Regel nur aus den Umständen zu schließenden) Anerkennung durch Staaten festzuhalten.[98]