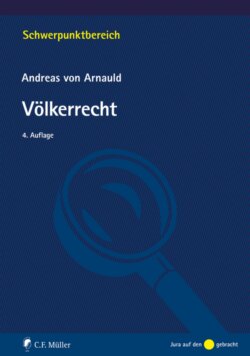Читать книгу Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 85
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Rechtsbindungen und Haftung Internationaler Organisationen
Оглавление129
Im Rahmen ihrer Tätigkeit können Internationale Organisationen zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge mit Staaten oder anderen Internationalen Organisationen ermächtigt sein; gegebenenfalls ist auf die Grundsätze der soeben erwähnten Implied-powers-Lehre zurückzugreifen. Regelmäßig schließen Internationale Organisationen mit dem Staat, in dem sich ihr Sitz befindet, Sitzabkommen, in denen insbesondere Fragen der Immunität der Beschäftigten geregelt sind. Einen Versuch, die gewohnheitsrechtlich geltenden Regeln für Vertragsschlüsse durch Internationale Organisationen zu bündeln, stellt das Wiener Übereinkommen (Konvention) über das Recht der Verträge zwischen Staaten und Internationalen Organisationen oder zwischen Internationalen Organisationen (WVKIO) von 1986 dar, das noch nicht in Kraft getreten ist (Stand: Juni 2019).
130
Internationale Organisationen sind hierüber hinaus auch an das allgemeine Völkerrecht (Völkergewohnheitsrecht, Allgemeine Rechtsgrundsätze)[115] gebunden, wobei einige dieser Regeln (z. B. Vertragsschluss, Verantwortlichkeit: hierzu Rn. 381–383) modifiziert sind, um Besonderheiten Rechnung zu tragen. Je mehr Internationale Organisationen öffentliche Gewalt ausüben, desto drängender stellt sich auch die Frage nach einer Bindung an Menschenrechtsstandards. In aller Regel sind Internationale Organisationen selbst nicht Vertragsparteien internationaler Menschenrechtsabkommen (allerdings soll die EU gemäß Art. 6 Abs. 2 EUV der EMRK beitreten), jedoch lässt sich in einigen Fällen eine Bindung aus dem Gründungsvertrag ableiten – sei es explizit (z. B. Art. 6 EUV, EU-Grundrechtecharta), sei es implizit (zur Menschenrechtsbindung der Vereinten Nationen Rn. 157). Daneben sprechen für eine hierüber hinausgehende Bindung Internationaler Organisationen an gewohnheitsrechtlich geltende Menschenrechtsstandards zumindest gute Gründe, zumindest dann, wenn man (wie hier: Rn. 252) Internationale Organisationen in den Kreis der Autoren des Gewohnheitsrechts einbezieht.[116]
131
Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage der Haftung Internationaler Organisationen. Dabei geht es zunächst einmal um ihre vertraglich übernommenen Verbindlichkeiten. Bei der außervertraglichen Haftung für deliktische Schäden ist als Vorfrage zu klären, ob die Organisation für den schädigenden Akt völkerrechtlich verantwortlich, insbesondere ob ihr der Akt zurechenbar ist (vertieft Rn. 398–417).[117] Mit Blick auf die Haftung ist vor allem umstritten, ob die Mitgliedstaaten für Verbindlichkeiten der Organisation einstehen müssen, wenn diese zahlungsunfähig ist. Diese Frage wurde mit dem Zusammenbruch des Internationalen Zinnrates (International Tin Council) 1985 virulent. Die überwiegende Ansicht geht heute von einer Alleinhaftung der Internationalen Organisation aus. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die Organisation eine eigenständige Rechtspersönlichkeit besitzt, was außer Acht bliebe, würde man die Mitglieder ohne Weiteres in die Haftung einbeziehen. Weithin akzeptiert ist allerdings ein Haftungsdurchgriff (piercing the corporate veil) auf die Mitgliedstaaten, wenn diese bei wertender Betrachtung die Situation mitverschuldet haben. Dies ist der Fall bei (jedenfalls bewusster) Unterkapitalisierung, bei hoch riskanten Tätigkeiten und in Fällen, in denen das „Verstecken“ hinter der Organisation rechtsmissbräuchlich erscheint.[118]