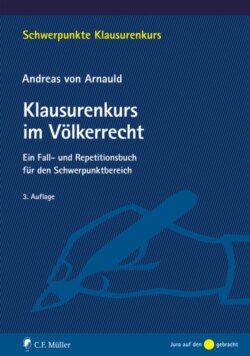Читать книгу Klausurenkurs im Völkerrecht - Andreas von Arnauld - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Gewohnheitsrecht
Оглавление22
Der Umgang mit Gewohnheitsrecht in völkerrechtlichen Klausurfällen bereitet wohl die größten Schwierigkeiten. Völkergewohnheitsrecht besteht aus einer hinlänglich gefestigten Staatenpraxis (consuetudo) und einer dieser Praxis stützenden Rechtsüberzeugung (opinio iuris sive necessitatis).[26] Wie aber soll man eine gefestigte Übung in einer Klausur darstellen und wie eine Rechtsüberzeugung der Staaten begründen, ohne sie bloß zu behaupten? Hierauf gleich eine auf den ersten Blick ketzerisch anmutende Antwort: Es ist unmöglich, in einer Klausurlösung eine Norm des Völkergewohnheitsrechts in einer Weise zu begründen, die den Anforderungen an den Nachweis von Gewohnheitsrecht genügen würde.[27] Dies verlangt auch niemand. Sieht man sich an, wie die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen (International Law Commission, ILC) in ihren Arbeiten umfangreiches Fallmaterial zusammenträgt (das seinerseits regelmäßig aber auch nur eine kleine Auswahl der Staatenpraxis umfasst und beileibe nicht repräsentativ sein muss), wird einem schnell klar, dass Vergleichbares nicht einmal annähernd von Studierenden verlangt werden kann, die eine Klausur im Völkerrecht schreiben.
23
Für derartige Klausurlösungen erlangen die in Art. 38 Abs. 1 lit. d) IGH-Statut genannten Hilfsquellen zur Ermittlung gewohnheitsrechtlicher Regeln besondere Bedeutung (Rechtserkenntnisquellen): Gerichtsentscheidungen oder Stimmen in der völkerrechtlichen Literatur.[28] Hinzu kommen bestimmte besonders markante Beispiele von Staatenpraxis. Auch Entwürfe der ILC, an sich dem soft law zugehörige Resolutionen, vor allem auch völkerrechtliche Verträge, die zumindest in Teilen als Kodifikation von Gewohnheitsrecht angesehen werden (als Beispiele seien hier die WVK, das WÜD oder Teile des SRÜ genannt), sind hilfreiche Bausteine einer „klausurgerechten“ Begründung gewohnheitsrechtlicher Regeln des Völkerrechts. Um für Klausuren gerüstet zu sein, sollte man daher über bestimmte Grundkenntnisse verfügen: Wesentliche Aussagen klassischer gerichtlicher oder schiedsgerichtlicher Entscheidungen gehören dazu,[29] ebenso wichtige völkerrechtsrelevante zeitgeschichtliche und zeitgenössische Ereignisse und Entwicklungen.
24
Natürlich muss nicht das ganze Arsenal an Begründungselementen für jede Norm des Gewohnheitsrechts mobilisiert werden, die es im Zuge einer Klausurbearbeitung heranzuziehen gilt. Gefordert ist vielmehr eine differenzierende Begründungsökonomie: Es hängt davon ab, ob es sich um ein Schwerpunktproblem des Falles handelt oder um eine Detailfrage, die eher beiläufig überwunden werden sollte, um zielstrebig zu den eigentlichen Problemen des Falles vorzudringen. Wenn z. B. ein Staatsorgan handelt, braucht man auf die Herleitung der Zurechnung von Organhandeln zum Staat kaum Mühe zu verwenden, sondern kann sich auf die bloße Feststellung beschränken, dass die Zurechnung von Organhandeln Gewohnheitsrecht ist (evtl. noch verbunden mit dem Hinweis, dass, weil Staaten überhaupt nur durch Organe handeln können, eine Staatenverantwortlichkeit ansonsten auch gar nicht denkbar wäre). Sind aber Zurechnungsfragen, u. U. in Abgrenzung zueinander, ein Hauptgegenstand des Falles, so kann man etwas eingehender darlegen, warum welche Zurechnungsgrundsätze als Bestandteil des Völkergewohnheitsrechts gelten können (hierzu Fall 5). Die Bandbreite der Begründungsmöglichkeiten reicht von reinen Autoritätsargumenten („Wie der IGH im X-Fall festgestellt hat, ist gewohnheitsrechtlich anerkannt, dass. . .“) bis hin zur eingehenden Darlegung der Herausbildung eines Völkerrechtssatzes und der verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Meist wird man einen Mittelweg beschreiten, der mal mehr in die eine, mal mehr in die andere Richtung führt.
25
Ebenfalls möglich ist, Ableitungen aus allgemein anerkannten Grundsätzen des Gewohnheitsrechts (gilt entsprechend für Ableitungen aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen) vorzunehmen: Man begründet den Ausgangsrechtssatz (weiß möglichst auch eine Gerichtsentscheidung, die diesen Satz stützt) und leitet aus ihm einen weiteren Rechtssatz her. Gewiss ist richtig, dass „die logische Ableitung von Völkerrechtssätzen eine Sache, die Anerkennung solcher Sätze in der Staatenpraxis eine andere ist“[30]; im Idealfall wird man den so gewonnenen Rechtssatz daher anhand von Staatenpraxis oder durch Gerichtsentscheidungen abzusichern versuchen, also eine Kombination aus Deduktion (= Argumentation vom Allgemeinen zum Besonderen) und Induktion (= Argumentation vom Besonderen zum Allgemeinen) anstreben.[31] Nicht immer wird dies gelingen. Letztlich geht es darum, Inhalt und Geltung eines Rechtssatzes jedenfalls plausibel und möglichst überzeugend darzulegen. Zudem geht es in Klausuren um den Nachweis, dass man den Lernstoff „drauf hat“.