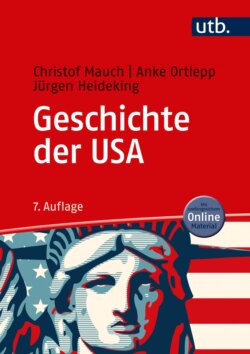Читать книгу Geschichte der USA - Anke Ortlepp - Страница 48
LandwirtschaftLandwirtschaft und frühe IndustrialisierungIndustrialisierung
ОглавлениеDas wirtschaftlicheWirtschaft Wachstum nahm seinen Ausgang von der Erweiterung der Anbaufläche und der Kommerzialisierung der LandwirtschaftLandwirtschaftKommerzialisierung (1. Hälfte 19.Jh.). Dieser Vorgang erfasste die gesamte Union, trug jedoch regionalspezifische Züge und hatte unterschiedliche Konsequenzen. Enorme agrarische Steigerungsraten erzielte der NordwestenNordwesten, wo die neu entstehenden Familienfarmen Getreide, vor allem Mais, anbauten sowie Fleisch und Milchprodukte erzeugten. Technische Neuerungen wie die von John DeereDeere, John verbesserten Pflugscharen und Mäh- und Dreschmaschinen, die sich schon in den 1840er Jahren durchsetzten, trugen wesentlich zu diesem Boom bei. Die Farmer mussten über den Eigenbedarf hinaus für den Markt produzieren, weil sie nur so die Schuldverpflichtungen erfüllen konnten, die sie für den Aufbau ihrer Existenz notgedrungen eingegangen waren. Dadurch wurden sie allerdings auch von dem oft schwer durchschaubaren Marktgeschehen abhängig, insbesondere von der Zinsentwicklung und den schwankenden Getreidepreisen, die in den Krisen von 1819–1823 und 1839–1843 viele Familien zur Aufgabe und zum Abwandern in die Städte zwangen. Hier suchten sie Arbeit in den Industrien, die inzwischen im Zusammenhang mit der LandwirtschaftLandwirtschaftKommerzialisierung (1. Hälfte 19.Jh.) entstanden waren: in den Schlachthöfen und bei der Fleischverpackung; beim Landmaschinenbau, in der Holzverarbeitung und in Brauereien. Während St. LouisSt. Louis, Missouri weiterhin das „Tor zum WestenWesten“ bildete, stieg ChicagoChicago zum wirtschaftlichenWirtschaft Kraftzentrum des Mittleren WestensMittlerer Westen auf. Hier vollzog sich am anschaulichsten der Übergang vom konkreten geographischen Ort „Markt“, auf dem die Farmer ihre Erzeugnisse verkauften, zum komplexen und abstrakten ökonomischenWirtschaft System „Markt“, das Vieh, Getreide und andere Produkte in standardisierte, industrialisierte Waren verwandelte und in Geldwerte umsetzte.
Entscheidende Bedeutung für die gesamte Region erlangte jedoch der Austausch mit den Ostküstenstaaten, der durch die neuen Verkehrswege ermöglicht wurde. Nachdem man gelernt hatte, Eis zur Kühlung von Eisenbahnwaggons zu nutzen, lieferte der Mittlere WestenWesten nahezu jahreszeitunabhängig Lebensmittel an die Küste. Auf diese Weise wurden die Voraussetzungen für das Entstehen einer MassenkonsumgesellschaftGesellschaftAntebellum geschaffen. Der NordostenNordosten konnte sich nun zunehmend auf Handel, Bankwesen und Industrie spezialisieren, wobei die großen Städte BostonBoston, New YorkNew York City und PhiladelphiaPhiladelphia als Motoren des Wachstums fungierten. Die LandwirtschaftLandwirtschaftKommerzialisierung (1. Hälfte 19.Jh.) hatte in den Neuenglandstaaten stets mit ungünstigen Voraussetzungen zu kämpfen gehabt und kam nun gegen die billige Konkurrenz aus dem Westen nicht mehr an. Da auch der Nordatlantikhandel wegen des starken britischenGroßbritannien Wettbewerbs an Lukrativität einbüßte, erkundeten die Kaufleute neue Möglichkeiten in LateinamerikaLateinamerika, im pazifischen Raum und in AfrikaAfrika. In immer stärkerem Maße floss Handels- und Bankkapital nun aber in Manufakturen und Industriebetriebe. Hierfür wählten die Händler-Unternehmer seltener die Form der inkorporierten Aktiengesellschaft als Partnerschaften oder die alleinige Firmenführung, um möglichst frei von staatlicher Regulierung zu bleiben. Ausgehend von NeuenglandNeuengland (s.a. Nordosten, Regionen), wurde das traditionelle Handwerkswesen – oft über die „protoindustrielle“ Zwischenstufe der Verlags- oder Heimarbeit – allmählich durch das neue System der FabrikarbeitArbeiter ersetzt. Arbeitsteilung und Mechanisierung zur Senkung der Kosten und zur Steigerung der Produktion ließen in den 1820er Jahren eine Textilindustrie, im Jahrzehnt darauf auch eine Schuhindustrie entstehen. Die ersten Fabrikbelegschaften rekrutierten sich aus FarmerstöchternFrauenArbeitArbeiterFrauen, die in den großen Textilbetrieben von LowellLowell und WalthamWaltham in MassachusettsMassachusetts zu Tausenden unter strenger Disziplin nahezu kaserniert lebten. Viele dieser mill girls empfanden die bescheiden entlohnte Tätigkeit (die sie in der Regel nur bis zur Heirat ausübten) dennoch als Befreiung aus der völligen Abhängigkeit von ihren Familien. Ab 1840 bildeten dann die europäischen EinwandererEinwanderungJahrhundertmitte (19.Jh.) ein größeres und billigeres Reservoir an industriellen ArbeitskräftenArbeiter.
Zwischen 1840 und 1860 nahm die unternehmerische Initiative fast explosionsartig zu. Besonders spektakulär wuchs die IndustrieWirtschaft im NordostenNordosten, wo über die Hälfte der bis dahin 140.000 amerikanischen Fabriken entstand. Hier wurden nun gut zwei Drittel aller heimischen Industriegüter erzeugt, und der Wert der Produktion stieg in den beiden Jahrzehnten von 500 Millionen auf 2 Milliarden Dollar. Die Ausbreitung des FabriksystemsArbeiter signalisierte den Übergang vom „Händler-Kapitalismus“ des frühen 19. Jahrhunderts zum Industriekapitalismus, der in EnglandGroßbritannien bereits weiter fortgeschritten war. Der amerikanische Erfolg ergab sich aus einer Kombination von arbeitskräftesparenden Innovationen und Ausbeutung der im Übermaß vorhandenen natürlichen Ressourcen. Die Dampfkraft, durch Kohle erzeugt, ersetzte allmählich die traditionelle Wasserkraft; beim Kanal- und EisenbahnbauEisenbahnAntebellum lernten die Amerikaner, Werkzeuge und Maschinen zu verbessern und Ersatzteile zu standardisieren. Einen Rückstand gegenüber EnglandGroßbritannien gab es vor allem noch auf dem Gebiet der Eisenproduktion, wo weiterhin Importe aus Europa nötig waren.
Bis zur Jahrhundertmitte verband eine zunehmend komplexe und diversifizierte WirtschaftWirtschaft den NordostenNordosten und den Mittleren WestenMittlerer Westen, zwei Regionen, die sich gut ergänzten und wechselseitig zu erhöhter Aktivität anspornten. Zwar war der Norden insgesamt noch überwiegend agrarisch geprägt, aber der Strukturwandel zur industriellen Gesellschaft zeichnete sich schon deutlich ab: Der Anteil der in der LandwirtschaftLandwirtschaftKommerzialisierung (1. Hälfte 19.Jh.) beschäftigten Amerikaner, der 1820 noch bei 80 Prozent gelegen hatte, ging bis 1850 auf 55 Prozent zurück. Um diese Zeit verdienten immerhin schon 14 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ihren Lebensunterhalt in Fabriken, und die Zahl der Menschen, die in Städten mit über 10.000 Einwohnern lebten, näherte sich der 5-Millionen-Grenze. Das Wachstum des inneren Marktes ging einher mit der Expansion des Außenhandels, den Neuengländer und New Yorker YankeesYankee nun bereits weltumspannend betrieben. Große Hoffnungen richteten sich auf den asiatischen Markt, den die amerikanische Regierung durch Verträge mit ChinaChina (1844) und JapanJapanHandelsvertrag von 1855 (1855) zu „öffnen“ hoffte. Das religiöse Moment spielte dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle, denn die Kaufleute folgten häufig den protestantischen Missionaren, die erste Kontakte mit fremden Völkern knüpften.
Expansion und Kommerzialisierung bestimmten auch das Bild des Südens, allerdings auf eine ganz eigene Weise. In den Küstenstaaten des oberen Südens – VirginiaVirginia, MarylandMaryland, DelawareDelaware –, wo die ausgelaugten Böden eine Umstellung von Tabak- auf Weizenanbau erforderlich machten, war wenig Dynamik zu verspüren. Durch den steigenden Bedarf der Textilindustrien in EnglandGroßbritannienWirtschaftsbeziehungen und im amerikanischen NordostenNordosten gewann nun die plantagenmäßige Baumwollproduktion überragende Bedeutung. Das Anbaugebiet und damit auch das System der Sklavenarbeit dehnte sich rasch von South CarolinaSouth Carolina und GeorgiaGeorgia über das Mississippi-DeltaMississippi (Fluss) bis nach TexasTexas aus, und der SüdwestenSüdwesten wurde zur eigentlichen Wachstumszone. Tabak, Reis und Zuckerrohr verschwanden nicht völlig aus der Landschaft, aber King Cotton herrschte unumschränkt als das mit weitem Abstand wichtigste Ausfuhrprodukt. Zwischen 1820 und 1860 verzehnfachte sich der Export von 500.000 auf 5 Millionen Ballen. Bis dahin brachte der Verkauf von BaumwolleBaumwolle rund zwei Drittel des Gesamterlöses ein, den die USA im Außenhandel erzielten. Wichtigste Abnehmer blieben die EngländerGroßbritannienWirtschaftsbeziehungen, die auch ihre traditionelle Funktion als Kreditgeber für die Plantagenbesitzer beibehielten. Die Baumwollpflanzer handelten durchaus als Unternehmer, die gewöhnt waren, in den Marktkategorien von Wettbewerb, Investition, Gewinn, Angebot und Nachfrage zu denken. Sklaven betrachteten sie zugleich als Arbeitskräfte und Kapital, d. h. als eine „Ressource“, die im Zuge des Baumwollbooms knapp und teuer wurde. Rein ökonomisch gesehen, hatte sich die SklavereiSklaverei (s.a. Afroamerikaner) keineswegs „überlebt“, sondern versprach weiterhin hohe Profite. Entsprechend wuchs der Druck der Pflanzer auf die Staatenregierungen und den Kongress, die 1808 verbotene Sklaveneinfuhr wieder zu legalisieren. Da sich die Baumwollerzeugung nur durch Vergrößerung der Anbaufläche steigern ließ, werteten die Pflanzer alle Versuche, die SklavereiSklaverei (s.a. Afroamerikaner) territorial einzugrenzen, als Beeinträchtigung ihrer Zukunftschancen. Insgesamt herrschte noch der Eindruck ungebrochener Prosperität vor, und selbst die Mehrzahl der Farmer, die wenige oder keine Sklaven besaßen, wurde in den Prozess der Kommerzialisierung einbezogen. Andererseits blieb der Aufbau von Industrien im SüdenSüden gerade wegen des monokulturellen Charakters der Baumwolle in den Anfängen stecken. Aus heutiger Sicht erkennt man, was den meisten Zeitgenossen verborgen blieb: dass die WirtschaftWirtschaft des Südens zwar wuchs, sich aber nicht – im Sinne einer Modernisierung – entwickelte. Dadurch geriet die Region in Abhängigkeit vom Weltmarkt (auf dem Baumwolle vorerst noch gute Preise erzielte) wie von den Bankiers und Kaufleuten aus dem Norden, die Binnenhandel und Küstenschifffahrt kontrollierten.